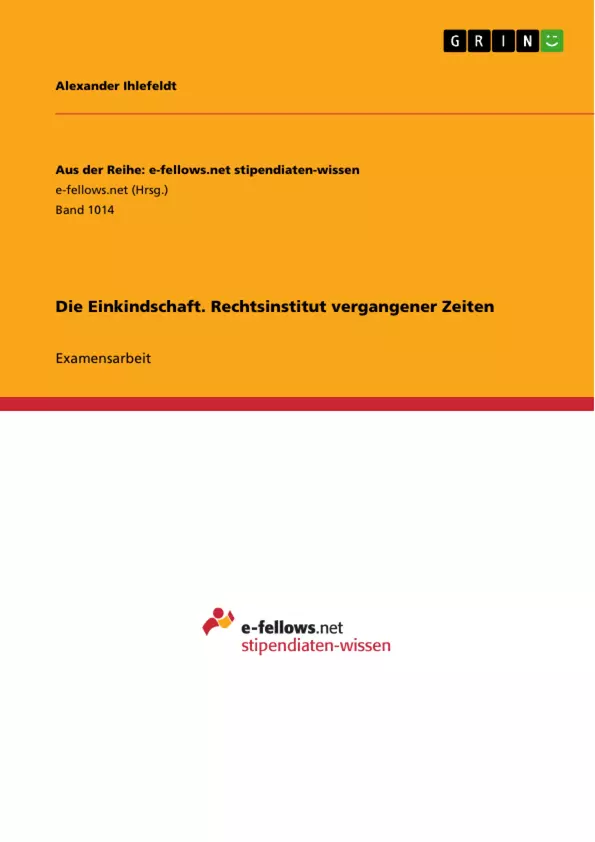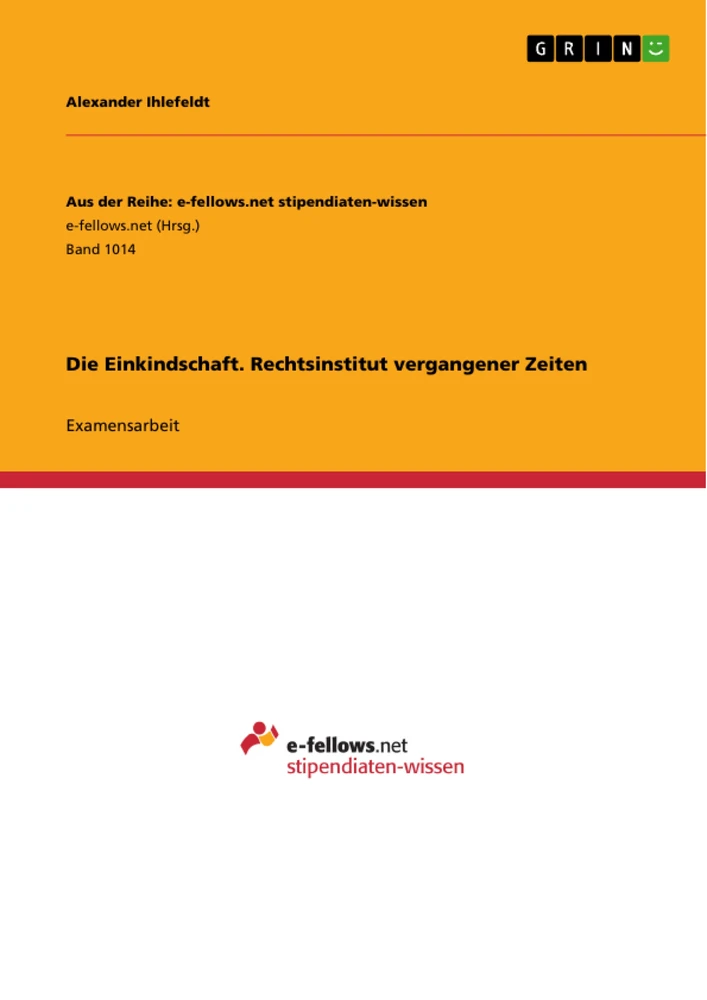
Die Einkindschaft. Rechtsinstitut vergangener Zeiten
Examensarbeit, 2013
51 Seiten, Note: 14 Punkte
Jura - Rechtsphilosophie, Rechtssoziologie, Rechtsgeschichte
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- A. Einleitung
- B. Das Rechtsinstitut der Einkindschaft
- C. Die Einkindschaft im Deutschen Privatrecht
- I. Räumliche Verbreitung der Einkindschaft während der Periode des Deutschen Privatrechts
- II. Gestaltungsformen
- III. Merkmale der Einkindschaft in den fränkischen Rechten
- 1. Gestaltungsform
- 3. Formvorschriften
- 4. Weitere Regeln zum Schutz minderjähriger Kinder
- 5. Voraus der Kinder und Vorbehaltsgut der Eltern
- 6. Einkindschaftung nichtehelicher Kinder
- 7. Auflösungsmöglichkeiten
- 8. Rechtsfolge der Einkindschaft
- 9. Begründung elterlicher Gewalt
- IV. Die Einkindschaft nach Hamburgischen Recht
- 1. Gestaltungsform
- 2. Wesentliche Merkmale
- V. Stellungnahme
- D. Die Einkindschaft in den deutschsprachigen Kodifikationen des 18. und 19. Jahrhunderts
- I. Preußisches ALR
- 1. Gestaltungsform und Merkmale
- 2. Das praecipuum im ALR
- 3. Die Rechtsnatur der Einkindschaft im ALR
- II. CMBC
- III. ABGB
- IV. Stellungnahme
- E. Der historische Ursprung der Einkindschaft
- I. Das römische Recht und die Einkindschaft
- II. Die Einkindschaft im einheimischen deutschen Recht
- III. Durch Einkindschaft gelöste Problemstellungen
- IV. Der Zusammenhang zwischen Einkindschaft und ehelichem Güterrecht
- V. Profiteure und Benachteiligte der Einkindschaft
- F. Die Bedeutung der Einkindschaft vor dem Hintergrund der damaligen Rechts- und Gesellschaftsverhältnisse
- G. Die Einkindschaft im heutigen Recht
- H. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das mittelalterliche Rechtsinstitut der Einkindschaft, seine Entwicklung im deutschen Privatrecht des 18. und 19. Jahrhunderts und in den wichtigsten Kodifikationen dieser Zeit. Sie beleuchtet die Herkunft, die Probleme, die Vor- und Nachteile sowie die aktuelle Rechtslage der Einkindschaft. Der Fokus liegt auf der rechtsdogmatischen Einordnung an der Schnittstelle von Familien- und Erbrecht.
- Die Definition und Entwicklung des Rechtsinstituts der Einkindschaft
- Die Einkindschaft im deutschen Privatrecht des 18. und 19. Jahrhunderts
- Die Darstellung der Einkindschaft in verschiedenen Kodifikationen
- Die historischen Ursprünge und die damit verbundenen Problemstellungen
- Die Bedeutung der Einkindschaft im Kontext der damaligen Rechts- und Gesellschaftsverhältnisse
Zusammenfassung der Kapitel
A. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Einkindschaft ein und betont das Spannungsverhältnis zwischen gesellschaftlicher Realität und Rechtswirklichkeit, insbesondere im Familien- und Erbrecht. Sie skizziert den Forschungsgegenstand und den Aufbau der Arbeit, der die Entwicklung des Rechtsinstituts der Einkindschaft von seinen Ursprüngen bis zur Gegenwart verfolgt.
B. Das Rechtsinstitut der Einkindschaft: Dieses Kapitel definiert das Rechtsinstitut der Einkindschaft als die erbrechtliche Gleichstellung von Stiefgeschwistern und klärt die verwandten Begriffe wie Stiefkind und Stiefeltern. Es bietet eine erste Einführung in die Thematik und legt den Grundstein für die detailliertere Auseinandersetzung in den folgenden Kapiteln.
C. Die Einkindschaft im Deutschen Privatrecht: Dieses Kapitel befasst sich ausführlich mit der Verbreitung, den Gestaltungsformen und Merkmalen der Einkindschaft im deutschen Privatrecht. Es untersucht die Einkindschaft in verschiedenen regionalen Rechtsordnungen und vergleicht deren Ausgestaltung. Die Analyse umfasst die Formvorschriften, den Schutz minderjähriger Kinder, den Umgang mit nichtehelichen Kindern, Auflösungsmöglichkeiten, Rechtsfolgen und die Begründung elterlicher Gewalt im Kontext der Einkindschaft.
D. Die Einkindschaft in den deutschsprachigen Kodifikationen des 18. und 19. Jahrhunderts: Dieses Kapitel analysiert die Darstellung der Einkindschaft in bedeutenden Kodifikationen wie dem preußischen ALR, dem CMBC und dem ABGB. Es vergleicht die jeweiligen Regelungen und wertet deren rechtliche Natur und Bedeutung im Kontext der jeweiligen Zeit aus. Die Stellungnahme am Ende des Kapitels fasst die Ergebnisse zusammen und ordnet sie in den größeren Kontext der Rechtsentwicklung ein.
E. Der historische Ursprung der Einkindschaft: Dieses Kapitel untersucht die historischen Ursprünge der Einkindschaft, indem es die römischen Rechtsgrundlagen und die Entwicklung im einheimischen deutschen Recht beleuchtet. Es analysiert die Probleme, die durch die Einkindschaft gelöst werden sollten, den Zusammenhang mit dem ehelichen Güterrecht, sowie die Gruppen, die von der Einkindschaft profitierten oder benachteiligt wurden.
F. Die Bedeutung der Einkindschaft vor dem Hintergrund der damaligen Rechts- und Gesellschaftsverhältnisse: Dieses Kapitel setzt die Einkindschaft in den Kontext der damaligen Rechts- und Gesellschaftsverhältnisse. Es analysiert die sozialen und wirtschaftlichen Faktoren, die zur Entstehung und Entwicklung dieses Rechtsinstituts beitrugen, und erläutert dessen Bedeutung im gesellschaftlichen Gefüge der jeweiligen Epoche.
Schlüsselwörter
Einkindschaft, Deutsches Privatrecht, Erbrecht, Familienrecht, Kodifikationen, ALR, CMBC, ABGB, Stiefgeschwister, Rechtsgeschichte, Rechtsvergleichung, Mittelalter, Rechtsinstitut, historische Entwicklung.
Häufig gestellte Fragen zur Arbeit über die Einkindschaft
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht das mittelalterliche Rechtsinstitut der Einkindschaft, seine Entwicklung im deutschen Privatrecht des 18. und 19. Jahrhunderts und in den wichtigsten Kodifikationen dieser Zeit. Sie beleuchtet die Herkunft, die Probleme, die Vor- und Nachteile sowie die aktuelle Rechtslage der Einkindschaft. Der Fokus liegt auf der rechtsdogmatischen Einordnung an der Schnittstelle von Familien- und Erbrecht.
Was ist eine Einkindschaft?
Die Einkindschaft ist ein erbrechtliches Institut, das die erbrechtliche Gleichstellung von Stiefgeschwistern beschreibt. Die Arbeit klärt verwandte Begriffe wie Stiefkind und Stiefeltern und bietet eine detaillierte Auseinandersetzung mit dem Thema.
Welche historischen Entwicklungsphasen der Einkindschaft werden behandelt?
Die Arbeit verfolgt die Entwicklung des Rechtsinstituts der Einkindschaft von seinen Ursprüngen bis zur Gegenwart. Sie umfasst die Einkindschaft im deutschen Privatrecht, in verschiedenen regionalen Rechtsordnungen, sowie deren Darstellung in bedeutenden Kodifikationen wie dem preußischen ALR, dem CMBC und dem ABGB.
Welche Aspekte der Einkindschaft werden im Detail untersucht?
Die Arbeit analysiert die räumliche Verbreitung, Gestaltungsformen und Merkmale der Einkindschaft. Sie befasst sich mit Formvorschriften, dem Schutz minderjähriger Kinder, dem Umgang mit nichtehelichen Kindern, Auflösungsmöglichkeiten, Rechtsfolgen, der Begründung elterlicher Gewalt und dem Zusammenhang mit dem ehelichen Güterrecht. Die Arbeit untersucht auch die historischen Ursprünge, insbesondere im römischen Recht und im einheimischen deutschen Recht, sowie die Probleme, die durch die Einkindschaft gelöst werden sollten, und wer davon profitierte oder benachteiligt wurde. Schließlich wird die Bedeutung der Einkindschaft im Kontext der damaligen Rechts- und Gesellschaftsverhältnisse beleuchtet.
Welche Kodifikationen werden in der Arbeit untersucht?
Die Arbeit analysiert die Darstellung der Einkindschaft im preußischen ALR (Allgemeines Landrecht), im CMBC (Codex Maximilianeus Bavaricus Civilis) und im ABGB (Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch).
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit ist in verschiedene Kapitel gegliedert, beginnend mit einer Einleitung, die das Thema einführt und den Aufbau der Arbeit skizziert. Weitere Kapitel befassen sich mit dem Rechtsinstitut der Einkindschaft, seiner Entwicklung im deutschen Privatrecht, seiner Darstellung in den genannten Kodifikationen, seinen historischen Ursprüngen und seiner Bedeutung im Kontext der damaligen Rechts- und Gesellschaftsverhältnisse. Ein Fazit rundet die Arbeit ab. Ein ausführliches Inhaltsverzeichnis mit Kapitelzusammenfassungen ist enthalten.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Einkindschaft, Deutsches Privatrecht, Erbrecht, Familienrecht, Kodifikationen, ALR, CMBC, ABGB, Stiefgeschwister, Rechtsgeschichte, Rechtsvergleichung, Mittelalter, Rechtsinstitut, historische Entwicklung.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, das Rechtsinstitut der Einkindschaft umfassend zu untersuchen und seine Entwicklung von den Ursprüngen bis in die Gegenwart zu dokumentieren. Sie soll die rechtsdogmatische Einordnung der Einkindschaft an der Schnittstelle von Familien- und Erbrecht beleuchten und die Bedeutung dieses Instituts im historischen und gesellschaftlichen Kontext verdeutlichen.
Details
- Titel
- Die Einkindschaft. Rechtsinstitut vergangener Zeiten
- Hochschule
- Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover (Lehrstuhl für Zivilrecht und Rechtsgeschichte)
- Veranstaltung
- Rechtsgeschichte
- Note
- 14 Punkte
- Autor
- Alexander Ihlefeldt (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2013
- Seiten
- 51
- Katalognummer
- V281675
- ISBN (eBook)
- 9783656766988
- ISBN (Buch)
- 9783656842651
- Dateigröße
- 682 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- einkindschaft rechtsinstitut zeiten
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 19,99
- Preis (Book)
- US$ 28,99
- Arbeit zitieren
- Alexander Ihlefeldt (Autor:in), 2013, Die Einkindschaft. Rechtsinstitut vergangener Zeiten, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/281675
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-