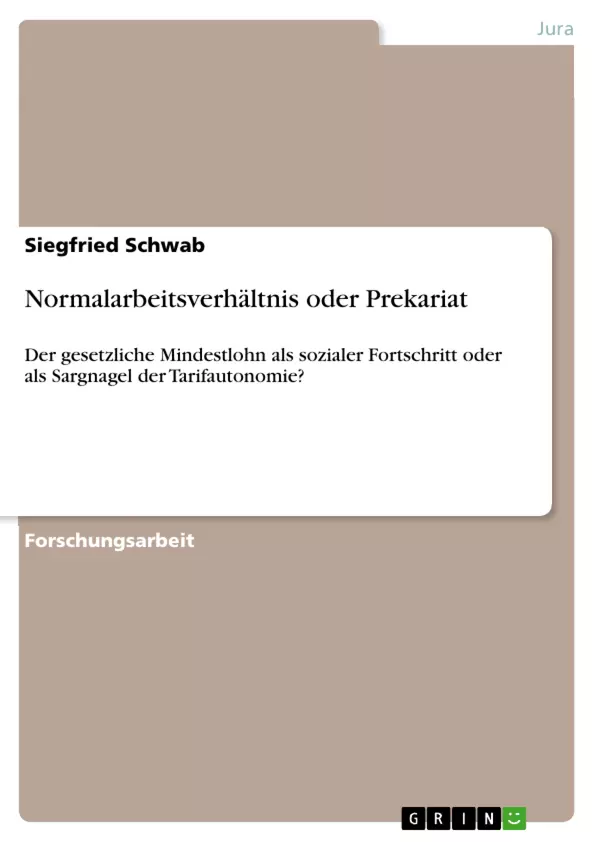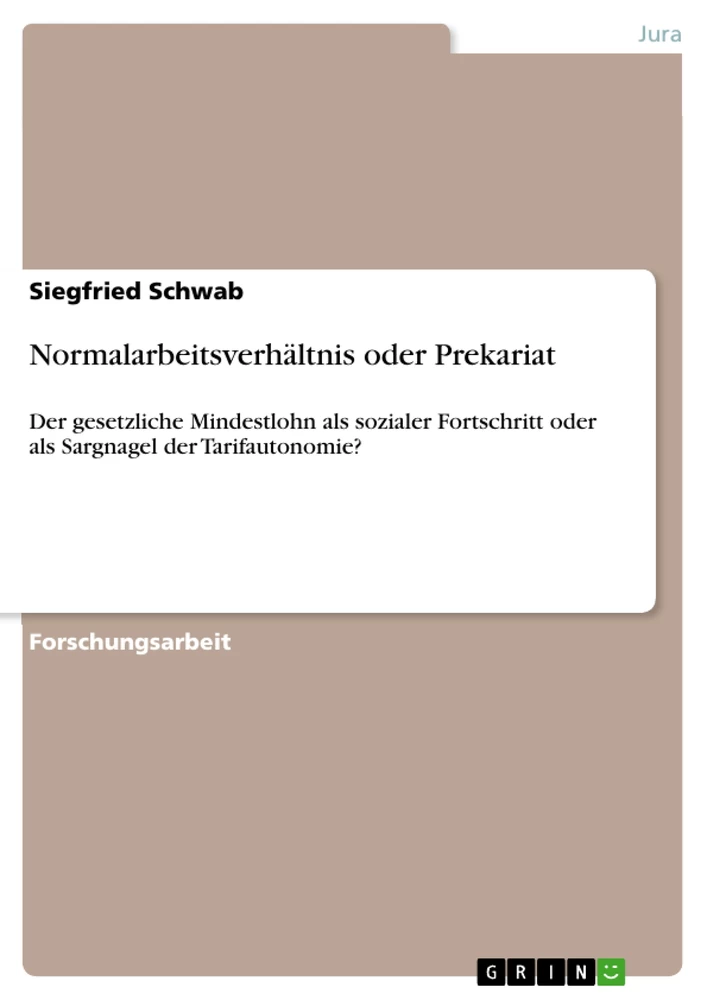
Normalarbeitsverhältnis oder Prekariat
Forschungsarbeit, 2014
136 Seiten, Note: 1,0
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Dem Sozialstaat können und dürfen Funktionsdefizite der Tarifautonomie nicht gleichgültig sein.
- Normalarbeitsverhältnis oder Prekariat
- Die demographischen und ökonomischen Rahmenbedingungen in Deutschland ändern sich bis 2030 grundlegend.
- Die Arbeitswelt ist einem radikalen Wandel unterworfen.
- Die Billiglöhne von heute führen zu einer niedrigen Grundsicherung im Alter.
- Die Tarifautonomie ist von zentraler Bedeutung für unser Arbeits- und Wirtschaftsleben.
- Normalarbeitsverhältnis oder Prekariat
- Prekär Beschäftigte sind nach der Internationalen Arbeitsorganisation diejenigen, die nur „partiell im arbeitsrechtlichen Schutzkreis stehen“
- Der 68. Deutsche Juristentag fasste den Beschluss gegen eine Lockerung des Kündigungsschutzes.
- Der Umbruch der Arbeitswelt ist seit der Sozialenzyklika "Rerum novarum", dem Gründungsdokument der Katholischen Soziallehre, zentrales Thema kirchlicher Lehrverkündung.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Veränderungen in der deutschen Arbeitswelt, insbesondere den Wandel vom Normalarbeitsverhältnis hin zum Prekariat, und die damit verbundenen Herausforderungen für die Tarifautonomie und den Sozialstaat. Sie analysiert die Auswirkungen von Billiglöhnen, atypischen Beschäftigungsverhältnissen und der zunehmenden Erwerbsunsicherheit auf die Gesellschaft und die Individuen.
- Wandel des Normalarbeitsverhältnisses und Aufstieg des Prekariats
- Herausforderungen für die Tarifautonomie
- Auswirkungen von Billiglöhnen und atypischen Beschäftigungsverhältnissen
- Soziale Ungleichheit und ihre Folgen
- Rolle des Sozialstaates und politische Handlungsoptionen
Zusammenfassung der Kapitel
Dem Sozialstaat können und dürfen Funktionsdefizite der Tarifautonomie nicht gleichgültig sein.: Dieses Kapitel beleuchtet die enge Verknüpfung zwischen Tarifautonomie und Sozialstaat. Es argumentiert, dass der Sozialstaat nicht untätig bleiben darf, wenn die Tarifautonomie Funktionsdefizite aufweist. Gesetzgeber und Gerichte sind aufgefordert, die rechtlichen Rahmenbedingungen anzupassen und Fehlerquellen zu beseitigen, um die soziale Sicherheit der Arbeitnehmer zu gewährleisten. Die Debatte um den Mindestlohn wird als Beispiel für die Notwendigkeit solcher Anpassungen angeführt.
Normalarbeitsverhältnis oder Prekariat: Dieser Abschnitt stellt die zentrale Frage nach dem zukünftigen Arbeitsmarktmodell in Deutschland. Er analysiert den Übergang vom traditionellen Normalarbeitsverhältnis hin zu prekären Beschäftigungsverhältnissen. Die Arbeit beschreibt die neuen Beschäftigungsformen als Ergebnis sowohl berechtigter Flexibilisierungsbedürfnisse der Unternehmen als auch wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Veränderungen. Die daraus resultierenden Schutzlücken und die zunehmende soziale Ungleichheit werden kritisch beleuchtet.
Die demographischen und ökonomischen Rahmenbedingungen in Deutschland ändern sich bis 2030 grundlegend.: Das Kapitel skizziert die grundlegenden demografischen und ökonomischen Veränderungen in Deutschland bis 2030. Es betont die Notwendigkeit von Zukunftsforschung, um zukünftigen Generationen Zukunftsperspektiven zu eröffnen und Risiken zu minimieren sowie Chancen zu nutzen. Die unzureichende sozialrechtliche Vorsorge wird als ein zentrales Problem identifiziert, das eine massive steuerfinanzierte Aufstockung der Sozialversicherungsetats erfordert.
Die Arbeitswelt ist einem radikalen Wandel unterworfen.: Dieses Kapitel beschreibt den tiefgreifenden Wandel in der Arbeitswelt, den Tod des Normalarbeitsverhältnisses und die zunehmende Verbreitung von Gelegenheitsarbeit und Teilzeitbeschäftigung. Der Verlust an Arbeitsplatzsicherheit und die damit verbundenen Risiken für die Arbeitnehmer werden detailliert analysiert. Die Arbeit hebt die Notwendigkeit hervor, neue Modelle von Arbeitsbeziehungen zu entwickeln, um die Herausforderungen des Wandels zu bewältigen.
Die Billiglöhne von heute führen zu einer niedrigen Grundsicherung im Alter.: Hier wird der Zusammenhang zwischen niedrigen Löhnen und unzureichender Altersvorsorge beleuchtet. Die Arbeit argumentiert, dass Billiglöhne nicht nur den Einzelnen betreffen, sondern auch der gesamten Gesellschaft schaden, da sie zu einer höheren Belastung der Sozialsysteme führen. Die Aufstockung von Billiglöhnen durch Hartz IV wird als verfehlter Anreiz kritisiert. Das Kapitel veranschaulicht die langfristigen negativen Auswirkungen von niedrigen Löhnen anhand von konkreten Beispielen.
Die Tarifautonomie ist von zentraler Bedeutung für unser Arbeits- und Wirtschaftsleben.: Das Kapitel betont die zentrale Rolle der Tarifautonomie für die soziale Marktwirtschaft und den sozialen Frieden in Deutschland. Es beschreibt die bisherigen Erfolge der Tarifautonomie, weist aber gleichzeitig auf die Risse hin, die in den letzten Jahren entstanden sind. Die Arbeit betont die Notwendigkeit, die Tarifautonomie zu stärken und an die neuen Herausforderungen anzupassen. Der Wert der Arbeit und ihre gerechte Entlohnung sind zentrale Themen dieses Kapitels.
Normalarbeitsverhältnis oder Prekariat: (Wiederholung, kann bei Bedarf entfernt werden, da der Inhalt bereits im vorherigen Abschnitt zusammengefasst wurde.)
Prekär Beschäftigte sind nach der Internationalen Arbeitsorganisation diejenigen, die nur „partiell im arbeitsrechtlichen Schutzkreis stehen“.: Dieses Kapitel definiert den Begriff „Prekariat“ und beleuchtet die damit verbundenen sozialen Ungleichheiten. Es werden die Ursachen für die Ausbreitung prekären Beschäftigungsverhältnissen analysiert, und die negativen Auswirkungen auf die betroffenen Personen sowie auf die Gesellschaft als Ganzes werden dargestellt. Der Verlust an Sicherheit und die damit verbundene soziale Exklusion werden als zentrale Probleme herausgestellt.
Der 68. Deutsche Juristentag fasste den Beschluss gegen eine Lockerung des Kündigungsschutzes.: Das Kapitel berichtet über die Positionen des 68. Deutschen Juristentages zu wichtigen arbeitsrechtlichen Fragen. Der Widerstand gegen eine Lockerung des Kündigungsschutzes und die Forderung nach einem gesetzlichen Mindestlohn werden hervorgehoben. Die Ablehnung der Ausweitung von Minijobs und die Kritik an der Privilegierung von 400-Euro-Jobs zeigen die Positionierung der Juristen in der Debatte um Arbeitsbedingungen und soziale Gerechtigkeit.
Der Umbruch der Arbeitswelt ist seit der Sozialenzyklika "Rerum novarum", dem Gründungsdokument der Katholischen Soziallehre, zentrales Thema kirchlicher Lehrverkündung.: Das Kapitel beleuchtet die katholische Soziallehre im Kontext des Umbruchs der Arbeitswelt. Die Entwicklung von prekären Arbeitsverhältnissen wird als "Metamorphose der sozialen Frage" betrachtet. Die Arbeit diskutiert zentrale Dokumente der kirchlichen Soziallehre und ihre anthropologischen und ethisch-politischen Positionen zur Arbeit und zur Gerechtigkeit. Die Bedeutung der Würde der Arbeit und die Notwendigkeit einer ausgewogenen Balance zwischen Effizienz und humaner Ausgestaltung der Arbeit werden hervorgehoben.
Schlüsselwörter
Tarifautonomie, Normalarbeitsverhältnis, Prekariat, Billiglöhne, atypische Beschäftigung, soziale Ungleichheit, Mindestlohn, Arbeitsmarkt, Sozialstaat, Zukunftsfähigkeit, Erwerbsunsicherheit, Soziale Sicherheit, Arbeitsrecht, Katholische Soziallehre.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Wandel der Arbeitswelt und Herausforderungen für Tarifautonomie und Sozialstaat
Was ist das zentrale Thema dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht den Wandel der deutschen Arbeitswelt, insbesondere den Übergang vom Normalarbeitsverhältnis hin zum Prekariat, und die damit verbundenen Herausforderungen für die Tarifautonomie und den Sozialstaat. Sie analysiert die Auswirkungen von Billiglöhnen, atypischen Beschäftigungsverhältnissen und der zunehmenden Erwerbsunsicherheit.
Welche Aspekte des Wandels der Arbeitswelt werden behandelt?
Die Arbeit beleuchtet den Aufstieg des Prekariats, die Herausforderungen für die Tarifautonomie, die Auswirkungen von Billiglöhnen und atypischen Beschäftigungsverhältnissen, soziale Ungleichheit und ihre Folgen, sowie die Rolle des Sozialstaates und politische Handlungsoptionen. Die demografischen und ökonomischen Rahmenbedingungen bis 2030 und der tiefgreifende Wandel der Arbeitswelt mit dem Verlust von Arbeitsplatzsicherheit werden ebenfalls thematisiert.
Wie wird der Zusammenhang zwischen Billiglöhnen und Altersvorsorge dargestellt?
Die Arbeit zeigt den negativen Zusammenhang zwischen niedrigen Löhnen und unzureichender Altersvorsorge auf. Billiglöhne belasten die Sozialsysteme und führen zu einer niedrigen Grundsicherung im Alter. Die Aufstockung von Billiglöhnen durch Hartz IV wird als ineffektiver Anreiz kritisiert.
Welche Rolle spielt die Tarifautonomie?
Die Tarifautonomie wird als zentral für die soziale Marktwirtschaft und den sozialen Frieden in Deutschland betrachtet. Die Arbeit weist auf Risse in der Tarifautonomie hin und betont die Notwendigkeit, sie zu stärken und an neue Herausforderungen anzupassen. Der Wert der Arbeit und ihre gerechte Entlohnung sind zentrale Themen.
Wie wird der Begriff "Prekariat" definiert?
Prekär Beschäftigte werden nach der Internationalen Arbeitsorganisation als diejenigen definiert, die nur „partiell im arbeitsrechtlichen Schutzkreis stehen“. Die Arbeit analysiert die Ursachen für die Ausbreitung prekären Beschäftigungsverhältnissen und deren negative Auswirkungen auf die Betroffenen und die Gesellschaft.
Welche Position vertritt der 68. Deutsche Juristentag?
Der 68. Deutsche Juristentag sprach sich gegen eine Lockerung des Kündigungsschutzes aus und forderte einen gesetzlichen Mindestlohn. Er lehnte die Ausweitung von Minijobs und die Privilegierung von 400-Euro-Jobs ab.
Welche Rolle spielt die Katholische Soziallehre?
Die Arbeit beleuchtet die katholische Soziallehre im Kontext des Umbruchs der Arbeitswelt. Die Entwicklung prekären Beschäftigungsverhältnissen wird als "Metamorphose der sozialen Frage" betrachtet. Die Würde der Arbeit und die Notwendigkeit einer ausgewogenen Balance zwischen Effizienz und humaner Ausgestaltung der Arbeit werden hervorgehoben.
Wie wird die Beziehung zwischen Sozialstaat und Tarifautonomie dargestellt?
Die Arbeit betont die enge Verknüpfung zwischen Tarifautonomie und Sozialstaat. Der Sozialstaat darf Funktionsdefizite der Tarifautonomie nicht ignorieren, sondern muss die rechtlichen Rahmenbedingungen anpassen und Fehlerquellen beseitigen, um die soziale Sicherheit der Arbeitnehmer zu gewährleisten.
Welche Kapitel beinhaltet die Arbeit?
Die Arbeit enthält Kapitel zu den Themen: Funktionsdefizite der Tarifautonomie und ihre Bedeutung für den Sozialstaat; Normalarbeitsverhältnis vs. Prekariat; demografische und ökonomische Rahmenbedingungen bis 2030; der radikale Wandel der Arbeitswelt; die Folgen von Billiglöhnen; die zentrale Rolle der Tarifautonomie; Definition und Auswirkungen des Prekariats; die Position des 68. Deutschen Juristentages; und die Perspektive der Katholischen Soziallehre.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Tarifautonomie, Normalarbeitsverhältnis, Prekariat, Billiglöhne, atypische Beschäftigung, soziale Ungleichheit, Mindestlohn, Arbeitsmarkt, Sozialstaat, Zukunftsfähigkeit, Erwerbsunsicherheit, Soziale Sicherheit, Arbeitsrecht, Katholische Soziallehre.
Details
- Titel
- Normalarbeitsverhältnis oder Prekariat
- Untertitel
- Der gesetzliche Mindestlohn als sozialer Fortschritt oder als Sargnagel der Tarifautonomie?
- Hochschule
- Duale Hochschule Baden-Württemberg Mannheim, früher: Berufsakademie Mannheim (Forschungsinstitut FOI)
- Note
- 1,0
- Autor
- Prof. Dr. Dr. Assessor jur., Mag. rer. publ. Siegfried Schwab (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2014
- Seiten
- 136
- Katalognummer
- V281730
- ISBN (Buch)
- 9783656759812
- ISBN (eBook)
- 9783656759829
- Dateigröße
- 1389 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Tarifautonomie Koalitionsfreiheit prekäre Arbeitsverhältnisse Menschenwürdiger Lohn Menschenwürde Arbeitsrecht Sozialpartnerschaft Assoziative Selbsthilfe Innovationen Industrie 4.0 Stress am Arbeitsplatz Befristung von Arbeitsverhältnissen Europarechtliche Grenzen der Kettenbefristung Mindestlohn Tarifeinheit Normalarbeitsverhältnis Atypisches Arbeitsverhältnis Prekariat Sozialstaat
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 38,99
- Preis (Book)
- US$ 49,99
- Arbeit zitieren
- Prof. Dr. Dr. Assessor jur., Mag. rer. publ. Siegfried Schwab (Autor:in), 2014, Normalarbeitsverhältnis oder Prekariat, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/281730
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-