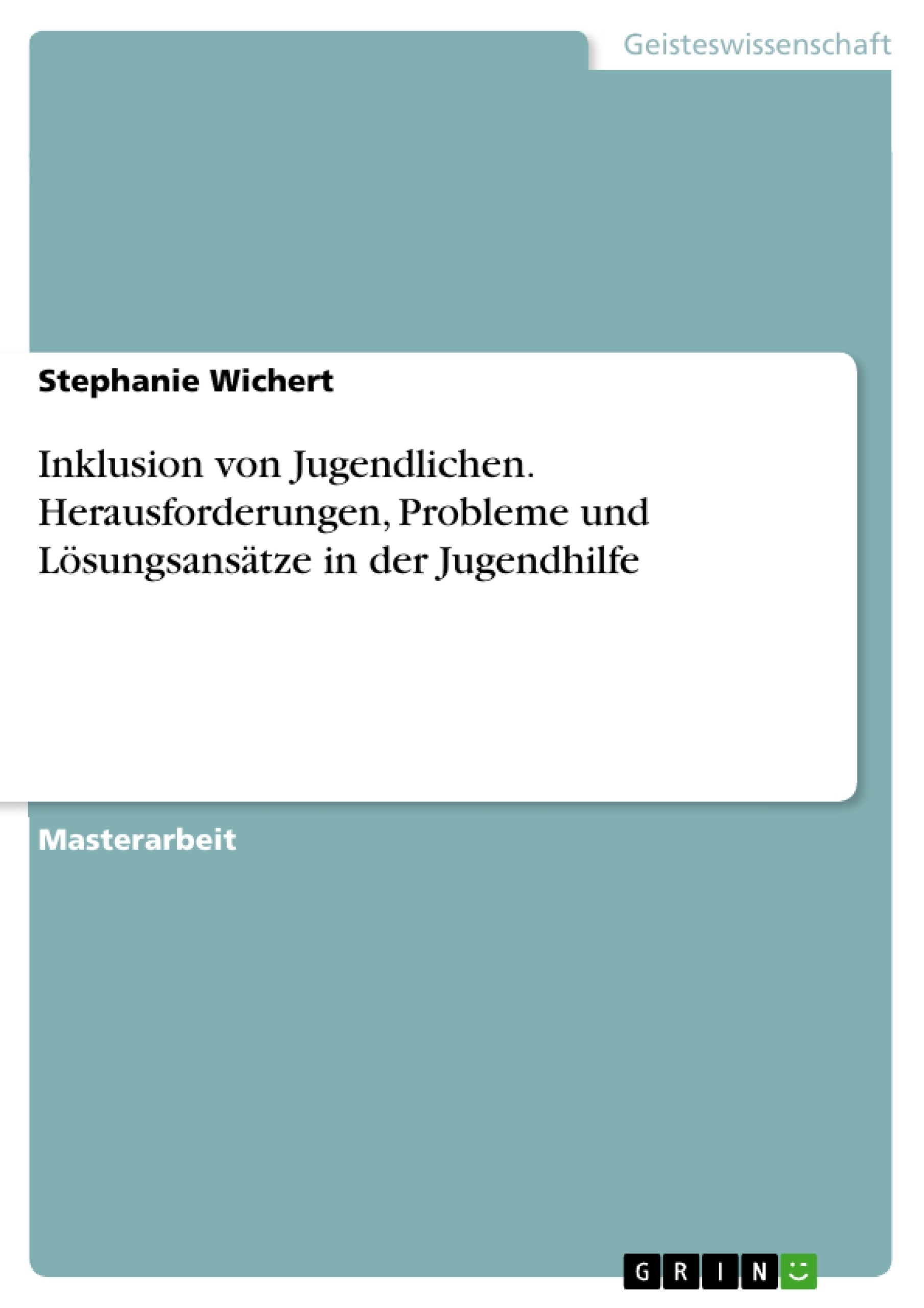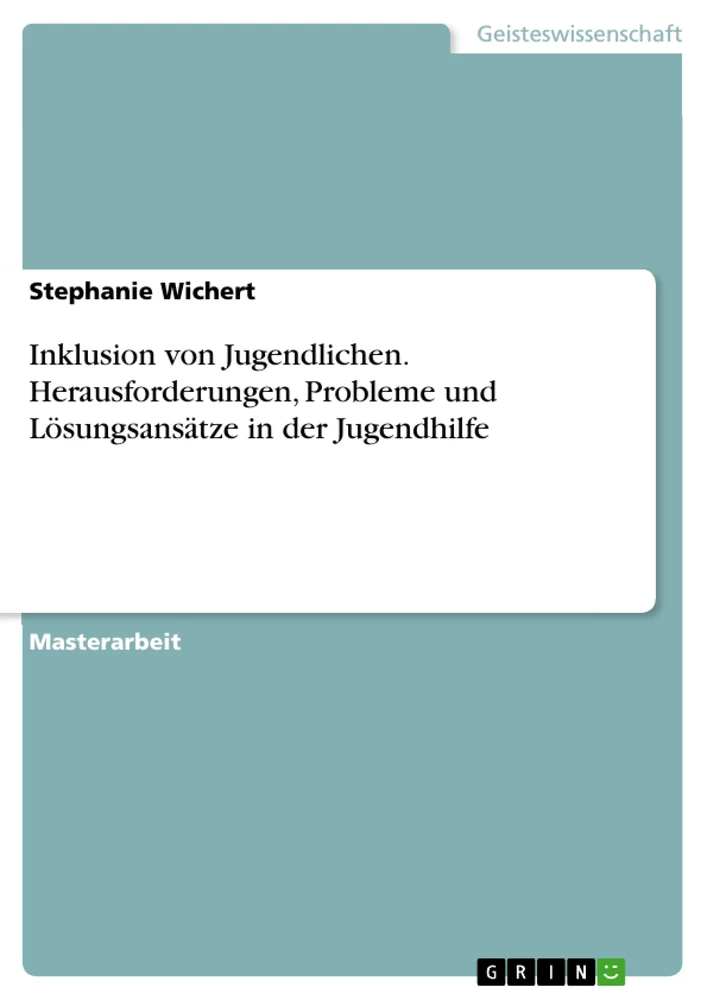
Inklusion von Jugendlichen. Herausforderungen, Probleme und Lösungsansätze in der Jugendhilfe
Masterarbeit, 2012
128 Seiten, Note: 1,3
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Inklusion
- Bedeutung des Begriffs Inklusion
- Abgrenzung zum Begriff Integration
- Entstehungskontext von Inklusion
- Rechtliche Grundlagen zum Inklusionsgedanken
- Zwischenfazit
- Inklusion als Aufgabe der Jugendhilfe
- Aufgabe der Jugendhilfe
- Inklusion im Rahmen der Jugendhilfe
- Lösungsansätze für das Jugendhilfesystem
- Zwischenfazit
- Inklusion in den Handlungsfeldern der Jugendhilfe
- Inklusion im Rahmen von Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit
- Index für Inklusion
- Kritische Stimmen zur Inklusionsdebatte
- Zwischenfazit
- Methoden
- Forschungsparadigmen
- Forschungsmethoden
- ExpertInneninterview nach Meuser und Nagel
- ExpertInnenbefragung zur Umsetzung von Inklusion in der Jugendhilfe
- Vorstellung der Experten
- Auswertung der ExpertInneninterviews
- Darstellung der Ergebnisse
- Fazit
- Literaturverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
- Tabellenverzeichnis
- Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Masterarbeit befasst sich mit der Inklusion von Jugendlichen im Kontext der Jugendhilfe. Ziel ist es, die Herausforderungen und Probleme bei der Umsetzung inklusiver Strukturen in der Jugendhilfe zu analysieren und mögliche Lösungsansätze aufzuzeigen. Die Arbeit fokussiert dabei auf die Handlungsfelder Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit.
- Bedeutung und Abgrenzung des Begriffs Inklusion
- Rechtliche Grundlagen und Entstehungskontext von Inklusion
- Inklusion als Aufgabe der Jugendhilfe und Herausforderungen bei der Umsetzung
- Lösungsansätze für die Inklusion in der Jugendhilfe
- Praxisbezogene Beispiele für Inklusion in der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema Inklusion in der Jugendhilfe ein und stellt die Relevanz des Themas dar. Sie beleuchtet die aktuelle Debatte um Inklusion und deren Fokus auf die schulische Inklusion, während die Inklusion in anderen gesellschaftlichen Bereichen, insbesondere in der Jugendhilfe, kaum Beachtung findet. Die Einleitung verdeutlicht die Notwendigkeit, Inklusion im Rahmen der Jugendhilfe zu betrachten, da das System die Eingliederung von jungen Menschen entscheidend beeinflusst.
Das zweite Kapitel befasst sich mit dem Begriff Inklusion. Es erläutert die Bedeutung des Begriffs und grenzt ihn vom Begriff Integration ab. Der Entstehungskontext des Inklusionsparadigmas wird beleuchtet und die rechtliche Grundlage mit der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung vorgestellt. Das Kapitel schließt mit einem Zwischenfazit, das die zentralen Erkenntnisse und Fakten zusammenfasst.
Das dritte Kapitel widmet sich der Inklusion als Aufgabe der Jugendhilfe. Es beschreibt das Aufgabenfeld der Jugendhilfe und beleuchtet die aktuelle Situation im Bereich der Jugendhilfe in Bezug auf Inklusion. Die Herausforderungen und Probleme bei der Umsetzung inklusiver Strukturen in diesem System werden herausgearbeitet. Anschließend werden aktuelle Lösungsmodelle vorgestellt, die zur Bewältigung der dargestellten Herausforderungen und Probleme in aktuellen Debatten herangezogen werden.
Das vierte Kapitel befasst sich mit der Inklusion in den Praxisfeldern der Jugendhilfe. Es stellt Maßnahmen vor, welche Inklusion in den Bereichen Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit fördern sollen. Der Index für Inklusion wird als Instrument zur Förderung inklusiver Strukturen exemplarisch vorgestellt. Das Kapitel schließt mit einer Zusammenfassung kritischer Aspekte und Haltungen gegenüber der Umsetzungsplanung von Inklusion im Jugendhilfesystem als auch im Bereich der praktischen Umsetzung in den Handlungsfeldern der Jugendhilfe.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Inklusion, Jugendhilfe, Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Herausforderungen, Probleme, Lösungsansätze, Integration, UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung, ExpertInneninterviews, empirische Forschung, qualitative Forschung, Index für Inklusion, kritische Stimmen.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet Inklusion im Kontext der Jugendhilfe?
Inklusion bedeutet, dass alle Jugendlichen, unabhängig von Behinderungen oder individuellen Merkmalen, als Teil der Vielfalt akzeptiert und in alle Angebote der Jugendhilfe einbezogen werden.
Wie unterscheidet sich Inklusion von Integration?
Integration zielt darauf ab, Minderheiten in eine bestehende Mehrheitsgesellschaft einzugliedern. Inklusion sieht Heterogenität als Norm und passt das System an die Individuen an.
Welche rechtliche Grundlage verpflichtet Deutschland zur Inklusion?
Die wichtigste Grundlage ist die Ratifizierung der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung, die Inklusion auf allen gesellschaftlichen Ebenen fordert.
Was ist der „Index für Inklusion“?
Der Index ist ein Instrument und Leitfaden, der Einrichtungen der Jugendarbeit hilft, Barrieren abzubauen und inklusive Strukturen in der Praxis zu etablieren.
Was ergaben die ExpertInneninterviews zur Umsetzung der Inklusion?
Die Interviews zeigen Herausforderungen wie mangelnde Ressourcen, strukturelle Hürden im Jugendhilfesystem und die Notwendigkeit einer veränderten Haltung der pädagogischen Fachkräfte auf.
Details
- Titel
- Inklusion von Jugendlichen. Herausforderungen, Probleme und Lösungsansätze in der Jugendhilfe
- Hochschule
- Universität Münster (Institut für Erziehungswissenschaft)
- Note
- 1,3
- Autor
- Stephanie Wichert (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2012
- Seiten
- 128
- Katalognummer
- V284278
- ISBN (eBook)
- 9783656845911
- ISBN (Buch)
- 9783656845928
- Dateigröße
- 996 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Inklusion Jugendhilfe Integration Behindertenrechtskonvention Index für Inklusion Große Lösung KJHG
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 40,99
- Preis (Book)
- US$ 51,99
- Arbeit zitieren
- Stephanie Wichert (Autor:in), 2012, Inklusion von Jugendlichen. Herausforderungen, Probleme und Lösungsansätze in der Jugendhilfe, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/284278
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-