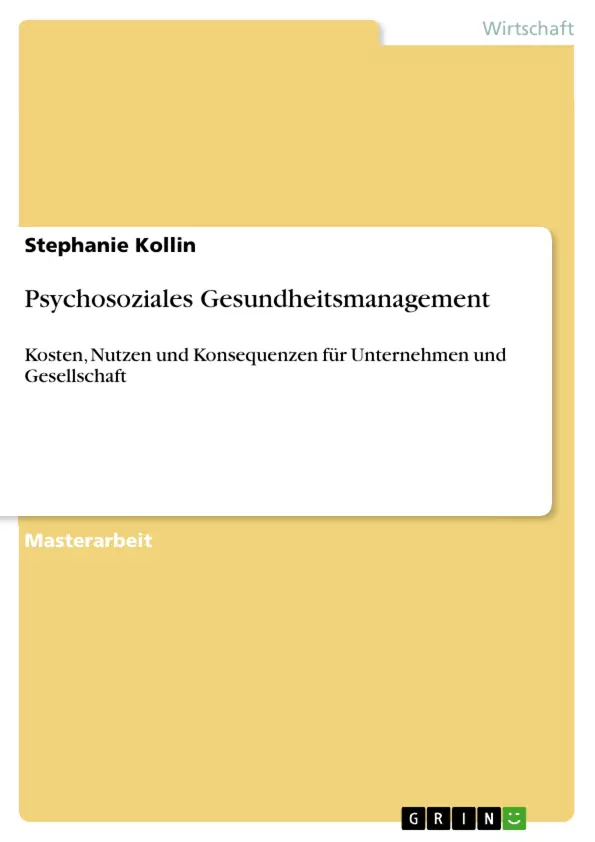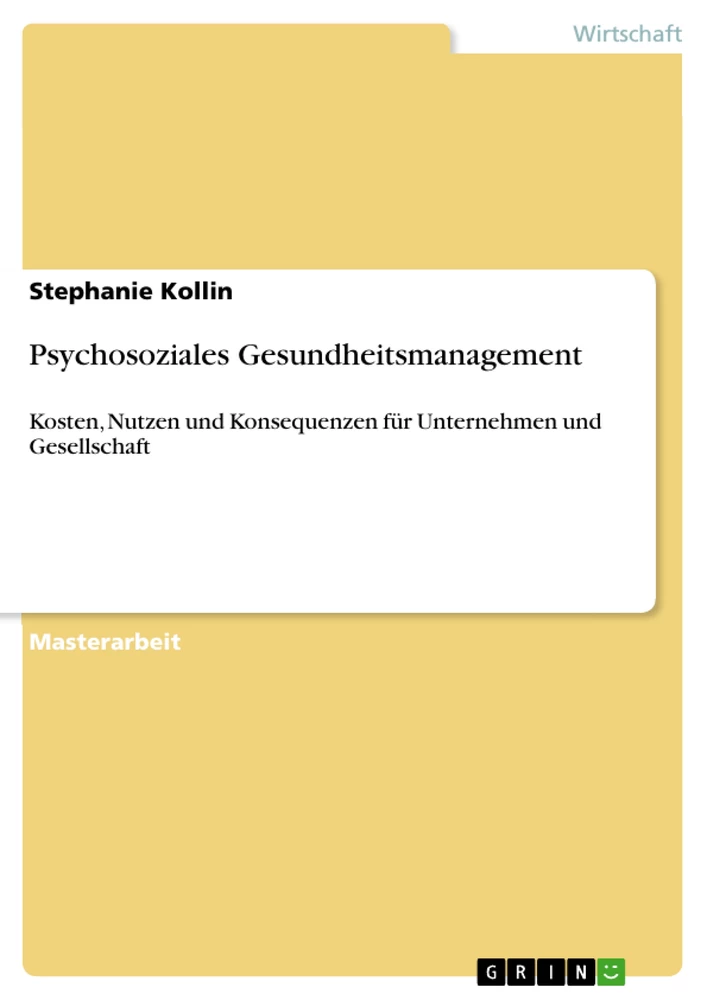
Psychosoziales Gesundheitsmanagement
Masterarbeit, 2014
81 Seiten, Note: 2
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Problemstellung
- Zielsetzung
- Zentrale Fragestellung
- Aufbau der Arbeit
- Betriebliches Gesundheitsmanagement
- Entwicklung des Betrieblichen Gesundheitsmanagements
- Von der industriellen Fertigung zur Dienstleistungsgesellschaft
- Modernes betriebliches Gesundheitsmanagement
- Begrifflichkeiten im betrieblichen Gesundheitsmanagement
- Verhaltens- und Verhältnisorientierung
- Absentismus - Präsentismus
- Entwicklung des Betrieblichen Gesundheitsmanagements
- Neurobiologie in der Arbeitswelt
- Grundlagen
- Einleitung
- Botenstoffe - Hormone
- Anatomie
- Spiegelneurone
- Das soziale Gehirn
- Kooperation
- Lernen
- Grundlagen
- Gesundheit - Krankheit
- Definition Gesundheit
- Definition WHO
- Ottawa Charta
- Jakarta Charta
- Salutogenese
- Exemplarische Krankheitsbilder
- Stress
- Burnout - Syndrom
- Boreout
- Depression
- Psychosomatische Erkrankungen
- Suchterkrankungen
- Definition Gesundheit
- Psychosoziales Gesundheitsmanagement in der Praxis
- Einflussfaktoren auf die psychosoziale Gesundheit
- Belastung – Beanspruchung - Erholung
- Gesunde Führung und Unternehmenskultur – unabdingbare Bedingung?
- Mitarbeiterzufriedenheit – Gesundheit: Widerspruch oder
- Daten und Analysen
- Krankheitsbedingte Fehlzeiten bei psychischen Erkrankungen
- Kosten für Unternehmen und Volkswirtschaft
- Nutzen und Grenzen
- Beispiel aus der Praxis
- Gesundheitsmanagement Zürich Versicherung Österreich
- Einflussfaktoren auf die psychosoziale Gesundheit
- Zusammenfassung und Ausblick
- Zukunft und Fazit
- Zukünftige Wege im Betrieblichen Gesundheitsmanagement
- Fazit – Nachwort
- Zukunft und Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Masterarbeit befasst sich mit dem Thema des psychosozialen Gesundheitsmanagements in Unternehmen und der Gesellschaft. Sie analysiert die Kosten, den Nutzen und die Konsequenzen dieses Ansatzes. Die Arbeit beleuchtet die Entwicklung des Betrieblichen Gesundheitsmanagements sowie wichtige Begrifflichkeiten und untersucht die Bedeutung der Neurobiologie in der Arbeitswelt. Zudem werden verschiedene Krankheitsbilder im Kontext von psychosozialer Gesundheit beleuchtet.
- Entwicklung und Bedeutung des Betrieblichen Gesundheitsmanagements
- Kosten und Nutzen von psychosozialem Gesundheitsmanagement
- Neurobiologische Aspekte von psychosozialer Gesundheit am Arbeitsplatz
- Einflussfaktoren auf psychosoziale Gesundheit in Unternehmen
- Relevanz von psychosozialem Gesundheitsmanagement für Unternehmen und Gesellschaft
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Problemstellung des psychosozialen Gesundheitsmanagements in Unternehmen dar. Sie beleuchtet den Zusammenhang zwischen Gesundheit und Krankheit und die Auswirkungen auf die Gesellschaft. Zudem wird die Zielsetzung der Arbeit und die zentrale Fragestellung definiert.
- Betriebliches Gesundheitsmanagement: Dieses Kapitel beleuchtet die historische Entwicklung des Betrieblichen Gesundheitsmanagements und wichtige Begrifflichkeiten wie Verhaltens- und Verhältnisorientierung sowie Absentismus und Präsentismus.
- Neurobiologie in der Arbeitswelt: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit den Grundlagen der Neurobiologie und deren Relevanz für die Arbeitswelt. Es werden wichtige Themen wie Botenstoffe, Hormone, Anatomie des Gehirns und Spiegelneurone behandelt.
- Gesundheit - Krankheit: Dieses Kapitel definiert den Begriff der Gesundheit, basierend auf verschiedenen Definitionen, und beleuchtet exemplarische Krankheitsbilder wie Stress, Burnout, Boreout, Depression, psychosomatische Erkrankungen und Suchterkrankungen.
- Psychosoziales Gesundheitsmanagement in der Praxis: Dieses Kapitel analysiert die Einflussfaktoren auf die psychosoziale Gesundheit in Unternehmen, beleuchtet Daten und Analysen zum Thema und präsentiert ein Beispiel aus der Praxis.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit zentralen Themen wie psychosoziales Gesundheitsmanagement, Betriebliches Gesundheitsmanagement, Neurobiologie, Stress, Burnout, Boreout, Depression, psychosomatische Erkrankungen, Kosten, Nutzen, Unternehmenskultur, Mitarbeiterzufriedenheit, Gesundheit, Krankheit und Gesellschaft.
Häufig gestellte Fragen
Warum steigt die Bedeutung von psychosozialem Gesundheitsmanagement?
Massiv steigende Krankenstände und Frühpensionierungen aufgrund psychischer Erkrankungen stellen Unternehmen und das Sozialsystem vor enorme finanzielle Herausforderungen.
Was ist der Unterschied zwischen Absentismus und Präsentismus?
Absentismus beschreibt das krankheitsbedingte Fernbleiben vom Arbeitsplatz, während Präsentismus bedeutet, trotz Krankheit zu arbeiten, was oft zu höheren Folgekosten führt.
Welche Rolle spielt die Neurobiologie am Arbeitsplatz?
Die Arbeit untersucht, wie Botenstoffe, Hormone und Spiegelneurone Kooperation und Lernen beeinflussen und wie Stressmuster neurobiologisch im Gehirn verankert sind.
Was sind typische Krankheitsbilder bei psychischer Überlastung?
Behandelt werden Stress, Burnout-Syndrom, Boreout (Unterforderung), Depressionen sowie psychosomatische Erkrankungen.
Wie beeinflusst Führung die psychosoziale Gesundheit?
„Gesunde Führung“ und eine positive Unternehmenskultur sind unabdingbare Bedingungen, um Belastungen zu minimieren und die Mitarbeiterzufriedenheit zu fördern.
Details
- Titel
- Psychosoziales Gesundheitsmanagement
- Untertitel
- Kosten, Nutzen und Konsequenzen für Unternehmen und Gesellschaft
- Hochschule
- Alpen-Adria-Universität Klagenfurt (MOT Klagenfurt)
- Note
- 2
- Autor
- Stephanie Kollin (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2014
- Seiten
- 81
- Katalognummer
- V284744
- ISBN (eBook)
- 9783656844334
- ISBN (Buch)
- 9783656844341
- Dateigröße
- 10118 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- psychosoziales gesundheitsmanagement kosten nutzen konsequenzen unternehmen gesellschaft
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 39,99
- Preis (Book)
- US$ 50,99
- Arbeit zitieren
- Stephanie Kollin (Autor:in), 2014, Psychosoziales Gesundheitsmanagement, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/284744
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-