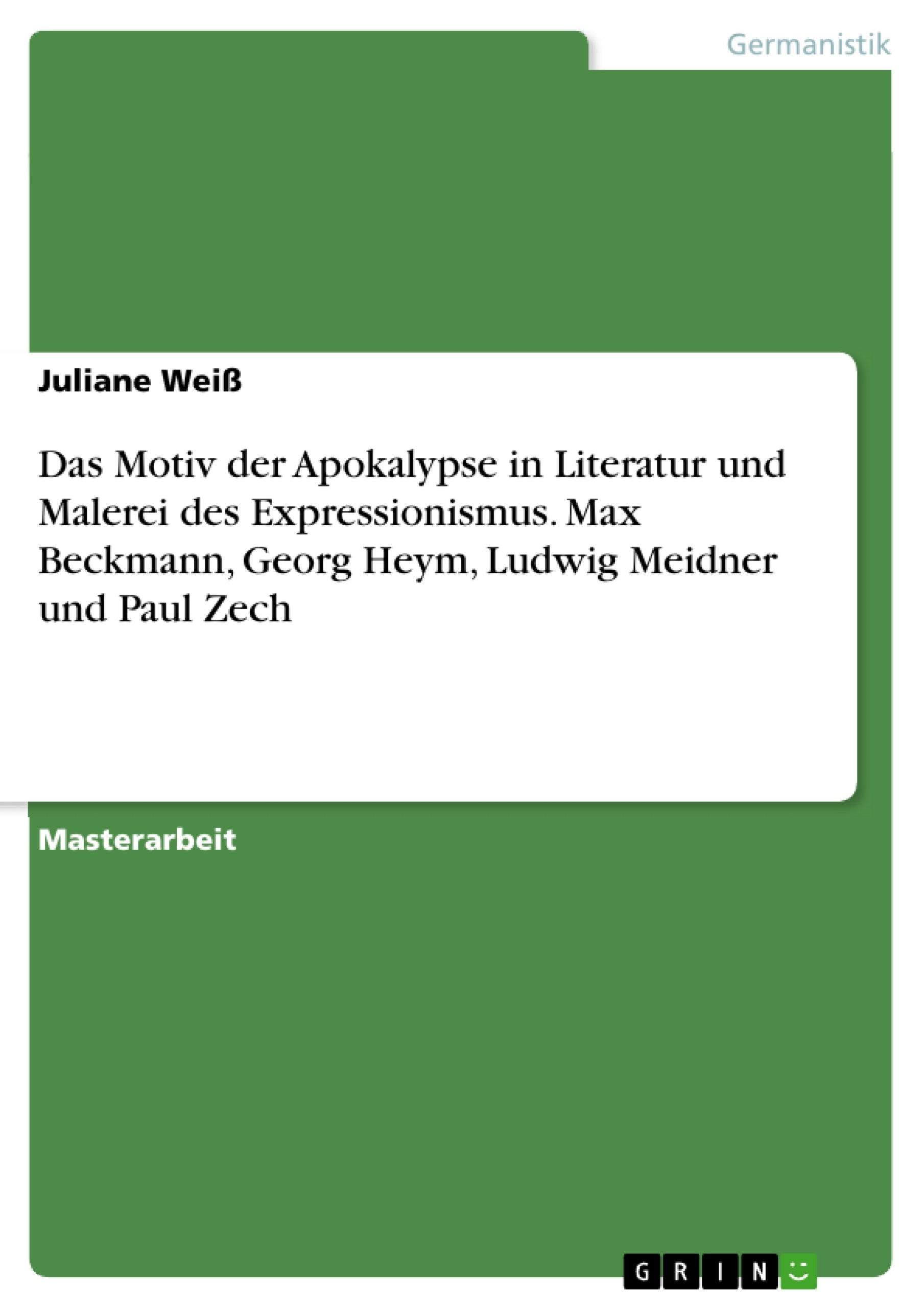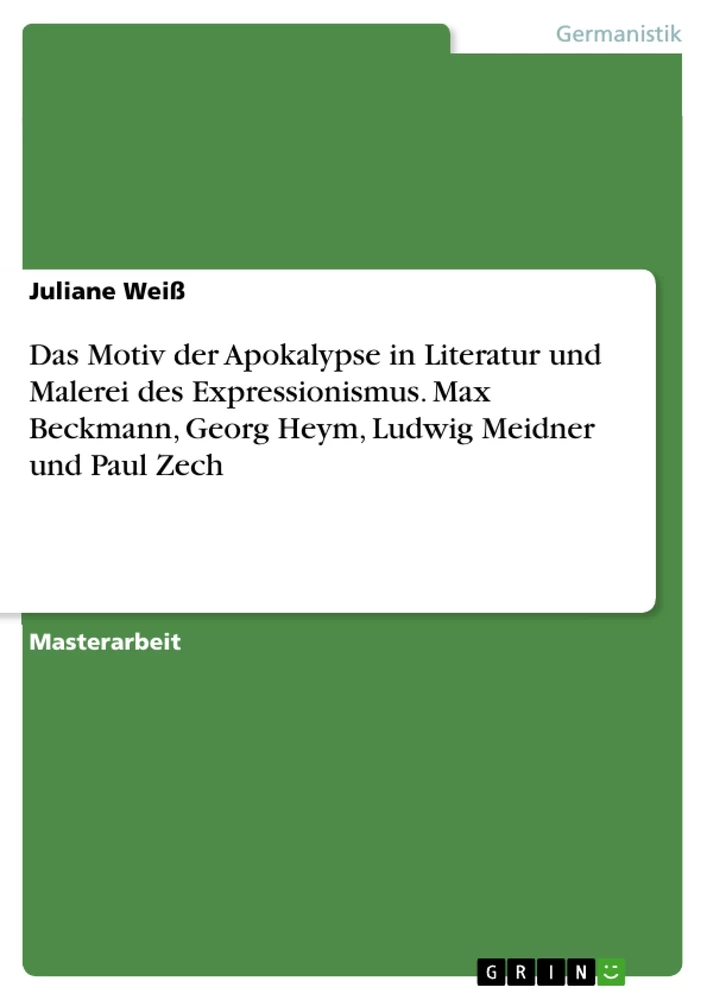
Das Motiv der Apokalypse in Literatur und Malerei des Expressionismus. Max Beckmann, Georg Heym, Ludwig Meidner und Paul Zech
Masterarbeit, 2014
96 Seiten, Note: 1,6
Germanistik - Komparatistik, Vergleichende Literaturwissenschaft
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Hintergründe zur Disziplin des Künstevergleichs
- 2.1 Legitimierung und Problematik der Disziplin
- 2.2 Die besondere Eignung der expressionistischen Kunst als Grundlage für den Vergleich der Künste
- 2.3 Das Motiv als tertium comparationis im Künstevergleich
- 3. Das Motiv der Apokalypse
- 3.1 Ursprünge des Motivs
- 3.2 Die Verwendung des Apokalypse-Motivs in Literatur und Malerei
- 4. Der Expressionismus in Malerei und Literatur
- 4.1 Inhalte der expressionistischen Kunst
- 4.2 Gründe für das häufige Auftreten des Apokalypse-Motivs in der expressionistischen Kunst
- 4.3 Neue Ausdrucksmittel in Bildender Kunst und Lyrik
- 4.3.1 Bildende Kunst
- 4.3.2 Lyrik
- 4.3.3 Stilistische Gemeinsamkeiten in Malerei und Lyrik des Expressionismus
- 5. Georg Heym
- 5.1 Zur Dichtung und Weltanschauung Georg Heyms
- 5.2 Interpretationsansatz zu Georg Heyms Gedicht Umbra Vitae
- 6. Ludwig Meidner
- 6.1 Ludwig Meidner als Expressionist
- 6.2 Analyse des Bildes Apokalyptische Landschaft (1916)
- 7. Das Motiv der Apokalypse bei Georg Heym und Ludwig Meidner im Vergleich
- 7.1 Inhaltlicher Vergleich
- 7.1.1 Die Figuren der Apokalypse
- 7.1.2 Der apokalyptische Raum
- 7.2 Darstellungsweise des Apokalypse-Motivs in Gedicht und Bild
- 7.2.1 Die Perspektive
- 7.2.2 Die Farbsymbolik
- 7.2.3 Das Groteske als Stilmittel
- 7.3 Vergleichende Betrachtung der Funktion des Apokalypse-Motivs bei Georg Heym und Ludwig Meidner
- 7.1 Inhaltlicher Vergleich
- 8. Paul Zech
- 8.1 Anmerkung zur Lyrik Paul Zechs
- 8.2 Interpretationsansatz zu dem Gedicht Die neue Bergpredigt von Paul Zech
- 9. Max Beckmann
- 9.1 Max Beckmanns Weg zur Auferstehung (1918)
- 9.2 Analyse des Bildes Auferstehung (1918)
- 10. Das Motiv der Apokalypse bei Paul Zech und Max Beckmann im Vergleich
- 10.1 Inhaltlicher Vergleich
- 10.1.1 Die Figuren der Apokalypse
- 10.1.2 Der apokalyptische Raum
- 10.2 Darstellungsweise des Apokalypse-Motivs in Gedicht und Bild
- 10.2.1 Die Perspektive
- 10.2.2 Die Farbsymbolik
- 10.2.3 Das Groteske als Stilmittel
- 10.3 Vergleichende Betrachtung der Funktion des Apokalypse-Motivs bei Paul Zech und Max Beckmann
- 10.1 Inhaltlicher Vergleich
- 11. Abschließender Vergleich der vier Werke hinsichtlich des Apokalypse-Motivs
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Funktion und Verwendung des Apokalypse-Motivs in ausgewählten Werken des Expressionismus, vergleicht literarische und malerische Darstellungen und trägt somit zum Feld des Künstevergleichs bei. Ziel ist es aufzuzeigen, wie das Motiv in verschiedenen Medien eingesetzt wird und welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede sich dabei ergeben.
- Der Künstevergleich als Disziplin und Methodik
- Das Apokalypse-Motiv in seiner historischen und kulturellen Bedeutung
- Analyse des Apokalypse-Motivs im Expressionismus
- Vergleichende Betrachtung der Darstellungsweisen in Literatur und Malerei
- Die Funktion des Motivs in den ausgewählten Werken
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und erläutert die Relevanz des Apokalypse-Motivs in der Kunstgeschichte, insbesondere im Expressionismus. Sie beschreibt die Zielsetzung der Arbeit, den Vergleich literarischer und malerischer Werke anhand des Apokalypse-Motivs, um eine wechselseitige Erhellung der Künste zu erreichen. Die Arbeit wird als Beitrag zum Künstevergleich positioniert und skizziert die gewählte Methodik.
2. Hintergründe zur Disziplin des Künstevergleichs: Dieses Kapitel beleuchtet die Disziplin des Künstevergleichs, ihre Legitimität und die Herausforderungen, die sich aus der noch relativ jungen und unerforschten Natur dieser Disziplin ergeben. Es wird begründet, warum der Expressionismus sich besonders für einen solchen Vergleich eignet, und der Begriff des Motivs als "tertium comparationis" eingeführt.
3. Das Motiv der Apokalypse: Kapitel 3 befasst sich mit dem Motiv der Apokalypse selbst. Zunächst werden die Ursprünge des Motivs, insbesondere die biblischen Wurzeln, untersucht. Anschließend wird die Verwendung des Apokalypse-Motivs in Literatur und Malerei in seiner Verbreitung und Funktion im Laufe der Kunstgeschichte beleuchtet.
4. Der Expressionismus in Malerei und Literatur: Hier wird der Expressionismus als künstlerische Epoche vorgestellt, mit Fokus auf die Inhalte und die besonderen Ausdrucksmittel in der Malerei und Lyrik. Gesellschaftliche Hintergründe, die zum häufigen Auftreten des Apokalypse-Motivs beitragen, werden ebenfalls erörtert.
5. Georg Heym: Dieses Kapitel liefert einen Einblick in das Leben und Werk von Georg Heym, seine Weltanschauung und seinen künstlerischen Stil. Es konzentriert sich auf eine Interpretation seines Gedichts "Umbra Vitae" und bereitet den Vergleich mit einem Gemälde im späteren Kapitel vor.
6. Ludwig Meidner: Analog zu Kapitel 5 wird hier Ludwig Meidner als expressionistischer Künstler vorgestellt, seine künstlerische Position erläutert und sein Bild "Apokalyptische Landschaft (1916)" detailliert analysiert, um den anschließenden Vergleich mit Georg Heyms Werk zu ermöglichen.
7. Das Motiv der Apokalypse bei Georg Heym und Ludwig Meidner im Vergleich: In diesem Kapitel werden das Gedicht von Heym und das Gemälde von Meidner vergleichend analysiert. Dabei werden die Figuren der Apokalypse und der apokalyptische Raum als Vergleichskategorien herangezogen. Weitere Aspekte des Vergleichs sind die Perspektive, die Farbsymbolik und der Gebrauch des Grotesken als Stilmittel.
8. Paul Zech: Dieses Kapitel widmet sich der Lyrik Paul Zechs und analysiert sein Gedicht "Die neue Bergpredigt", um es im folgenden Kapitel mit einem Werk von Max Beckmann zu vergleichen.
9. Max Beckmann: Das Kapitel befasst sich mit Max Beckmann und dessen Bild "Auferstehung (1918)". Beckmanns Weg zur Entstehung dieses Werkes wird nachgezeichnet und das Bild wird detailliert analysiert im Hinblick auf den anstehenden Vergleich.
10. Das Motiv der Apokalypse bei Paul Zech und Max Beckmann im Vergleich: Ähnlich wie in Kapitel 7 werden hier die Werke von Zech und Beckmann auf Basis der selben Kategorien (Figuren, Raum, Perspektive, Farbsymbolik, Groteske) miteinander verglichen, um Gemeinsamkeiten und Unterschiede aufzuzeigen.
Schlüsselwörter
Apokalypse, Expressionismus, Künstevergleich, Literatur, Malerei, Georg Heym, Ludwig Meidner, Paul Zech, Max Beckmann, Umbra Vitae, Apokalyptische Landschaft, Die neue Bergpredigt, Auferstehung, Motivvergleich, Stilmittel, Bildanalyse, Gedichtinterpretation.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: "Vergleichende Analyse des Apokalypse-Motivs im Expressionismus"
Was ist das Thema der Arbeit?
Die Arbeit analysiert das Apokalypse-Motiv in ausgewählten Werken des Expressionismus, sowohl in der Literatur als auch in der Malerei. Sie vergleicht die Darstellung dieses Motivs in verschiedenen Medien und untersucht Gemeinsamkeiten und Unterschiede.
Welche Künstler und Werke werden untersucht?
Die Arbeit konzentriert sich auf die Werke von Georg Heym ("Umbra Vitae"), Ludwig Meidner ("Apokalyptische Landschaft, 1916"), Paul Zech ("Die neue Bergpredigt") und Max Beckmann ("Auferstehung, 1918").
Welche Methode wird angewendet?
Die Arbeit verwendet eine vergleichende Methode, um literarische und malerische Darstellungen des Apokalypse-Motivs zu analysieren. Das Motiv selbst fungiert als "tertium comparationis". Die Analyse umfasst inhaltliche Vergleiche (Figuren, Raum) und stilistische Vergleiche (Perspektive, Farbsymbolik, Groteske).
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Funktion und Verwendung des Apokalypse-Motivs im Expressionismus aufzuzeigen und einen Beitrag zum Feld des Künstevergleichs zu leisten. Sie möchte die wechselseitige Erhellung literarischer und malerischer Ausdrucksformen durch den Vergleich demonstrieren.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in elf Kapitel: Einleitung, Hintergründe zum Künstevergleich, Das Motiv der Apokalypse, Der Expressionismus, Kapitel zu den einzelnen Künstlern (Heym, Meidner, Zech, Beckmann), je zwei Vergleichskapitel (Heym/Meidner, Zech/Beckmann) und ein abschließendes Vergleichskapitel.
Welche Aspekte werden im Vergleich der Werke berücksichtigt?
Der Vergleich konzentriert sich auf inhaltliche Aspekte wie die Darstellung der Figuren und des Raums der Apokalypse sowie stilistische Aspekte wie Perspektive, Farbsymbolik und den Einsatz des Grotesken als Stilmittel. Die Funktion des Motivs in den jeweiligen Werken wird ebenfalls untersucht.
Was ist der Beitrag der Arbeit zum Künstevergleich?
Die Arbeit leistet einen Beitrag zum Künstevergleich, indem sie eine detaillierte Analyse des Apokalypse-Motivs in verschiedenen künstlerischen Medien präsentiert und die Methodik des Künstevergleichs auf eine spezifische Fragestellung anwendet.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Apokalypse, Expressionismus, Künstevergleich, Literatur, Malerei, Georg Heym, Ludwig Meidner, Paul Zech, Max Beckmann, Umbra Vitae, Apokalyptische Landschaft, Die neue Bergpredigt, Auferstehung, Motivvergleich, Stilmittel, Bildanalyse, Gedichtinterpretation.
Wo finde ich das Inhaltsverzeichnis?
Das detaillierte Inhaltsverzeichnis befindet sich im oberen Teil des bereitgestellten Dokuments und gliedert die Arbeit in einzelne Kapitel und Unterkapitel.
Gibt es eine Zusammenfassung der Kapitel?
Ja, der HTML-Code enthält eine ausführliche Zusammenfassung der einzelnen Kapitel, die die wichtigsten Inhalte und den Aufbau der Arbeit beschreibt.
Details
- Titel
- Das Motiv der Apokalypse in Literatur und Malerei des Expressionismus. Max Beckmann, Georg Heym, Ludwig Meidner und Paul Zech
- Hochschule
- Universität Leipzig (Komparatistik)
- Note
- 1,6
- Autor
- Juliane Weiß (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2014
- Seiten
- 96
- Katalognummer
- V285786
- ISBN (eBook)
- 9783656857068
- ISBN (Buch)
- 9783656857075
- Dateigröße
- 1478 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- motiv apokalypse literatur malerei expressionismus beckmann georg heym ludwig meidner paul zech
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 38,99
- Preis (Book)
- US$ 49,99
- Arbeit zitieren
- Juliane Weiß (Autor:in), 2014, Das Motiv der Apokalypse in Literatur und Malerei des Expressionismus. Max Beckmann, Georg Heym, Ludwig Meidner und Paul Zech, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/285786
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-