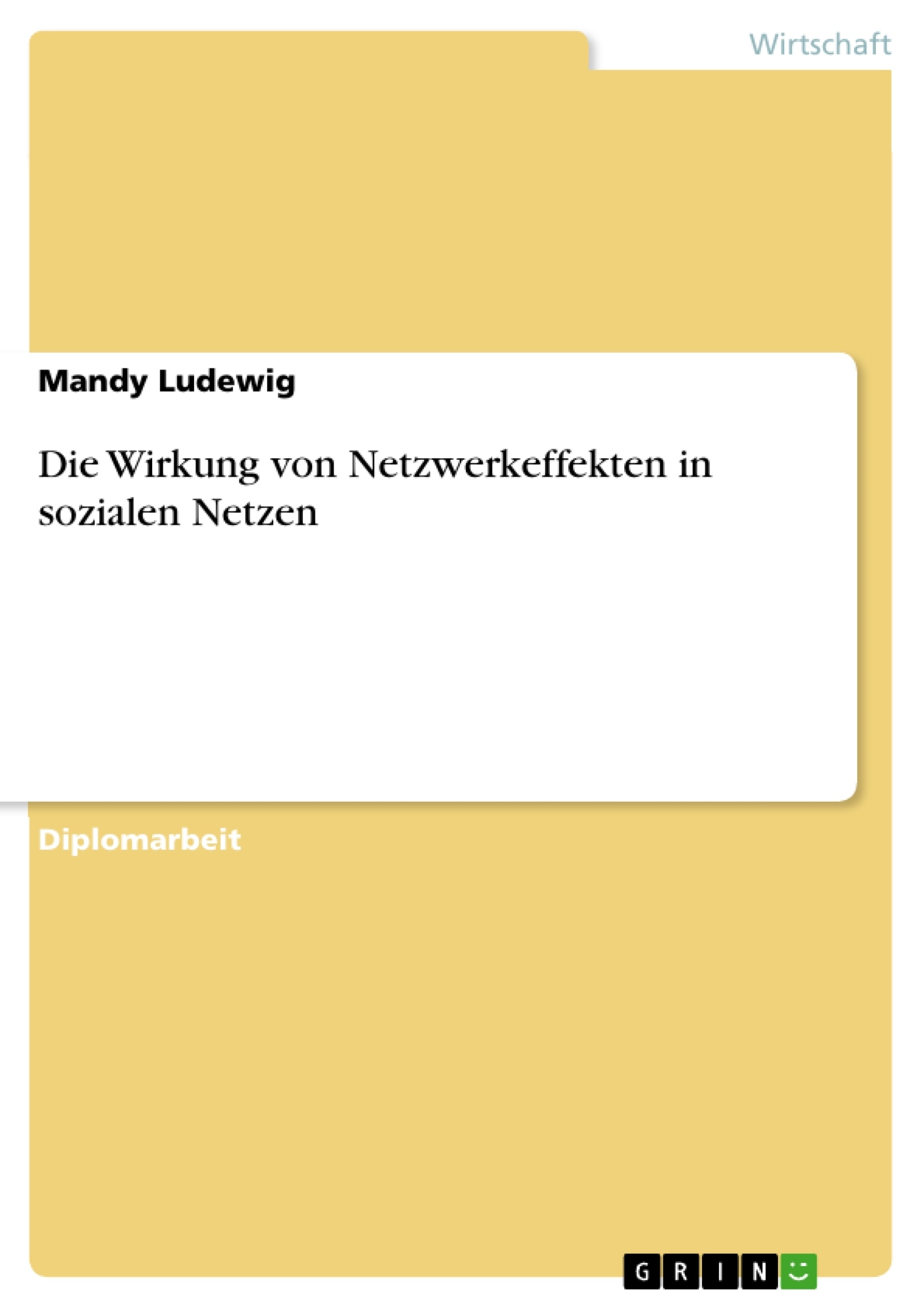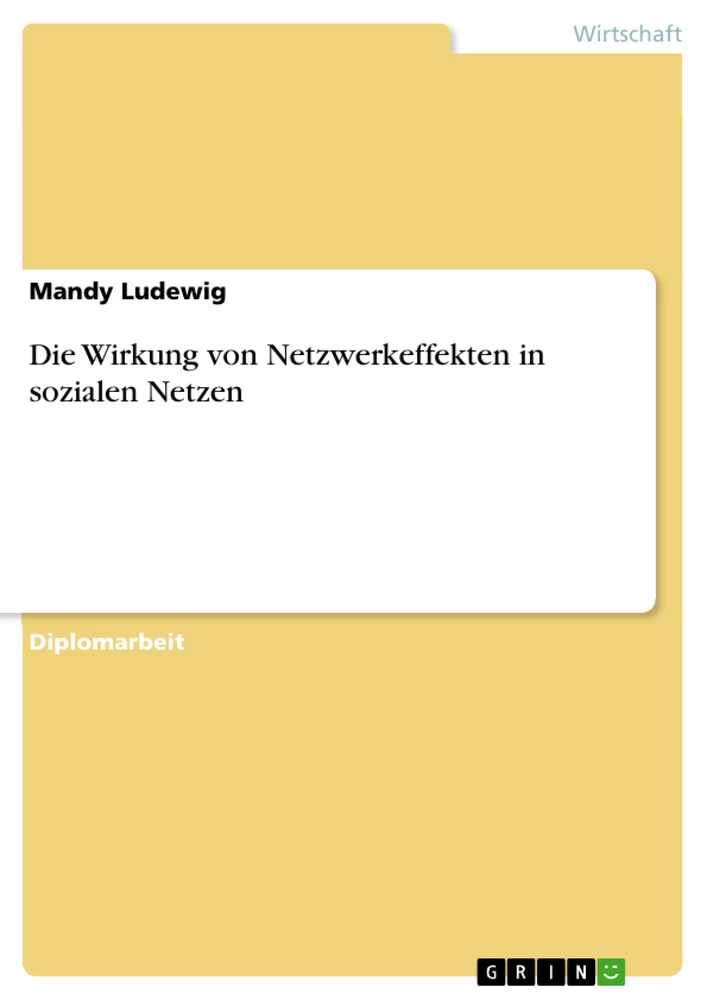
Die Wirkung von Netzwerkeffekten in sozialen Netzen
Diplomarbeit, 2014
54 Seiten, Note: 1,3
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Problemstellung und Zielsetzung
- 1.2 Gang der Untersuchung
- 2. Grundlagen
- 2.1 Definition Netzwerkeffekte
- 2.1.1 Direkte Netzwerkeffekte
- 2.1.2 Indirekte Netzwerkeffekte
- 2.2 Klassifizierung sozialer Netze
- 3. Gegenstand der Betrachtung
- 3.1 Facebook
- 3.1.1 Geschichte
- 3.1.2 Mitgliederstruktur
- 3.1.3 Funktionen
- 3.2 SchülerVZ
- 3.2.1 Geschichte
- 3.2.2 Mitgliederstruktur
- 3.2.3 Funktionen
- 4. Positive Netzwerkexternalitäten in sozialen Netzen
- 4.1 Wachstum
- 4.1.1 Gesetz von Sarnoff
- 4.1.2 Gesetz von Metcalfe
- 4.1.3 Gesetz von Reed
- 4.2 Kommunikation
- 4.3 Verhalten
- 4.4 Soziale Interaktion
- 4.5 Soziale Beziehungen
- 5. Negative Netzwerkexternalitäten in sozialen Netzen
- 5.1 Wachstum
- 5.2 Virenausbreitung
- 5.3 Kommunikation
- 6. Weitere Einflussfaktoren auf soziale Netzwerke
- 6.1 Kritische Masse
- 6.2 Stabilität des Netzwerkes
- 6.3 Standards
- 6.4 Verbreitung
- 6.5 Lock-in-Effekt
- 6.6 Studie „Epidemiological modeling of online social network dynamics“
- 7. Vergleich der Einflussfaktoren der sozialen Netzwerke Facebook und SchülerVZ
- 8. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Faktoren, die zum Erfolg sozialer Netzwerke beitragen und den Einfluss dieser Faktoren auf das Wachstum und den langfristigen Bestand solcher Netzwerke. Die Arbeit analysiert die Rolle positiver und negativer Netzwerkeffekte und geht darüber hinaus auf weitere Einflussfaktoren wie kritische Masse, Netzwerkstabilität und den Lock-in-Effekt ein.
- Einfluss von positiven und negativen Netzwerkeffekten auf den Erfolg sozialer Netzwerke
- Analyse der Bedeutung weiterer Einflussfaktoren wie kritische Masse und Netzwerkstabilität
- Vergleich der Faktoren anhand der Fallbeispiele Facebook und SchülerVZ
- Entwicklung von Handlungsempfehlungen für Betreiber sozialer Netzwerke
- Bedeutung von Netzwerkdynamiken und deren Auswirkungen.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik sozialer Netzwerke ein und stellt die zentrale Forschungsfrage nach den Faktoren für den Erfolg solcher Netzwerke. Sie vergleicht den Erfolg von Facebook mit dem Scheitern von SchülerVZ und hebt die Notwendigkeit einer umfassenden Betrachtung der Einflussfaktoren, über die positiven Netzwerkeffekte hinaus, hervor. Die Bedeutung des Themas wird im Kontext des wachsenden Einflusses sozialer Netzwerke auf das Online-Kaufverhalten und die Markenkommunikation betont.
2. Grundlagen: Dieses Kapitel definiert Netzwerkeffekte, differenziert zwischen direkten und indirekten Effekten und bietet eine Klassifizierung sozialer Netzwerke. Es legt die theoretischen Grundlagen für das Verständnis der im weiteren Verlauf der Arbeit analysierten Phänomene.
3. Gegenstand der Betrachtung: Dieses Kapitel präsentiert detaillierte Informationen zu Facebook und SchülerVZ. Es beleuchtet die Geschichte, die Mitgliederstruktur und die Funktionen beider Plattformen, um einen detaillierten Vergleichsrahmen für die spätere Analyse zu schaffen. Die unterschiedlichen Entwicklungsverläufe beider Plattformen liefern den zentralen Ausgangspunkt für die weiteren Kapitel.
4. Positive Netzwerkexternalitäten in sozialen Netzen: Dieses Kapitel befasst sich mit den positiven Auswirkungen von Netzwerkeffekten auf verschiedene Aspekte sozialer Netzwerke. Es analysiert Wachstum, Kommunikation, Verhalten und soziale Interaktion, und beleuchtet dazugehörige Theorien wie das Gesetz von Metcalfe. Die positive Rückkopplungsschleife, die durch positive Netzwerkeffekte entsteht, wird im Detail erläutert.
5. Negative Netzwerkexternalitäten in sozialen Netzen: Hier werden die negativen Auswirkungen von Netzwerkeffekten thematisiert. Die negativen Folgen für Wachstum, die Ausbreitung von Viren und die Kommunikation werden analysiert. Das Kapitel beleuchtet die Schattenseiten des schnellen Wachstums und der Vernetzung.
6. Weitere Einflussfaktoren auf soziale Netzwerke: Dieses Kapitel erweitert die Analyse über die Netzwerkeffekte hinaus und betrachtet weitere Schlüsselfaktoren wie die kritische Masse, die Netzwerkstabilität, Standards, Verbreitung, den Lock-in-Effekt und die Ergebnisse der Studie „Epidemiological modeling of online social network dynamics“. Es integriert verschiedene Perspektiven, um ein umfassenderes Bild der Einflussfaktoren zu zeichnen.
7. Vergleich der Einflussfaktoren der sozialen Netzwerke Facebook und SchülerVZ: Dieses Kapitel vergleicht die in den vorhergehenden Kapiteln diskutierten Einflussfaktoren anhand der Fallstudien Facebook und SchülerVZ. Die Analyse soll erklären, warum Facebook erfolgreich war, während SchülerVZ scheiterte. Die Unterschiede in den jeweiligen Strategien und in der Umsetzung der Einflussfaktoren stehen im Mittelpunkt.
Schlüsselwörter
Soziale Netzwerke, Netzwerkeffekte, Facebook, SchülerVZ, positive Netzwerkexternalitäten, negative Netzwerkexternalitäten, kritische Masse, Netzwerkstabilität, Lock-in-Effekt, Wachstum, Kommunikation, Verhalten, soziale Interaktion, Markenkommunikation, Online-Kaufverhalten.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Analyse Sozialer Netzwerke: Facebook vs. SchülerVZ
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Faktoren, die zum Erfolg sozialer Netzwerke beitragen und ihren Einfluss auf Wachstum und langfristigen Bestand. Im Fokus stehen positive und negative Netzwerkeffekte sowie weitere Einflussfaktoren wie kritische Masse und Lock-in-Effekte. Facebook und SchülerVZ dienen als Fallbeispiele für einen Vergleich.
Welche Faktoren werden untersucht?
Die Analyse umfasst positive und negative Netzwerkexternalitäten (direkte und indirekte Netzwerkeffekte), kritische Masse, Netzwerkstabilität, Standards, Verbreitung, den Lock-in-Effekt und die Bedeutung von Netzwerkdynamiken. Es werden Wachstum, Kommunikation, Verhalten und soziale Interaktion im Kontext dieser Faktoren betrachtet.
Welche Methoden werden angewendet?
Die Arbeit verwendet eine deskriptive und analytische Methode. Sie kombiniert die Definition und Erklärung von Netzwerkeffekten und relevanten Theorien (z.B. Metcalfe's Law) mit detaillierten Fallstudien von Facebook und SchülerVZ. Ein Vergleich der beiden Plattformen soll die Bedeutung der untersuchten Faktoren verdeutlichen.
Welche Rolle spielen Netzwerkeffekte?
Netzwerkeffekte spielen eine zentrale Rolle. Die Arbeit unterscheidet zwischen positiven Netzwerkeffekten, die zu Wachstum und verstärkter Nutzung führen, und negativen Netzwerkeffekten, die z.B. die Ausbreitung von Viren begünstigen können. Die Analyse untersucht, wie diese Effekte das Wachstum und die Stabilität sozialer Netzwerke beeinflussen.
Was sind die wichtigsten Ergebnisse des Vergleichs zwischen Facebook und SchülerVZ?
Der Vergleich von Facebook und SchülerVZ zielt darauf ab, die unterschiedlichen Erfolgsfaktoren zu identifizieren. Es wird untersucht, wie die verschiedenen Einflussfaktoren in den beiden Fällen gewirkt haben und welche Strategien zum Erfolg bzw. Scheitern geführt haben. Die Arbeit liefert Erkenntnisse darüber, welche Faktoren für den langfristigen Erfolg eines sozialen Netzwerks entscheidend sind.
Welche weiteren Einflussfaktoren werden berücksichtigt?
Neben den Netzwerkeffekten werden weitere Faktoren wie kritische Masse (der Punkt, ab dem ein Netzwerk selbsttragend wird), Netzwerkstabilität (die Fähigkeit, Störungen zu überstehen), Standards (technische und soziale Standards), Verbreitung (die Geschwindigkeit der Nutzerakquise) und der Lock-in-Effekt (die Schwierigkeit, das Netzwerk zu wechseln) detailliert analysiert.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Arbeit zieht Schlussfolgerungen über die Bedeutung der verschiedenen Einflussfaktoren für den Erfolg sozialer Netzwerke. Sie bietet Handlungsempfehlungen für Betreiber sozialer Netzwerke, um Wachstum und langfristige Stabilität zu sichern. Der Fokus liegt auf einem ganzheitlichen Verständnis der Netzwerkdynamiken und ihrer Auswirkungen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Soziale Netzwerke, Netzwerkeffekte, Facebook, SchülerVZ, positive Netzwerkexternalitäten, negative Netzwerkexternalitäten, kritische Masse, Netzwerkstabilität, Lock-in-Effekt, Wachstum, Kommunikation, Verhalten, soziale Interaktion, Markenkommunikation, Online-Kaufverhalten.
Details
- Titel
- Die Wirkung von Netzwerkeffekten in sozialen Netzen
- Hochschule
- Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie Frankfurt
- Note
- 1,3
- Autor
- Mandy Ludewig (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2014
- Seiten
- 54
- Katalognummer
- V286400
- ISBN (eBook)
- 9783656866497
- ISBN (Buch)
- 9783656866503
- Dateigröße
- 1012 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- wirkung netzwerkeffekten netzen
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 19,99
- Preis (Book)
- US$ 28,99
- Arbeit zitieren
- Mandy Ludewig (Autor:in), 2014, Die Wirkung von Netzwerkeffekten in sozialen Netzen, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/286400
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-