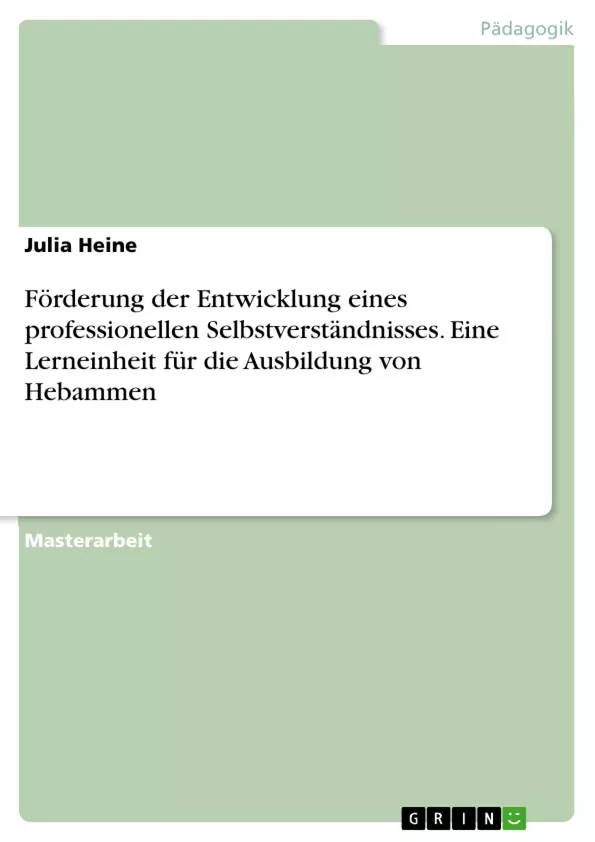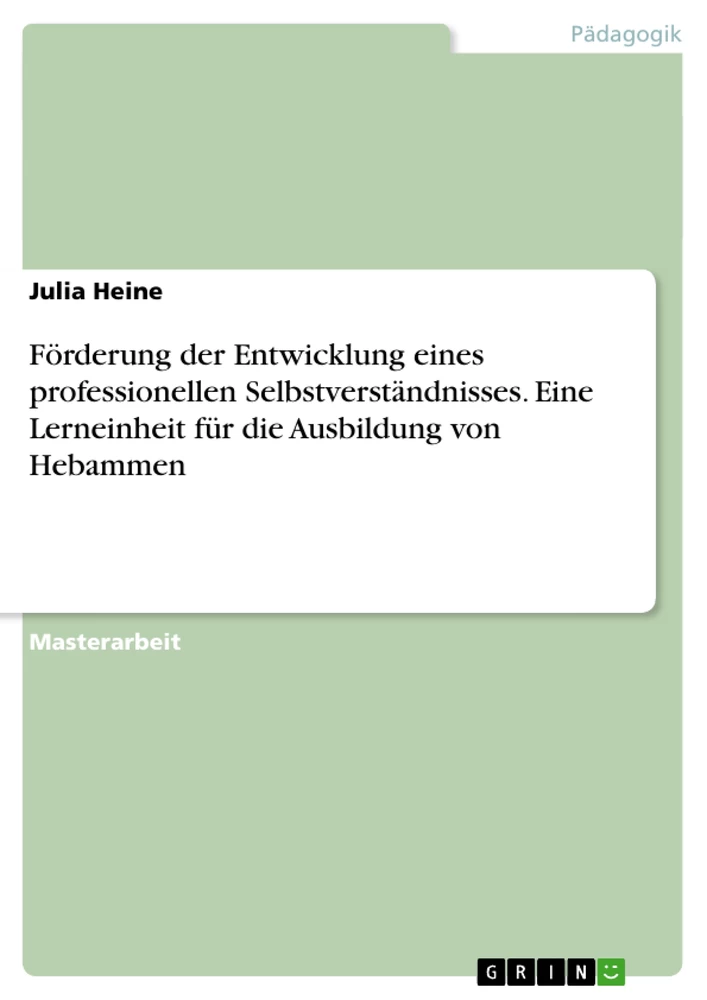
Förderung der Entwicklung eines professionellen Selbstverständnisses. Eine Lerneinheit für die Ausbildung von Hebammen
Masterarbeit, 2011
120 Seiten, Note: 1,7
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Zielsetzung und Themenschwerpunkte
- Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung
- Kapitel 2: Theorie und Konzepte
- Kapitel 3: Methoden und Design
- Kapitel 4: Ergebnisse
- Kapitel 5: Diskussion
- Schlüsselwörter
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text befasst sich mit dem Thema [Thema des Textes]. Er legt die Zielsetzung dar, [Hauptziel des Textes].
- Thema 1
- Thema 2
- Thema 3
- Thema 4
- Thema 5
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 bietet eine Einleitung zu dem Thema des Textes und stellt den aktuellen Forschungsstand dar.
Kapitel 2 beleuchtet die theoretischen Grundlagen und Konzepte, die für die Untersuchung relevant sind.
Kapitel 3 erläutert die Methoden und das Design der Untersuchung.
Kapitel 4 präsentiert die Ergebnisse der Untersuchung.
Kapitel 5 diskutiert die Ergebnisse im Kontext der relevanten Literatur und stellt die wichtigsten Schlussfolgerungen dar.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes sind [Hauptthemen des Textes].
Häufig gestellte Fragen
Wie entwickelt sich ein professionelles Selbstverständnis bei Hebammen?
Es ist ein jahrelanger Prozess, der eng mit der Persönlichkeitsentwicklung und der beruflichen Identifizierung verknüpft ist.
Was ist das Ziel der konzipierten Lerneinheit?
Die Lerneinheit soll die Handlungskompetenz stärken und die Entwicklung einer professionellen beruflichen Identität bereits in der Ausbildung fördern.
Welche Rolle spielt die Geschichte des Hebammenwesens?
Die geschichtliche Entwicklung hilft dabei, professionssoziologische Aspekte zu verstehen und das heutige Berufsrollenverständnis zu schärfen.
Warum ist fächerintegrativer Unterricht in der Hebammenausbildung wichtig?
Weil professionelles Handeln in der Praxis nicht in Einzelfächer unterteilt ist, sondern eine ganzheitliche Kompetenz erfordert.
Warum wird ein Besuch in den Niederlanden vorgeschlagen?
Die Niederlande gelten im Bereich Midwifery als Vorbild; der Besuch soll den Lernenden neue Perspektiven und berufspolitisches Interesse vermitteln.
Details
- Titel
- Förderung der Entwicklung eines professionellen Selbstverständnisses. Eine Lerneinheit für die Ausbildung von Hebammen
- Hochschule
- Fachhochschule Bielefeld (Wirtschaft und Gesundheit)
- Note
- 1,7
- Autor
- Julia Heine (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2011
- Seiten
- 120
- Katalognummer
- V287295
- ISBN (eBook)
- 9783656881988
- ISBN (Buch)
- 9783656881995
- Dateigröße
- 11548 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- förderung entwicklung selbstverständnisses eine lerneinheit ausbildung hebammen
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 39,99
- Preis (Book)
- US$ 50,99
- Arbeit zitieren
- Julia Heine (Autor:in), 2011, Förderung der Entwicklung eines professionellen Selbstverständnisses. Eine Lerneinheit für die Ausbildung von Hebammen, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/287295
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-