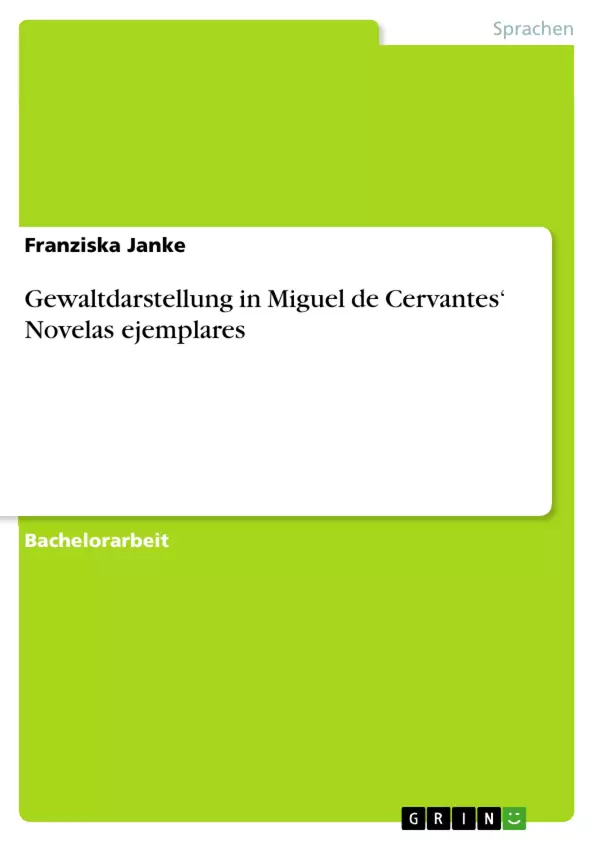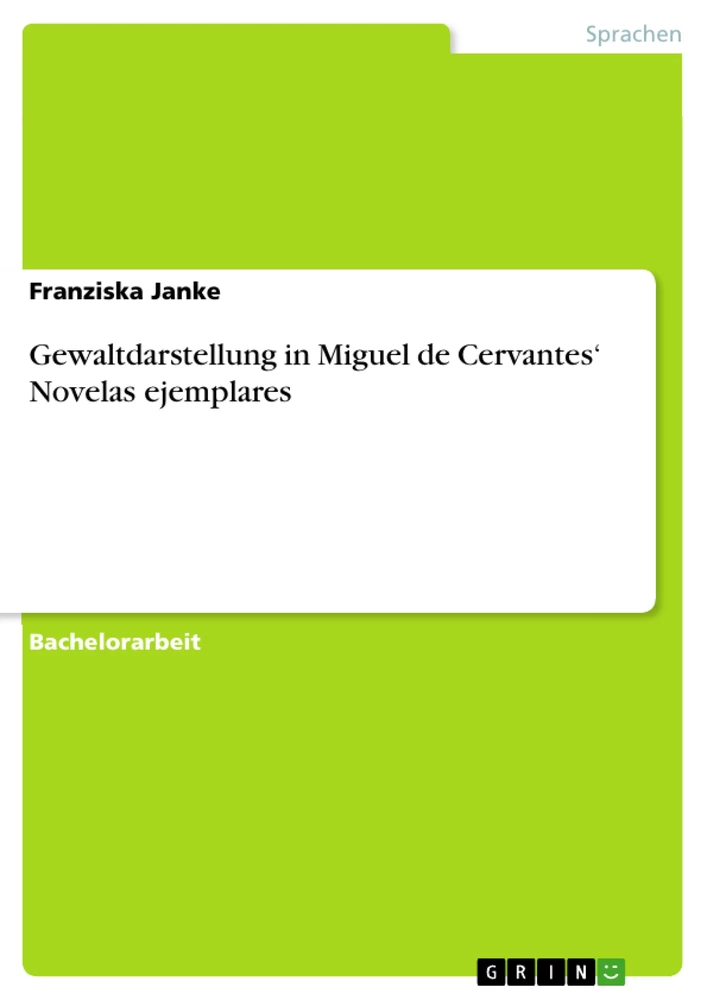
Gewaltdarstellung in Miguel de Cervantes‘ Novelas ejemplares
Bachelorarbeit, 2014
29 Seiten, Note: 1,7
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Definition Gewalt
- Miguel de Cervantes
- Novela de la fuerza de la sangre
- Ort und Zeit der Handlung
- Erzählperspektive
- Personen
- Hauptfiguren
- Nebenfiguren
- Gewaltdarstellung
- Physische Gewalt - Entführung und Vergewaltigung
- Psychische Gewalt
- Novela del amante liberal
- Ort und Zeit der Handlung
- Erzählperspektive
- Personen
- Hauptfiguren
- Nebenfiguren
- Gewaltdarstellung
- Strukturelle Gewalt - Gefangenschaft und Korruption
- Naturgewalt
- Psychische Gewalt
- Physische Gewalt
- Fazit
- Literaturverzeichnis
- Monographien
- Internetquellen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Bachelorarbeit analysiert die verschiedenen Formen der Gewaltdarstellung in zwei exemplarischen Novellen von Miguel de Cervantes, "La fuerza de la sangre" und "El amante liberal". Ziel ist es, die unterschiedlichen Arten von Gewalt aufzuzeigen und zu untersuchen, inwieweit diese mit dem Privatleben des Autors in Verbindung stehen. Die Arbeit beleuchtet die physische, psychische und strukturelle Gewalt sowie die Rolle der Naturgewalt in den Novellen.
- Definition und Analyse verschiedener Gewaltformen
- Verbindung zwischen Cervantes' Werken und seinem Privatleben
- Untersuchung der physischen, psychischen und strukturellen Gewalt
- Rolle der Naturgewalt in den Novellen
- Interpretation der Gewaltdarstellung im Kontext der Novellen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Gewaltdarstellung in den Novellen von Miguel de Cervantes ein und stellt die Zielsetzung der Arbeit dar. Im zweiten Kapitel wird der Begriff Gewalt definiert und die verschiedenen Formen der Gewalt, wie physische, psychische, strukturelle und Naturgewalt, erläutert. Das dritte Kapitel bietet einen kurzen Abriss über die Biografie von Miguel de Cervantes. Die Kapitel vier und fünf widmen sich den beiden Novellen "La fuerza de la sangre" und "El amante liberal". In diesen Kapiteln werden Ort, Zeit und Erzählperspektive der Handlungen sowie die Protagonisten näher beleuchtet. Darüber hinaus werden die verschiedenen Formen der Gewalt in den Novellen analysiert und interpretiert. Das sechste Kapitel fasst die Ergebnisse der Arbeit zusammen und zieht Schlussfolgerungen aus der Analyse der Gewaltdarstellung in den Novellen.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Gewaltdarstellung in den Novellen von Miguel de Cervantes, insbesondere in "La fuerza de la sangre" und "El amante liberal". Die Arbeit analysiert die verschiedenen Formen der Gewalt, darunter physische, psychische, strukturelle und Naturgewalt, und untersucht die Verbindung zwischen Cervantes' Werken und seinem Privatleben. Weitere wichtige Themen sind die Charakterisierung der Protagonisten, die Analyse der Erzählperspektive und die Interpretation der Gewaltdarstellung im Kontext der Novellen.
Details
- Titel
- Gewaltdarstellung in Miguel de Cervantes‘ Novelas ejemplares
- Hochschule
- Universität Potsdam (Institut für Romanistik)
- Veranstaltung
- Spanische Philologie
- Note
- 1,7
- Autor
- Franziska Janke (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2014
- Seiten
- 29
- Katalognummer
- V287536
- ISBN (eBook)
- 9783656878308
- ISBN (Buch)
- 9783656878315
- Dateigröße
- 779 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Miguel de Cervantes La fuerza de la sangre El amante liberal Gewalt
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 17,99
- Preis (Book)
- US$ 19,99
- Arbeit zitieren
- Franziska Janke (Autor:in), 2014, Gewaltdarstellung in Miguel de Cervantes‘ Novelas ejemplares, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/287536
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-