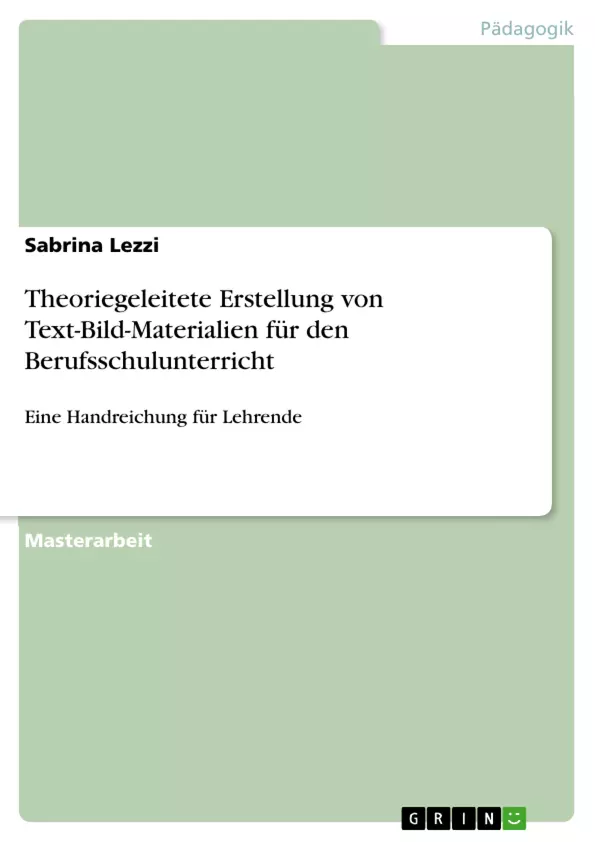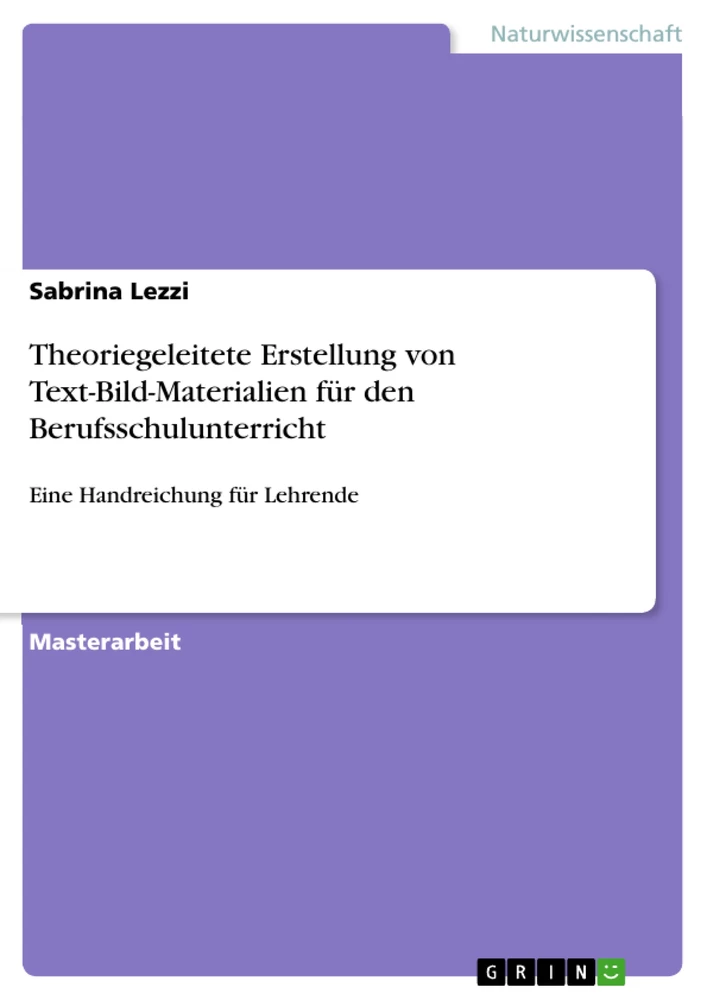
Theoriegeleitete Erstellung von Text-Bild-Materialien für den Berufsschulunterricht
Masterarbeit, 2014
121 Seiten, Note: 1,3
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Abstract
- Einleitung
- I. Theoretischer Teil
- 1 Texte
- 1.1 Begriffsklärung
- 1.2 Umgang
- 1.3 Arten
- 1.4 Funktionen
- 1.5 Informationsverarbeitung
- 2 Bilder
- 2.1 Begriffsklärung
- 2.2 Umgang
- 2.3 Arten
- 2.4 Funktionen
- 2.5 Informationsverarbeitung
- 3 Gestaltungselemente von Texten und Bildern
- 3.1 Gestaltungsgesetze
- 3.2 Farben
- 3.3 Schriften
- 4 Visual Literacy
- 4.1 Medienkompetenz
- 4.2 Unterrichtsmedien
- 5 Kombinationsmöglichkeiten von Texten und Bildern
- 5.1 Komplementäre und redundante Kombinationen
- 5.1.1 Wissensstrukturformen
- 5.1.2 Lernen
- 5.2 Verbale und non-verbale Informationsverarbeitung
- 5.3 Probleme bei Text-Bild-Kombinationen
- 5.1 Komplementäre und redundante Kombinationen
- 1 Texte
- II. Konzeptioneller Teil
- 6 Handreichung zur Erstellung von Text-Bild-Materialien
- 6.1 Auswahl eines Bildungsganges: Berufliches Gymnasium für Gesundheit
- 6.2 Auswahl eines Inhaltsbereiches: Herz-Kreislauf-System und Arteriosklerose
- 6.3 Planungsraster zur Erstellung von Text-Bild-Materialien
- 6.4 Checkliste für Lehrende
- 6 Handreichung zur Erstellung von Text-Bild-Materialien
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Masterarbeit zielt darauf ab, Lehrenden eine Handreichung zur Theorie-geleiteten Erstellung von Text-Bild-Materialien für den Berufsschulunterricht bereitzustellen. Das Ziel ist die bewusste Auswahl und den gezielten Einsatz von Text-Bild-Kombinationen im Unterricht, um die Vorteile beider Medien optimal zu nutzen.
- Theorie der Text-Bild-Kombinationen (redundant und komplementär)
- Informationsverarbeitung von Text und Bild
- Gestaltungselemente von Text und Bild (Farben, Schriften, Gestaltungsgesetze)
- Visual Literacy und Medienkompetenz
- Praktische Anwendung am Beispiel "Arteriosklerose"
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und beschreibt die zunehmende Bedeutung von Bildern als Wissensvermittler, besonders für jüngere Generationen. Sie hebt die unterschätzten Potenziale von Bildern hervor und betont die Notwendigkeit sinnvoller Text-Bild-Kombinationen für effektives Lernen. Die Arbeit verfolgt das Ziel, Lehrenden Grundlagen für die professionelle Erstellung und den effektiven Umgang mit Text-Bild-Materialien zu vermitteln.
I. Theoretischer Teil: Dieser Teil legt die theoretischen Grundlagen für die Erstellung von Text-Bild-Materialien dar. Er behandelt die Eigenschaften von Texten und Bildern, ihre verschiedenen Arten und Funktionen, sowie die Prozesse ihrer Informationsverarbeitung. Besonderes Augenmerk liegt auf den Kombinationsmöglichkeiten von Text und Bild, insbesondere komplementäre und redundante Kombinationen, und deren Auswirkungen auf das Lernen.
1 Texte: Dieses Kapitel definiert den Begriff "Text" und beschreibt verschiedene Arten des Umgangs mit Texten, unterschiedliche Textarten und deren Funktionen sowie die kognitive Informationsverarbeitung von Texten.
2 Bilder: Ähnlich wie Kapitel 1, behandelt dieses Kapitel die Definition und Arten von Bildern, den Umgang mit Bildern, ihre verschiedenen Funktionen und die Informationsverarbeitung im Zusammenhang mit Bildrezeption. Es werden verschiedene Bildarten (realistisch, logisch, Analogiebilder) detailliert erläutert.
3 Gestaltungselemente von Texten und Bildern: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Gestaltungselemente von Text und Bild, inklusive Gestaltungsgesetze, Farben und Schriften. Es werden Empfehlungen für eine lernförderliche Gestaltung von Text-Bild-Materialien gegeben.
4 Visual Literacy: Das Kapitel befasst sich mit dem Konzept der Visual Literacy, der Fähigkeit, visuelle Reize zu verstehen und zu analysieren. Es werden die Medienkompetenz, die Lesekompetenz und die Bildkompetenz definiert und in ihrem Zusammenhang zueinander erklärt.
5 Kombinationsmöglichkeiten von Texten und Bildern: Dieses Kapitel beschreibt verschiedene Kombinationsmöglichkeiten von Text und Bild (komplementär und redundant) und deren Auswirkungen auf die Informationsverarbeitung und den Lernerfolg. Es beleuchtet die verschiedenen Wissensstrukturformen und deren Anwendung in der Gestaltung von Lernmaterialien.
II. Konzeptioneller Teil: Der konzeptionelle Teil präsentiert eine Handreichung zur Erstellung von Text-Bild-Materialien, die auf den theoretischen Grundlagen des ersten Teils basiert. Er beschreibt die Auswahl eines Bildungsganges (Berufliches Gymnasium für Gesundheit) und eines Inhaltsbereichs (Arteriosklerose).
6 Handreichung zur Erstellung von Text-Bild-Materialien: Dieses Kapitel erläutert die Vorgehensweise bei der Erstellung von Text-Bild-Materialien anhand eines Planungsrasters und einer Checkliste. Es werden beispielhafte Text-Bild-Materialien zum Thema Arteriosklerose präsentiert und analysiert.
Schlüsselwörter
Text-Bild-Materialien, Berufsschulunterricht, Visualisierung, Informationsverarbeitung, Visual Literacy, Medienkompetenz, komplementäre und redundante Kombinationen, Arteriosklerose, Herz-Kreislauf-System, Gestaltungsgesetze, Lernförderung.
Häufig gestellte Fragen zur Masterarbeit: Text-Bild-Materialien im Berufsschulunterricht
Was ist der Gegenstand dieser Masterarbeit?
Die Masterarbeit befasst sich mit der Erstellung und dem Einsatz von Text-Bild-Materialien im Berufsschulunterricht. Sie bietet Lehrenden eine handlungsorientierte Anleitung zur Theorie-geleiteten Gestaltung solcher Materialien, um die Vorteile von Text und Bild optimal zu kombinieren und den Lernerfolg zu maximieren.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit umfasst einen theoretischen Teil, der die Grundlagen der Text-Bild-Kombination beleuchtet, und einen konzeptionellen Teil, der eine praktische Handreichung zur Erstellung solcher Materialien liefert. Spezifische Themen sind: die Theorie der Text-Bild-Kombinationen (redundant und komplementär), Informationsverarbeitung von Text und Bild, Gestaltungselemente (Farben, Schriften, Gestaltungsgesetze), Visual Literacy und Medienkompetenz, sowie die praktische Anwendung am Beispiel "Arteriosklerose".
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, Lehrenden eine fundierte Grundlage für die Erstellung und den effektiven Einsatz von Text-Bild-Materialien zu geben. Das Ziel ist die bewusste Auswahl und Kombination von Text und Bild, um die jeweiligen Stärken beider Medien optimal für den Unterricht zu nutzen und das Lernen zu fördern.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in einen theoretischen und einen konzeptionellen Teil. Der theoretische Teil behandelt Texte und Bilder einzeln (Begriffsklärung, Umgang, Arten, Funktionen, Informationsverarbeitung), Gestaltungselemente (Gestaltungsgesetze, Farben, Schriften) und Visual Literacy. Ein Schwerpunkt liegt auf den Kombinationsmöglichkeiten von Text und Bild (komplementär und redundant) und deren Auswirkungen auf den Lernerfolg. Der konzeptionelle Teil bietet eine praktische Handreichung zur Erstellung von Text-Bild-Materialien, am Beispiel des Beruflichen Gymnasiums für Gesundheit und dem Thema Arteriosklerose.
Welche praktischen Hilfen bietet die Arbeit?
Die Arbeit beinhaltet ein ausführliches Inhaltsverzeichnis, eine Zusammenfassung der Kapitel, eine Definition der Schlüsselbegriffe und vor allem eine detaillierte Handreichung zur Erstellung von Text-Bild-Materialien. Diese Handreichung enthält einen Planungsraster und eine Checkliste für Lehrende, um die Erstellung von effektiven Lernmaterialien zu unterstützen.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit richtet sich in erster Linie an Lehrende im Berufsschulunterricht, insbesondere an Lehrkräfte, die ihre Medienkompetenz im Bereich der Text-Bild-Kombination verbessern möchten. Sie ist auch für Aus- und Weiterbildung im Bereich der Didaktik und Medienpädagogik von Interesse.
Welche konkreten Beispiele werden verwendet?
Als praktisches Beispiel wird das Thema Arteriosklerose im Kontext des Herz-Kreislauf-Systems im Beruflichen Gymnasium für Gesundheit verwendet. Anhand dieses Beispiels wird die praktische Anwendung der theoretischen Konzepte und der Handreichung zur Erstellung von Text-Bild-Materialien illustriert.
Welche Schlüsselbegriffe sind wichtig?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Text-Bild-Materialien, Berufsschulunterricht, Visualisierung, Informationsverarbeitung, Visual Literacy, Medienkompetenz, komplementäre und redundante Kombinationen, Arteriosklerose, Herz-Kreislauf-System, Gestaltungsgesetze, Lernförderung.
Details
- Titel
- Theoriegeleitete Erstellung von Text-Bild-Materialien für den Berufsschulunterricht
- Untertitel
- Eine Handreichung für Lehrende
- Hochschule
- Fachhochschule Münster (Institut für berufliche Lehrerbildung)
- Note
- 1,3
- Autor
- Sabrina Lezzi (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2014
- Seiten
- 121
- Katalognummer
- V287582
- ISBN (eBook)
- 9783656877769
- ISBN (Buch)
- 9783656877776
- Dateigröße
- 3284 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- theoriegeleitete erstellung text-bild-materialien berufsschulunterricht eine handreichung lehrende
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 38,99
- Preis (Book)
- US$ 49,99
- Arbeit zitieren
- Sabrina Lezzi (Autor:in), 2014, Theoriegeleitete Erstellung von Text-Bild-Materialien für den Berufsschulunterricht, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/287582
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-