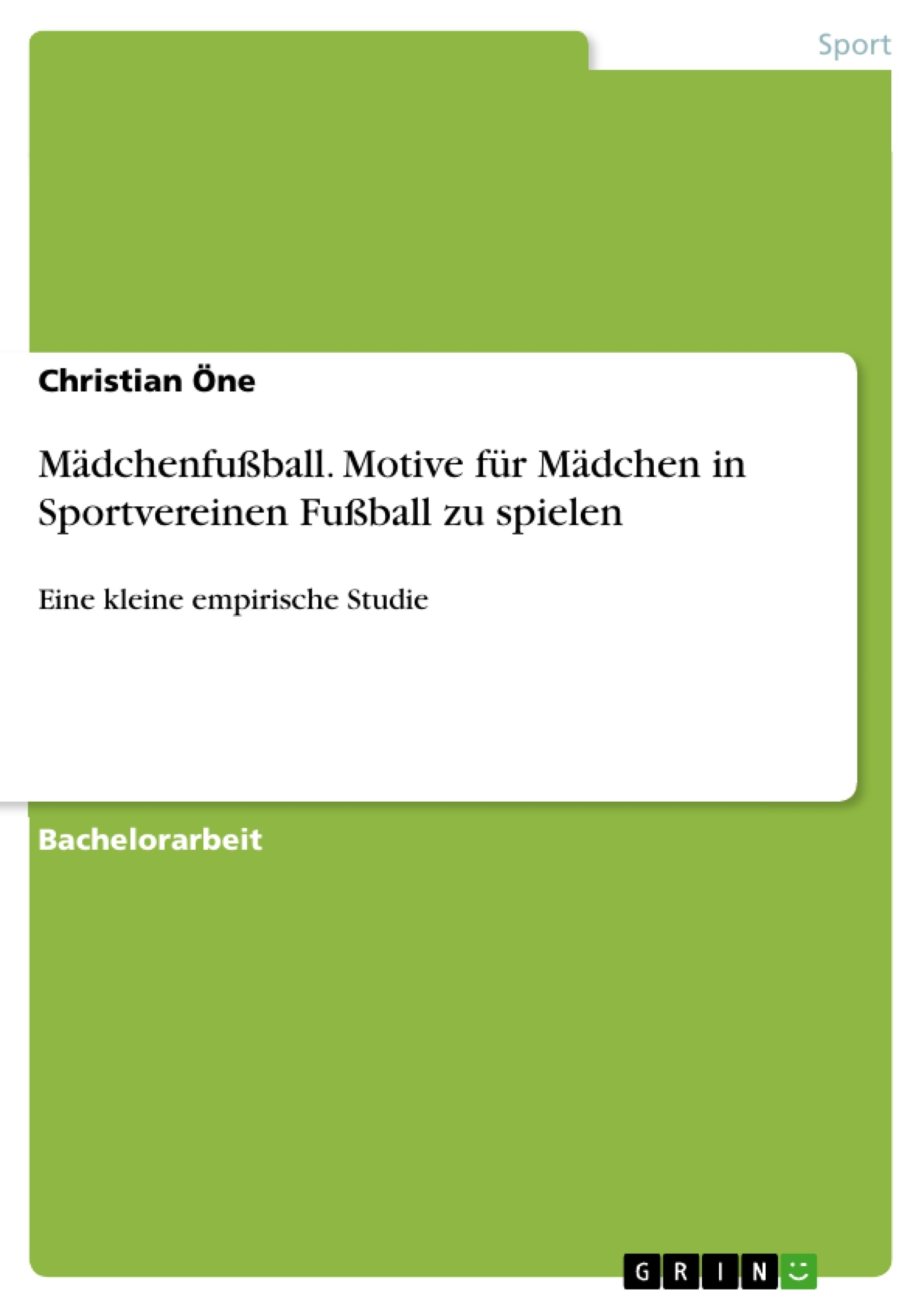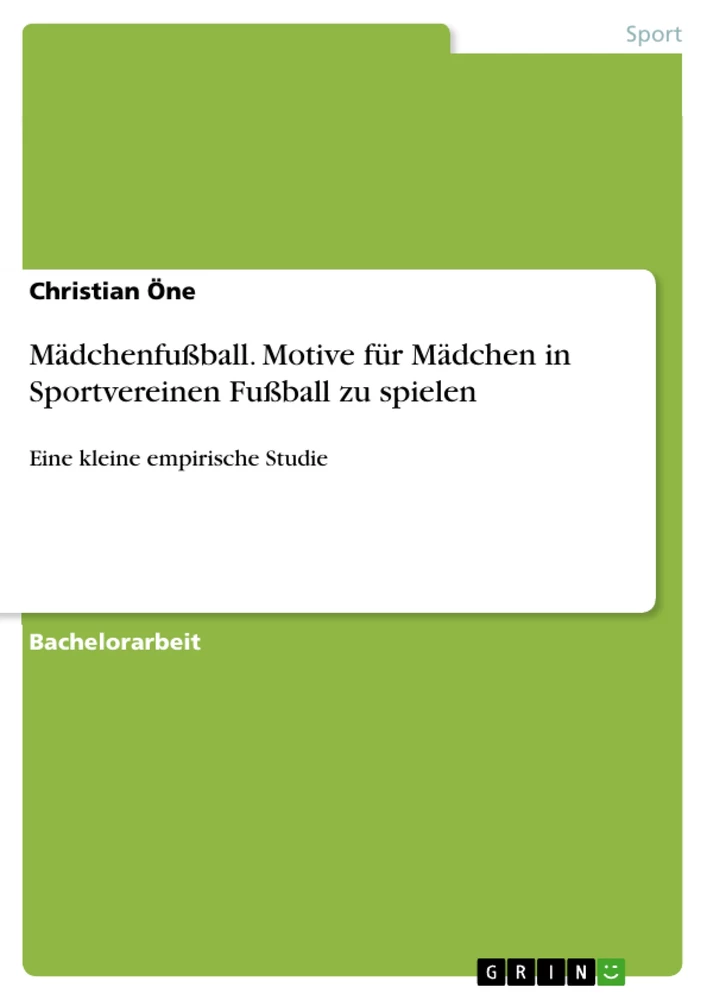
Mädchenfußball. Motive für Mädchen in Sportvereinen Fußball zu spielen
Bachelorarbeit, 2012
52 Seiten, Note: 1,5
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Historischer Rückblick
- Anfänge des Mädchensports
- Geschichtlicher Hintergrund des Mädchen- und Frauenfußballs
- Frauensport in der Gesellschaft
- Aktuelle Entwicklung im Mädchen- und Frauenfußball
- Gegenwertiger Stand
- Erörterung über Motivation
- Triebtheorie
- Feldtheorie
- Exkurs über Taufliegen
- Motivtheorie
- Klassifizierung von Motiven
- Empirie
- Wissenschaftliche Fragestellung
- Fragebogen
- Stichprobe
- Datenerhebung
- Analyse und Vergleich der Ergebnisse
- Motive im Fußball
- Zusammenfassung der Motive im Fußball
- Soziale Fußballidentität
- Persönliche Fußballidentität
- Fazit
- Anhang
- Quellen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Bachelorarbeit befasst sich mit den Motiven von Mädchen, die in Sportvereinen Fußball spielen. Ziel ist es, die Motivation von Mädchen im Fußball anhand einer empirischen Studie zu untersuchen und mit der Motivation von Jungen im Fußball zu vergleichen. Die Arbeit beleuchtet die geschichtliche Entwicklung des Mädchen- und Frauenfußballs und die aktuelle Situation im Frauensport.
- Motivation von Mädchen im Fußball
- Geschichtliche Entwicklung des Mädchen- und Frauenfußballs
- Aktuelle Situation im Frauensport
- Vergleich der Motivation von Mädchen und Jungen im Fußball
- Soziale und persönliche Fußballidentität
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema Mädchenfußball ein und stellt die Relevanz des Themas dar. Sie beleuchtet die Bedeutung des Fußballs für Millionen von Menschen und die wachsende Bedeutung des Mädchen- und Frauenfußballs.
Der historische Rückblick beleuchtet die Anfänge des Mädchensports und die geschichtliche Entwicklung des Mädchen- und Frauenfußballs.
Das Kapitel "Frauensport in der Gesellschaft" befasst sich mit der Rolle des Frauensport in der Gesellschaft und den Herausforderungen, denen Frauen im Sport begegnen.
Das Kapitel "Aktuelle Entwicklung im Mädchen- und Frauenfußball" beleuchtet die aktuelle Situation im Mädchen- und Frauenfußball und die steigende Tendenz von Mädchen im Fußball.
Das Kapitel "Erörterung über Motivation" befasst sich mit verschiedenen Motivationstheorien und klassifiziert die Motive von Mädchen im Fußball.
Das Kapitel "Empirie" beschreibt die wissenschaftliche Fragestellung, den Fragebogen, die Stichprobe und die Datenerhebung der empirischen Studie.
Das Kapitel "Motive im Fußball" analysiert und vergleicht die Ergebnisse der empirischen Studie und beleuchtet die sozialen und persönlichen Fußballidentitäten von Mädchen.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den Mädchenfußball, die Motivation von Mädchen im Sport, die geschichtliche Entwicklung des Mädchen- und Frauenfußballs, die aktuelle Situation im Frauensport, die soziale und persönliche Fußballidentität sowie die Vergleichbarkeit der Motivation von Mädchen und Jungen im Fußball.
Häufig gestellte Fragen
Was motiviert Mädchen, im Verein Fußball zu spielen?
Die Motive sind vielfältig und umfassen sowohl den sportlichen Ehrgeiz als auch soziale Komponenten wie Teamgeist und Freundschaften.
Wie unterscheidet sich die Motivation von Mädchen und Jungen?
Die Arbeit vergleicht die Antriebsfaktoren beider Geschlechter und untersucht, ob Mädchen eher soziale oder eher leistungsorientierte Ziele verfolgen.
Welche Rolle spielt Fußball für die Integration?
Fußball fungiert als wichtiger Ort der Integration für Menschen mit Migrationshintergrund und Menschen mit Behinderung.
Gab es früher Verbote für Frauenfußball?
Ja, die Arbeit beleuchtet den historischen Rückblick und die gesellschaftlichen Widerstände, denen der Frauenfußball in der Vergangenheit ausgesetzt war.
Was ist die „soziale Fußballidentität“?
Es beschreibt, wie sich Mädchen durch die Zugehörigkeit zu einer Mannschaft definieren und welche Rolle der Trainer als Vorbild und Erzieher spielt.
Details
- Titel
- Mädchenfußball. Motive für Mädchen in Sportvereinen Fußball zu spielen
- Untertitel
- Eine kleine empirische Studie
- Hochschule
- Alice-Salomon Hochschule Berlin
- Note
- 1,5
- Autor
- Christian Öne (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2012
- Seiten
- 52
- Katalognummer
- V288038
- ISBN (eBook)
- 9783656884590
- ISBN (Buch)
- 9783656884606
- Dateigröße
- 2861 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Frauenfussball ;Mädchenfussball Soccer Fussball Motivation im Sport Sportvereine Motivation
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 20,99
- Preis (Book)
- US$ 26,99
- Arbeit zitieren
- Christian Öne (Autor:in), 2012, Mädchenfußball. Motive für Mädchen in Sportvereinen Fußball zu spielen, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/288038
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-