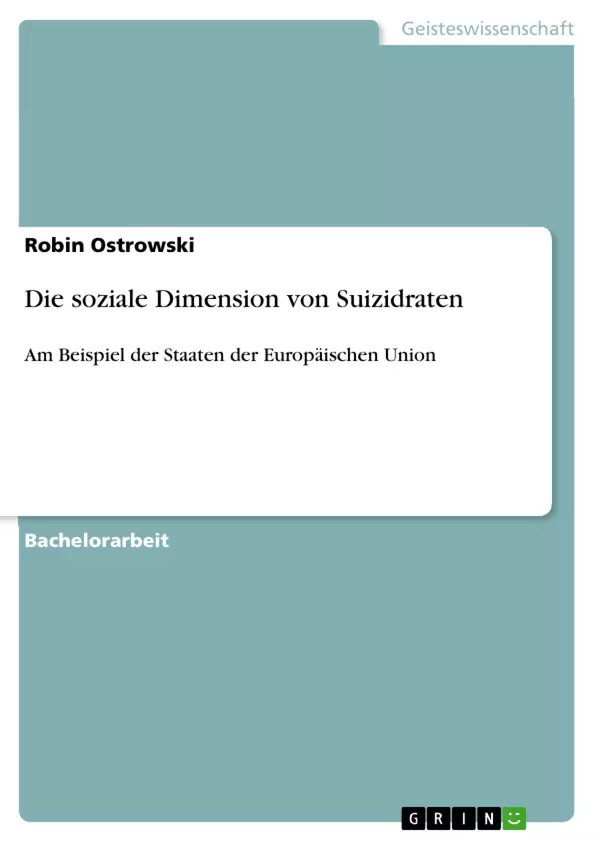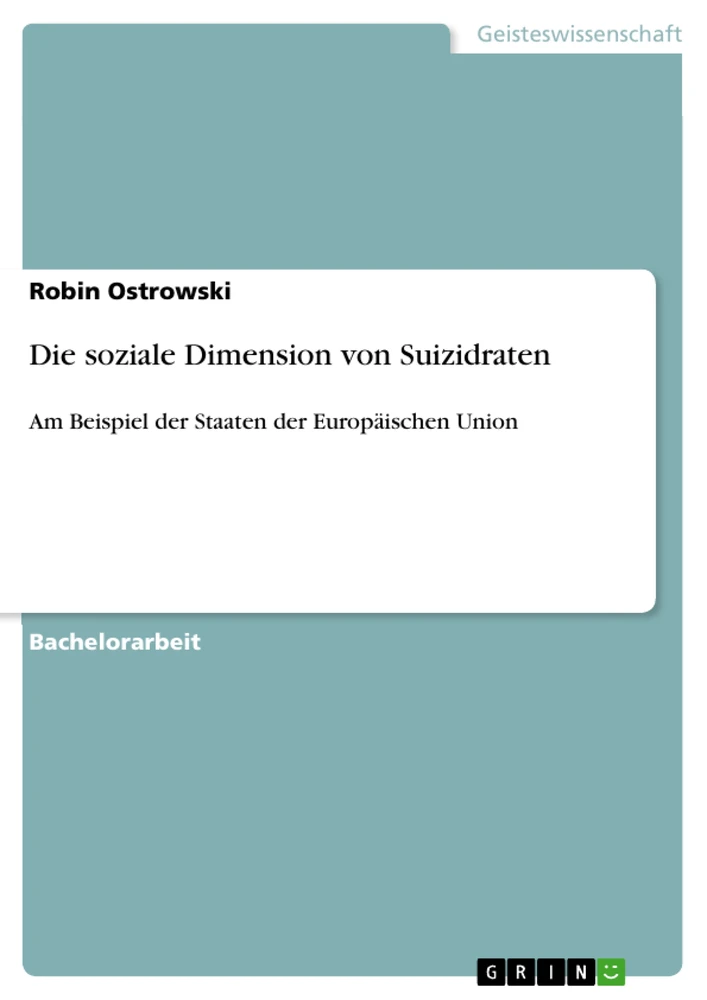
Die soziale Dimension von Suizidraten
Bachelorarbeit, 2014
44 Seiten, Note: 1,7
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die Maßzahlen in der Epidemiologie
- 2.1. Prävalenz, Inzidenz und Mortalität
- 2.2. Spezifische Suizidraten und Altersstandardisierungen
- 3. Problemstellung: Suizidraten in Europa
- 4. Soziologische Theorie: Von Durkheims „Le Suicide“ bis heute
- 4.1. Emile Durkheim: Soziale Integration und die soziale Ordnung
- 4.2. Kritik an Durkheim
- 4.3. Integration, Anomie und sozialer Wandel
- 4.4. Soziale Integration und geschlechtsspezifische Suizidraten
- 4.5. Alter und soziale Integration
- 5. Analyse
- 5.1. Geschlechtsspezifische Suizidraten
- 5.2. Altersspezifische Suizidraten
- 5.3. Zusammenfassung und Interpretation der Zusammenhänge
- 6. Suizidraten und Soziologie im 20. und 21. Jahrhundert: Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht die soziale Dimension von Suizidraten in den Staaten der Europäischen Union. Ziel ist es, über die rein individuellen Erklärungen von Suizid hinauszugehen und den sozialen Kontext als wichtigen Einflussfaktor zu beleuchten. Die Arbeit analysiert statistische Daten und soziologische Theorien, um die Zusammenhänge zwischen Suizid und sozialen Faktoren zu erforschen.
- Soziologische Theorien des Suizids (Durkheim und Weiterentwicklungen)
- Analyse geschlechtsspezifischer Suizidraten in der EU
- Analyse altersspezifischer Suizidraten in der EU
- Epidemiologische Maßzahlen und deren Anwendung auf Suiziddaten
- Der Einfluss sozialer Integration auf Suizidraten
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt mit prominenten Beispielen von Suiziden ein und hebt die Notwendigkeit einer soziologischen Betrachtungsweise hervor, im Gegensatz zu rein individuellen Erklärungen. Sie stellt die hohe Zahl der Suizide in der EU heraus und betont die Bedeutung des sozialen Kontextes für das Verständnis des Phänomens. Die Arbeit fokussiert sich auf die Untersuchung des sozialen Kontextes im Zusammenhang mit Suizid.
2. Die Maßzahlen in der Epidemiologie: Dieses Kapitel erläutert grundlegende epidemiologische Maßzahlen wie Prävalenz, Inzidenz und Mortalität im Kontext von Suizid. Es betont die Bedeutung der Mortalität als Hauptmaßzahl für Suizid und diskutiert die Notwendigkeit von Standardisierungen zur Verbesserung der Vergleichbarkeit von Daten über verschiedene Regionen und Zeiträume. Der Abschnitt thematisiert die Herausforderungen und Grenzen der Standardisierung von Suizidraten.
4. Soziologische Theorie: Von Durkheims „Le Suicide“ bis heute: Dieses Kapitel präsentiert Emile Durkheims Theorie der sozialen Integration und deren Bedeutung für das Verständnis von Suizid. Es analysiert die Kritik an Durkheims Ansatz und diskutiert die Weiterentwicklung der Theorie im Hinblick auf soziale Integration, Anomie und sozialen Wandel. Die Bedeutung der sozialen Integration für geschlechtsspezifische und altersspezifische Suizidraten wird ebenfalls betrachtet. Das Kapitel bildet die theoretische Grundlage für die anschließende empirische Analyse.
5. Analyse: Dieses Kapitel präsentiert die empirische Analyse geschlechtsspezifischer und altersspezifischer Suizidraten. Es untersucht die Zusammenhänge zwischen diesen demografischen Faktoren und der Häufigkeit von Suiziden. Die Ergebnisse werden interpretiert und im Kontext der zuvor vorgestellten soziologischen Theorien diskutiert.
Schlüsselwörter
Suizid, Soziologie, Emile Durkheim, soziale Integration, Anomie, Selbsttötung, Epidemiologie, Prävalenz, Inzidenz, Mortalität, Altersstandardisierung, Geschlechtsspezifische Suizidraten, Altersspezifische Suizidraten, Europäische Union, statistische Soziologie.
Häufig gestellte Fragen zur Bachelorarbeit: Soziale Dimension von Suizidraten in der EU
Was ist der Gegenstand dieser Bachelorarbeit?
Die Arbeit untersucht die soziale Dimension von Suizidraten in den Staaten der Europäischen Union. Sie geht über rein individuelle Erklärungen von Suiziden hinaus und beleuchtet den sozialen Kontext als wichtigen Einflussfaktor. Die Analyse basiert auf statistischen Daten und soziologischen Theorien.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt soziologische Theorien des Suizids (vor allem Durkheim), analysiert geschlechtsspezifische und altersspezifische Suizidraten in der EU, erläutert epidemiologische Maßzahlen (Prävalenz, Inzidenz, Mortalität) und deren Anwendung auf Suiziddaten, und untersucht den Einfluss sozialer Integration auf Suizidraten.
Welche soziologischen Theorien werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich hauptsächlich auf Emile Durkheims Theorie der sozialen Integration und deren Weiterentwicklungen. Sie analysiert Durkheims Ansatz, die Kritik daran und die Bedeutung der sozialen Integration, Anomie und des sozialen Wandels für das Verständnis von Suizid.
Welche Daten werden analysiert?
Die Arbeit analysiert statistische Daten zu geschlechtsspezifischen und altersspezifischen Suizidraten in der Europäischen Union. Die Ergebnisse werden im Kontext der soziologischen Theorien interpretiert.
Welche epidemiologischen Maßzahlen werden verwendet?
Die Arbeit erläutert und verwendet grundlegende epidemiologische Maßzahlen wie Prävalenz, Inzidenz und Mortalität. Sie betont die Bedeutung der Mortalität als Hauptmaßzahl für Suizid und diskutiert die Notwendigkeit von Standardisierungen zur Verbesserung der Vergleichbarkeit von Daten.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit umfasst eine Einleitung, ein Kapitel zu epidemiologischen Maßzahlen, ein Kapitel zu soziologischen Theorien (Schwerpunkt Durkheim), ein Kapitel zur empirischen Analyse der Suizidraten und ein Fazit. Ein Inhaltsverzeichnis und eine Zusammenfassung der Kapitel sind enthalten.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Suizid, Soziologie, Emile Durkheim, soziale Integration, Anomie, Selbsttötung, Epidemiologie, Prävalenz, Inzidenz, Mortalität, Altersstandardisierung, Geschlechtsspezifische Suizidraten, Altersspezifische Suizidraten, Europäische Union, statistische Soziologie.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Das Ziel ist es, den sozialen Kontext als wichtigen Einflussfaktor für Suizide in der EU zu beleuchten und die Zusammenhänge zwischen Suizid und sozialen Faktoren zu erforschen.
Details
- Titel
- Die soziale Dimension von Suizidraten
- Untertitel
- Am Beispiel der Staaten der Europäischen Union
- Hochschule
- Eberhard-Karls-Universität Tübingen (Institut für Soziologie)
- Note
- 1,7
- Autor
- Robin Ostrowski (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2014
- Seiten
- 44
- Katalognummer
- V293237
- ISBN (eBook)
- 9783656906612
- ISBN (Buch)
- 9783656906629
- Dateigröße
- 851 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Suizid Suizidraten Durkheim WHO Altersspezifische Suizidraten Geschlechtssepzifische Suizidraten Epidemiologie Soziale Integration Sozialer Wandel Soziale Ordnung Todesursachenstatistik Anomie Europa Europäische Union Werte Normen
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 19,99
- Preis (Book)
- US$ 28,99
- Arbeit zitieren
- Robin Ostrowski (Autor:in), 2014, Die soziale Dimension von Suizidraten, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/293237
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-