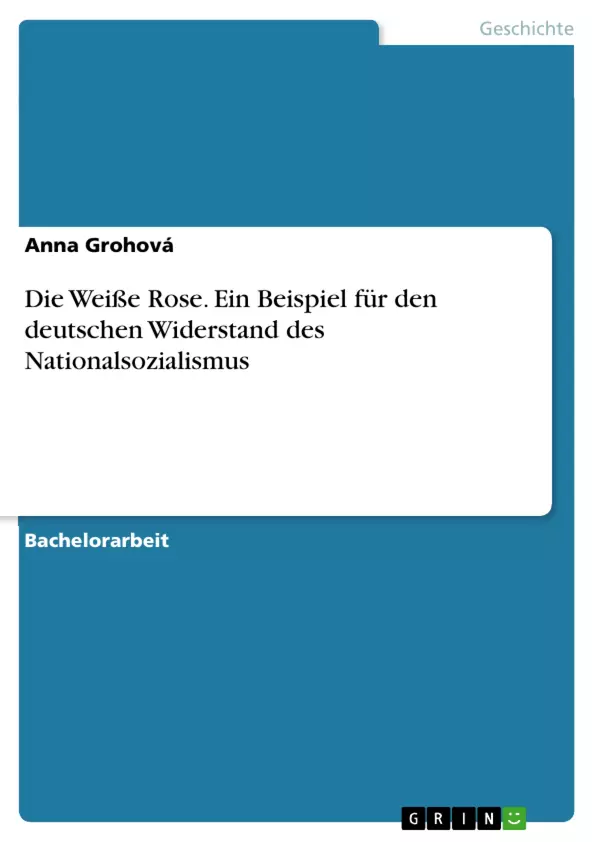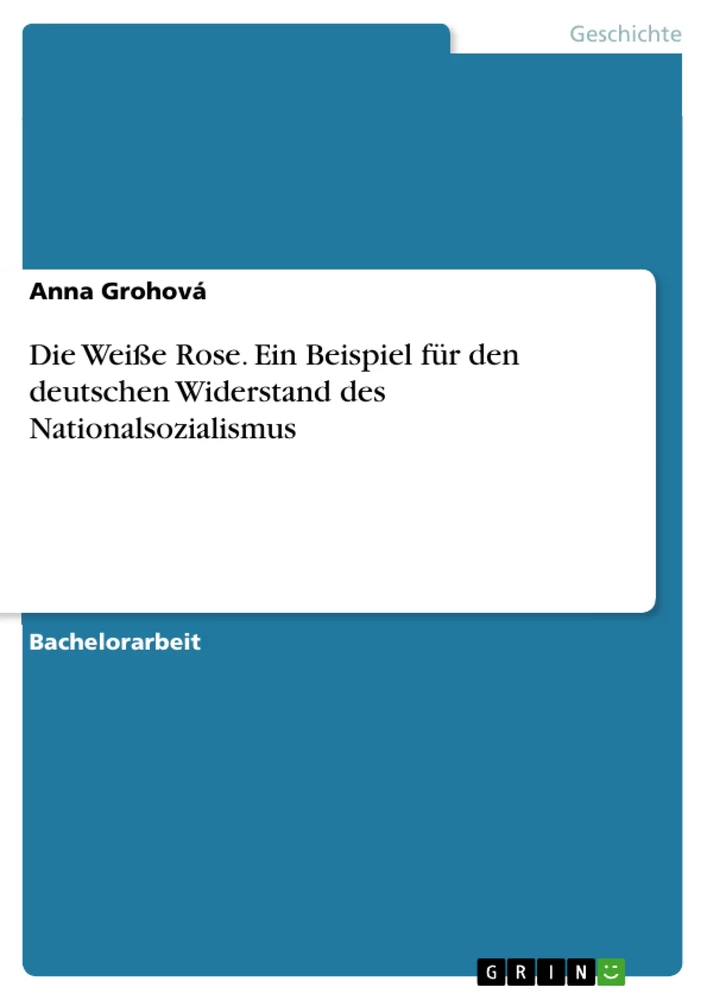
Die Weiße Rose. Ein Beispiel für den deutschen Widerstand des Nationalsozialismus
Bachelorarbeit, 2014
54 Seiten, Note: 1,0
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung.
- 2. Situation in Deutschland 1918 – 1945...
- 2.1 Ereignisse in der Politik.....
- 2.2 Alltag und Lebensstandard während der Zeit des NS-Regimes.
- 2.3 Widerstand gegen die NS-Diktatur.……....
- 3. Widerstandsgruppe Weiße Rose
- 3.1 Mitglieder der Gruppe und deren ursprüngliche Motivation für den Widerstand.....
- 3.2 Spätere Motivation für den Widerstand..\n.
- 3.3 Tätigkeit der Gruppe „Weiße Rose\".
- 4. Die Weiße-Rose-Prozesse und ihre Folgen
- 4.1 Gerichtsverhandlungen gegen Mitglieder und Unterstützer der Weißen Rose
- 4.2 Reaktionen auf die Prozesse.\n.
- 5. Nachlass der Weißen Rose im heutigen Deutschland .\n.
- 5.1 Institutionen.....
- 5.2 Gedenkfeier
- 5.3 Weiße Rose im Internet
- 5.4 Geschwister-Scholl-Preis ...\n.
- 6. Zusammenfassung.
- 7. Resumé ....
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Widerstandsgruppe Weiße Rose und ihrer Rolle im Kampf gegen das NS-Regime. Sie beleuchtet die historischen Umstände, die zur Entstehung des Widerstandes führten, sowie die Motivation und Aktivitäten der Gruppe. Die Arbeit analysiert die Gerichtsprozesse gegen die Mitglieder der Weißen Rose und untersucht den Nachlass der Gruppe im heutigen Deutschland.
- Historische Entwicklung des Widerstandes in Deutschland während der Zeit des Nationalsozialismus
- Motivation und Aktivitäten der Widerstandsgruppe Weiße Rose
- Analyse der Gerichtsprozesse gegen die Mitglieder der Weißen Rose
- Nachlass und Bedeutung der Weißen Rose im heutigen Deutschland
- Die Rolle von Studenten und Intellektuellen im Widerstand
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Widerstandsgruppe Weiße Rose ein und beschreibt die Ziele und den Aufbau der Arbeit. Kapitel 2 beleuchtet die historische Situation in Deutschland von 1918 bis 1945, einschließlich der politischen Ereignisse, des Alltagslebens und der Entwicklung des Widerstandes. Kapitel 3 konzentriert sich auf die Widerstandsgruppe Weiße Rose, ihre Mitglieder, ihre Motivation und ihre Aktivitäten. Kapitel 4 analysiert die Gerichtsprozesse gegen die Mitglieder der Weißen Rose und die Reaktionen auf diese Prozesse. Kapitel 5 untersucht den Nachlass der Weißen Rose im heutigen Deutschland, einschließlich ihrer Institutionen, Gedenkfeiern, Präsenz im Internet und des Geschwister-Scholl-Preises.
Schlüsselwörter
Die Arbeit behandelt die Themenbereiche Weiße Rose, Nationalsozialismus, Widerstand, Jugendopposition, Gerichtsverhandlung, Nachlass, Erinnerungskultur und Zeitgeschichte.
Details
- Titel
- Die Weiße Rose. Ein Beispiel für den deutschen Widerstand des Nationalsozialismus
- Veranstaltung
- Universität Pardubice
- Note
- 1,0
- Autor
- Anna Grohová (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2014
- Seiten
- 54
- Katalognummer
- V295800
- ISBN (eBook)
- 9783656946816
- ISBN (Buch)
- 9783656946823
- Dateigröße
- 986 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Weiße Rose Nationalsozialismus Widerstand Jugendopposition Gerichtsverhandlung
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 20,99
- Preis (Book)
- US$ 29,99
- Arbeit zitieren
- Anna Grohová (Autor:in), 2014, Die Weiße Rose. Ein Beispiel für den deutschen Widerstand des Nationalsozialismus, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/295800
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-