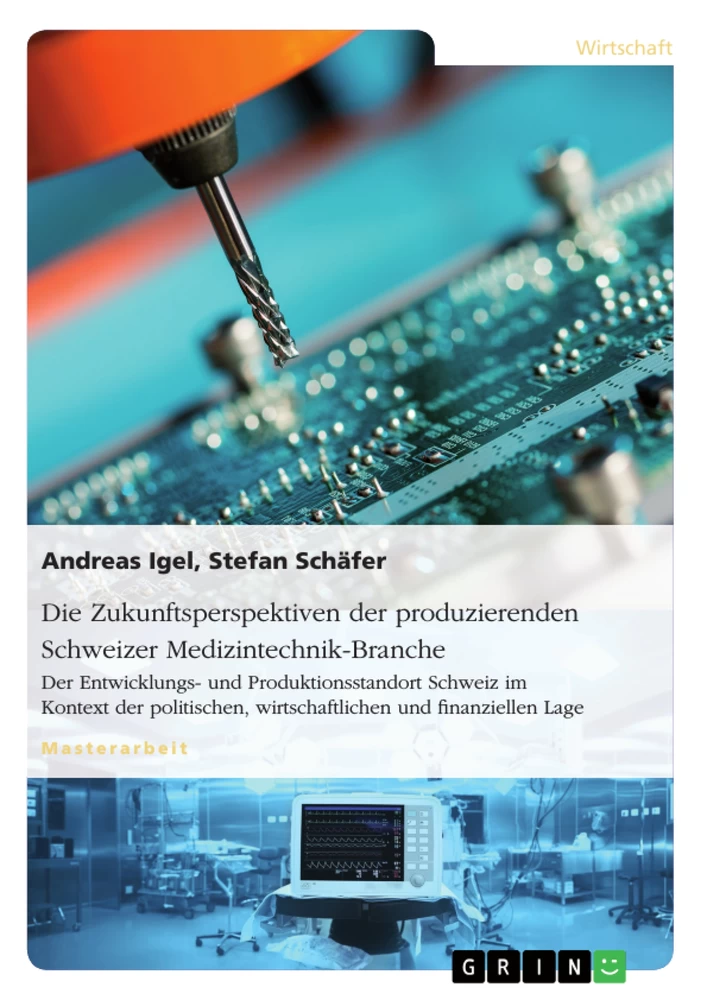
Die Zukunftsperspektiven der produzierenden Schweizer Medizintechnik-Branche
Masterarbeit, 2015
184 Seiten, Note: 1,0
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Abstract
- Danksagung
- Über die Autoren
- Eigenständigkeitserklärung
- 1 Einleitung
- 1.1 Problemdefinition und Forschungsfragen
- 1.2 Zielsetzung und Aufbau der Arbeit
- 2 Theoretische Grundlagen
- 2.1 Medizintechnik-Branche Schweiz
- 2.2 Schweizer Wirtschaft im Wandel
- 2.3 Strategisches Management
- 2.4 Wettbewerbsvorteile
- 2.5 Gesundheitspolitik und Gesundheitswesen
- 2.6 Investitionsentscheidungen
- 2.7 Die Bedeutung von Human Resources
- 3 Empirische Untersuchung
- 3.1 Methodik der Datenerhebung und -auswertung
- 3.2 Ergebnisse der Experteninterviews
- 3.3 Ergebnisse der Mitarbeiterbefragung
- 3.4 Zusammenfassung der Ergebnisse
- 4 Diskussion und Interpretation der Ergebnisse
- 4.1 Diskussion der Ergebnisse im Kontext der Forschungsfragen
- 4.2 Chancen und Risiken der Schweizer Medizintechnik-Branche
- 4.3 Handlungsempfehlungen für die Schweizer Medizintechnik-Branche
- 5 Schlussfolgerung
- 5.1 Zusammenfassung der Ergebnisse
- 5.2 Ausblick und Empfehlungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Master-Thesis untersucht die Zukunftsperspektiven der Schweizer Medizintechnik-Branche im Kontext der politischen, wirtschaftlichen und finanziellen Rahmenbedingungen. Sie analysiert die Entwicklungen der Branche und der Volkswirtschaft, beleuchtet die Zusammenhänge mit aktuellen politischen Themen und beantwortet drei Forschungsfragen:
- Welche Bereiche der Wertschöpfungskette bieten die besten Zukunftsperspektiven für die produzierende Medizintechnik-Industrie der Schweiz?
- Welche Massnahmen sind notwendig, um das Vertrauen der Investoren in die produzierende Medizintechnik-Industrie der Schweiz zu stärken?
- Welche Rahmenbedingungen sind für den Ausbau oder die Ansiedlung von produzierenden Medizintechnik-Unternehmen zu schaffen?
Die Arbeit identifiziert und analysiert die wichtigsten Herausforderungen und Chancen für die Branche, wie den Einfluss des starken Frankens, die Veränderungen in der Zuwanderungspolitik und die Bedeutung von Innovation und Forschung & Entwicklung.
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 führt in das Thema ein, definiert die Problematik und die Forschungsfragen, die im Verlauf der Arbeit beantwortet werden. Kapitel 2 beleuchtet die theoretischen Grundlagen, die für das Verständnis der Branche und ihrer Herausforderungen relevant sind. Kapitel 3 präsentiert die empirische Untersuchung, die auf Experteninterviews und einer Mitarbeiterbefragung basiert. Kapitel 4 diskutiert und interpretiert die Ergebnisse der Untersuchung und zieht daraus Schlussfolgerungen. Kapitel 5 fasst die Ergebnisse der Arbeit zusammen, gibt einen Ausblick auf die Zukunft der Branche und formuliert Empfehlungen für Unternehmen und Politik.
Schlüsselwörter
Medizintechnik, Schweiz, Zukunftsperspektiven, Wirtschaft, Politik, Investitionen, Innovation, Forschung & Entwicklung, Wertschöpfungskette, Wettbewerbsvorteile, Human Resources, Experteninterviews, Mitarbeiterbefragung.
Häufig gestellte Fragen
Warum gilt die Medizintechnik als „Perle der Schweizer Wirtschaft“?
Die Branche ist hoch spezialisiert, trägt massgeblich zum Bruttoinlandprodukt und Exportvolumen bei und bietet zahlreiche Arbeitsplätze für hoch qualifizierte Fachkräfte.
Welchen Einfluss hat der starke Franken auf die Branche?
Ein anhaltend starker Franken verteuert Schweizer Produkte im Ausland, was den Margendruck erhöht und Unternehmen dazu zwingt, ihre Effizienz zu steigern oder Teile der Produktion ins Ausland zu verlagern.
Wie wirkt sich die Zuwanderungspolitik auf Medtech-Unternehmen aus?
Veränderungen in der Zuwanderungspolitik können den Zugang zu internationalen Fachkräften erschweren, was für eine forschungsintensive Branche wie die Medizintechnik ein erhebliches Risiko darstellt.
Wird die Schweiz ein Produktionsstandort bleiben?
Die Autoren stellen die Hypothese auf, dass sich die Schweiz von einem reinen Produktionsstandort zu einem Wissens-Zentrum entwickeln wird, während die klassische Produktion zunehmend in die Absatzmärkte verlagert wird.
Welche Rolle spielen Innovation und Forschung?
Innovation ist der entscheidende Wettbewerbsvorteil. Um am Standort Schweiz erfolgreich zu bleiben, müssen Unternehmen kontinuierlich in Forschung und Entwicklung investieren, um hochmargige Spezialprodukte anzubieten.
Details
- Titel
- Die Zukunftsperspektiven der produzierenden Schweizer Medizintechnik-Branche
- Untertitel
- Der Entwicklungs- und Produktionsstandort Schweiz im Kontext der politischen, wirtschaftlichen und finanziellen Lage
- Note
- 1,0
- Autoren
- Andreas Igel (Autor:in), Stefan Schäfer (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2015
- Seiten
- 184
- Katalognummer
- V299678
- ISBN (eBook)
- 9783656959786
- ISBN (Buch)
- 9783656959793
- Dateigröße
- 6390 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- zukunftsperspektiven schweizer medizintechnik-branche unter einfluss lage hinblick entwicklungs- produktionsstandort schweiz
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 42,99
- Preis (Book)
- US$ 56,99
- Arbeit zitieren
- Andreas Igel (Autor:in), Stefan Schäfer (Autor:in), 2015, Die Zukunftsperspektiven der produzierenden Schweizer Medizintechnik-Branche, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/299678
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-









