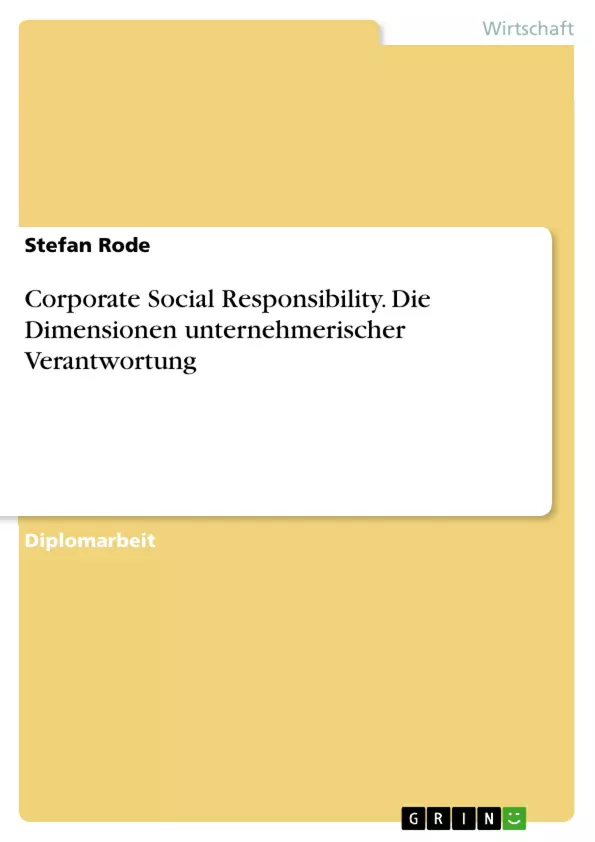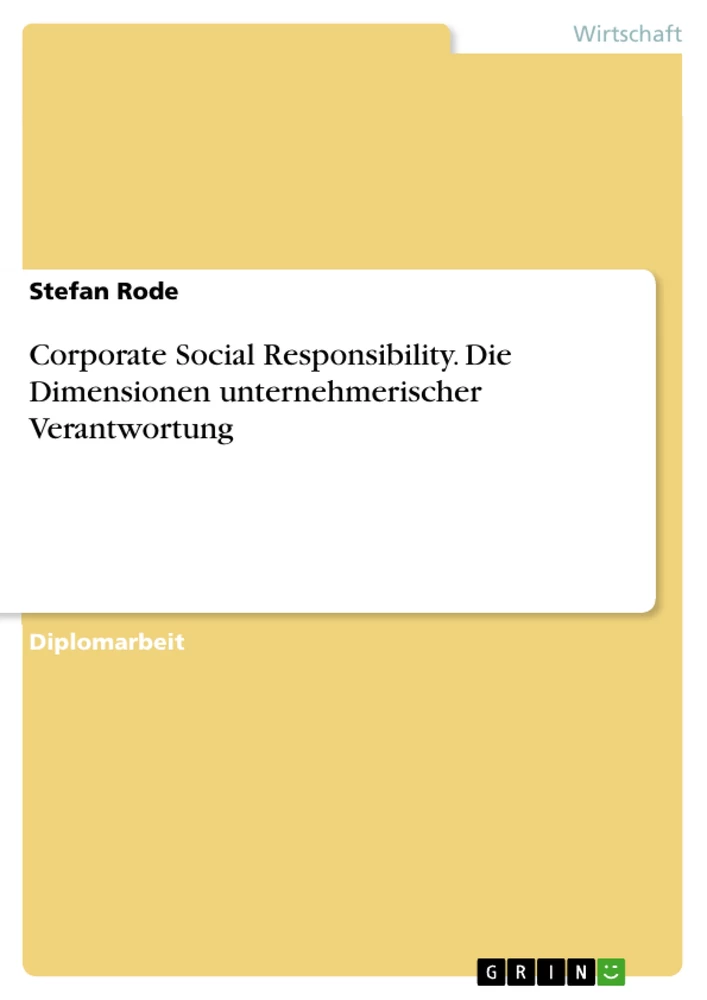
Corporate Social Responsibility. Die Dimensionen unternehmerischer Verantwortung
Diplomarbeit, 2012
46 Seiten, Note: 1,0
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- 1. Einleitung
- 2. Corporate Social Responsibility
- 2.1 Problemstellung
- 2.2 Begriffsbestimmung und Dimensionen
- 2.2.1 Frühe angelsächsische Auslegung (1950 – 1990)
- 2.2.2 Derzeitige deutsche Auslegung (2000 - 2011)
- 2.2.3 Institutionalisierung von CSR
- 2.2.3.1 Aktionsplan CSR (Bundesregierung)
- 2.2.3.2 ISO 26000
- 2.3 CSR und Nachhaltigkeitsmanagement in Abgrenzung
- 2.3.1 Begriff der Nachhaltigkeit
- 2.3.2 Überschneidungen von CSR und Nachhaltigkeitsmanagement
- 2.3.3 Unterschiede zwischen CSR und Nachhaltigkeitsmanagement
- 3. Margarethenhöhe in Essen
- 3.1 Stiftungsphilosophie und Historie
- 3.2 Architektur und Lage
- 3.3 Margarethe Krupp-Stiftung für Wohnungsfürsorge
- 3.3.1 Portfolio der Margarethe Krupp-Stifung für Wohnungsfürsorge
- 3.3.2 Heutige Tätigkeit der Margarethe Krupp-Stiftung für Wohnungsfürsorge
- 4. Margarethenhöhe im Kontext von CSR
- 4.1 Einbettung in CSR-Konzepte
- 4.1.1 Ökonomische Aspekte
- 4.1.2 Soziale Aspekte
- 4.1.3 Ökologische Aspekte
- 4.2 Zusammenfassende Bewertung der Margarethenhöhe im Kontext von CSR
- 4.1 Einbettung in CSR-Konzepte
- 5. Schlussbetrachtung: Denkmal und Verantwortung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Die Arbeit analysiert den Begriff der „Corporate Social Responsibility“ (CSR) und untersucht die Einbettung des historischen Wohnungsbauprojekts Margarethenhöhe in Essen in aktuelle CSR-Konzepte. Sie beleuchtet die historische Entwicklung des CSR-Begriffs und dessen Dimensionen, um die Margarethenhöhe im Kontext von ökonomischen, sozialen und ökologischen Aspekten der unternehmerischen Verantwortung zu bewerten.
- Historische Entwicklung des CSR-Begriffs
- Dimensionen und Auslegung von CSR
- Zusammenhang von CSR und Nachhaltigkeit
- Die Margarethenhöhe als Beispiel für unternehmerische Verantwortung
- Bewertung der Margarethenhöhe im Kontext von CSR-Kriterien
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Relevanz von CSR im heutigen Kontext beleuchtet und die zentrale Fragestellung der Arbeit definiert. Kapitel 2 analysiert den Begriff der CSR und seine historische Entwicklung, von frühen angelsächsischen bis zu den aktuellen deutschen Auslegungen. Es beleuchtet die Institutionalisierung von CSR durch den Aktionsplan CSR der Bundesregierung und die ISO 26000-Norm. Kapitel 3 widmet sich der Margarethenhöhe in Essen, beleuchtet ihre Stiftungsphilosophie und Geschichte, sowie die Architektur und Lage. Es beschreibt die Aktivitäten der Margarethe Krupp-Stiftung für Wohnungsfürsorge und deren Portfolio. Kapitel 4 untersucht die Einbettung der Margarethenhöhe in CSR-Konzepte und analysiert ihre ökonomischen, sozialen und ökologischen Aspekte. Schließlich stellt Kapitel 5 eine Schlussbetrachtung dar, die den historischen Aspekt der Margarethenhöhe mit dem aktuellen Verständnis von CSR in Beziehung setzt.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die Arbeit befasst sich mit den zentralen Themen der Corporate Social Responsibility (CSR), der Nachhaltigkeit, der historischen Entwicklung von CSR-Konzepten, der Einbettung von CSR in der Wohnungswirtschaft, und der Margarethenhöhe in Essen als Beispiel für unternehmerische Verantwortung. Dabei werden zentrale Begriffe wie „frühe angelsächsische Auslegung“, „derzeitige deutsche Auslegung“, „Aktionsplan CSR“, „ISO 26000“, „Nachhaltigkeitsmanagement“, „Margarethe Krupp-Stiftung für Wohnungsfürsorge“ und „Gartenstadt“ im Kontext der CSR analysiert.
Details
- Titel
- Corporate Social Responsibility. Die Dimensionen unternehmerischer Verantwortung
- Note
- 1,0
- Autor
- Stefan Rode (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2012
- Seiten
- 46
- Katalognummer
- V301436
- ISBN (eBook)
- 9783656979111
- ISBN (Buch)
- 9783656979128
- Dateigröße
- 2583 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- corporate social responsibility dimensionen verantwortung
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 19,99
- Preis (Book)
- US$ 29,99
- Arbeit zitieren
- Stefan Rode (Autor:in), 2012, Corporate Social Responsibility. Die Dimensionen unternehmerischer Verantwortung, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/301436
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-