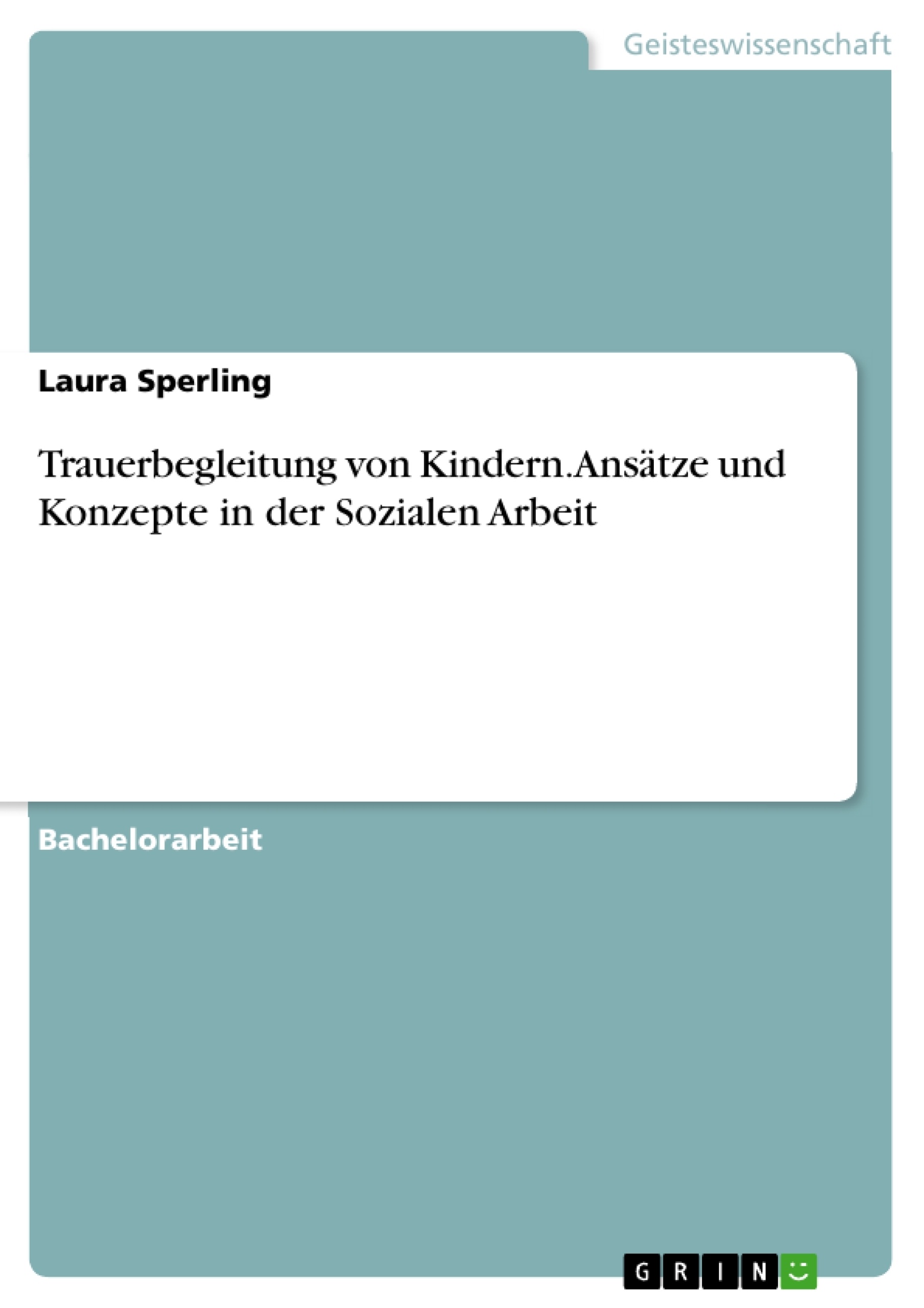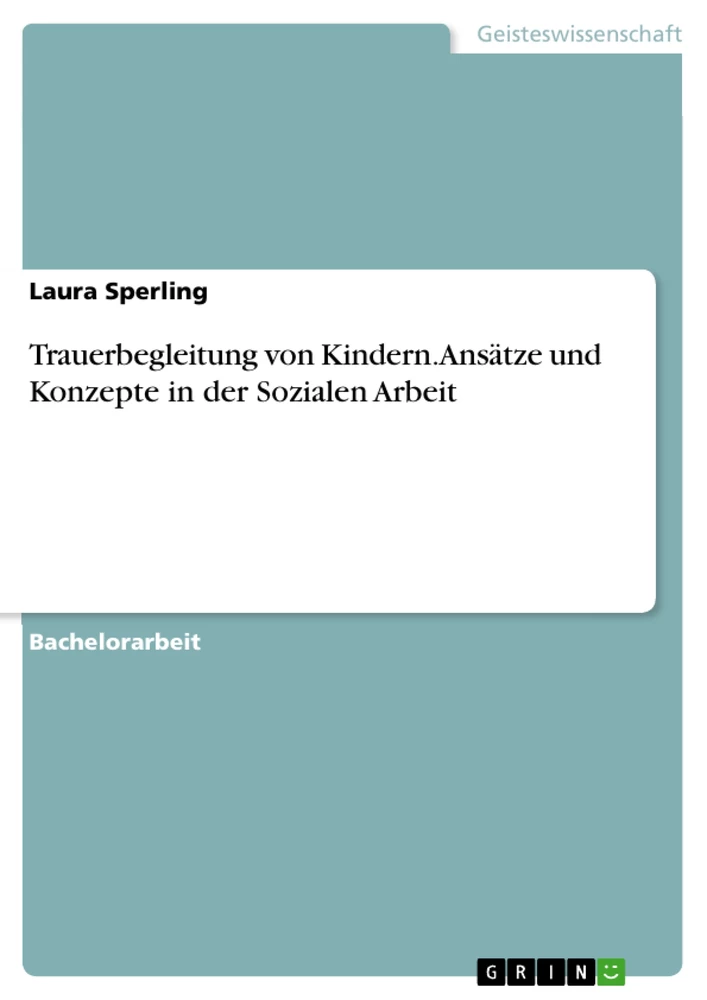
Trauerbegleitung von Kindern. Ansätze und Konzepte in der Sozialen Arbeit
Bachelorarbeit, 2015
59 Seiten
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Wie sehen Kinder den Tod?
- Wichtige Aspekte der kindlichen Entwicklung im Bezug auf Tod und Trauer
- Todesvorstellung von Kindern
- Todesvorstellung von Kindern im Alter von 0 bis 3
- Todesvorstellung von Kindern im Alter von 3 bis 6
- Todesvorstellung von Kindern im Alter von 6 bis 10
- Todesfälle
- Tod einer nahen Bezugsperson
- Tod im weiteren Umfeld des Kindes
- Was ist kindliche Trauer?
- Definition Trauer
- Trauerphasen
- Trauerphasen nach Verena Kast
- Trauerprozess bei Kindern im Grundschulalter
- Erscheinungsformen kindlicher Trauer
- Traurigkeit
- Empfindungslosigkeit
- Wechsel zwischen Traurigkeit und Fröhlichkeit
- Körperliche Reaktionen
- Wut
- Schuldgefühle
- Angst
- Regression
- Erinnerung und Sehnsucht
- Wünsche
- Abgrenzung von der Trauer Erwachsener
- Begleitung trauernder Kinder in der Sozialen Arbeit
- Trauerarbeit - was ist das?
- Trauerbegleitung
- Was Kinder in der Trauer benötigen
- Folgen nicht bewältigter Trauer
- Rolle des Trauerbegleiters
- Begleitung durch Beratung der Eltern
- Begleitung durch pädagogische Ansätze
- Gespräche mit dem Kind
- Arbeit mit Ritualen
- Kreative Möglichkeiten der Trauerarbeit
- Anwendung von Kinderliteratur
- Einzelbegleitung
- Kindertrauergruppen
- Weitere Ansätze
- Begleitung durch das Konzept DellTha
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Bachelorarbeit befasst sich mit der Trauerbegleitung von Kindern im Fall des Todes eines geliebten Menschen. Ziel ist es, herauszuarbeiten, wie die Trauerbegleitung von Kindern aussehen kann. Die zentralen Fragen hierbei sind: Woran erkennt man die Trauer eines Kindes? Wozu ist eine Begleitung in der Trauer notwendig? Inwiefern kann die Soziale Arbeit durch Beratung und Begleitung dem Kind bei der Trauerbewältigung helfen?
- Entwicklung der Todesvorstellung bei Kindern
- Erscheinungsformen kindlicher Trauer
- Bedeutung der Trauerbegleitung für Kinder
- Methoden der Trauerarbeit in der Sozialen Arbeit
- Rolle von Beratung und Begleitung für Kinder und Eltern
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Thema der Arbeit vor und erläutert die persönliche Motivation der Autorin. Kapitel 2 behandelt die kindliche Vorstellung vom Tod und untersucht die verschiedenen Stadien der Todesvorstellung in unterschiedlichen Altersgruppen. Kapitel 3 widmet sich der kindlichen Trauer, definiert den Begriff und untersucht die Unterschiede zwischen kindlicher Trauer und der von Erwachsenen. Des Weiteren werden verschiedene Reaktionen von Kindern auf den Tod und Trauerphasen beschrieben. Kapitel 4 befasst sich mit der Begleitung trauernder Kinder in der Sozialen Arbeit. Es wird erläutert, warum Begleitung und Beratung in der Trauer notwendig sind, und die Rolle des Beraters in der Trauerbegleitung wird näher beleuchtet. Außerdem werden verschiedene Methoden der Trauerarbeit in der Sozialen Arbeit vorgestellt, einschließlich der Beratung von Bezugspersonen und der Arbeit mit Kindertrauergruppen. Das Fazit fasst die wichtigsten Erkenntnisse der Arbeit zusammen und bietet eine eigene Einschätzung der Handlungsmöglichkeiten in der Trauerbegleitung von Kindern in der Sozialen Arbeit.
Schlüsselwörter
Kindliche Trauer, Todesvorstellung, Trauerbegleitung, Soziale Arbeit, Beratung, Trauergruppen, Kinderliteratur, DellTha, Trauerphasen, Trauerprozess, Trauerarbeit.
Details
- Titel
- Trauerbegleitung von Kindern. Ansätze und Konzepte in der Sozialen Arbeit
- Autor
- Laura Sperling (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2015
- Seiten
- 59
- Katalognummer
- V301682
- ISBN (eBook)
- 9783668000643
- ISBN (Buch)
- 9783668000650
- Dateigröße
- 661 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- trauerbegleitung kindern ansätze konzepte sozialen arbeit
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 20,99
- Preis (Book)
- US$ 29,99
- Arbeit zitieren
- Laura Sperling (Autor:in), 2015, Trauerbegleitung von Kindern. Ansätze und Konzepte in der Sozialen Arbeit, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/301682
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-