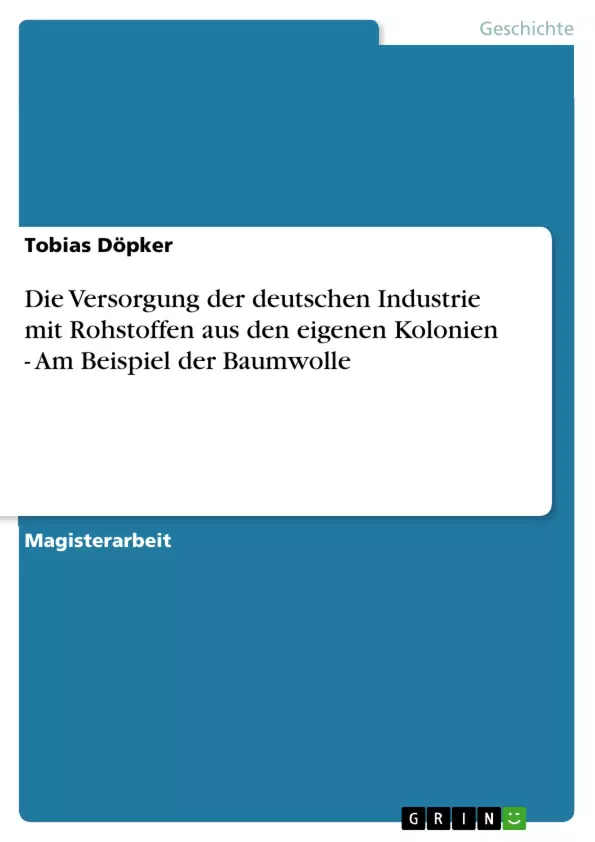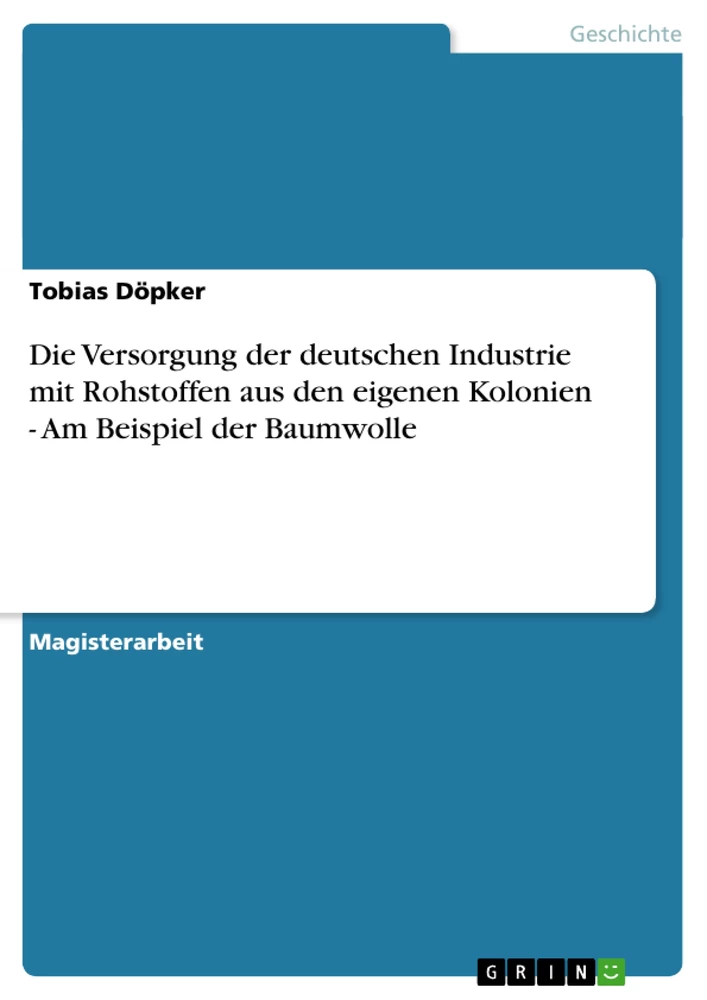
Die Versorgung der deutschen Industrie mit Rohstoffen aus den eigenen Kolonien - Am Beispiel der Baumwolle
Magisterarbeit, 1999
125 Seiten, Note: sehr gut
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- I. DIE BAUMWOLLE - EIN ROHSTOFF VERÄNDERT DIE WELT
- I.1. Die Baumwollproduzenten von 1800 bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts
- I.2. Die deutsche Textilindustrie - Baumwollverbrauch und Beschäftigtenzahlen
- II. „COTTON FAMINE“ - „DIE BAUMWOLL(HUNGERS)NOT“
- II.1. „Tributzahlungen“ an Amerika - Die „Baumwollnot“ in Deutschland
- II.2. Kolonialer Baumwollanbau - Die Antwort auf die Baumwollfrage?
- III. DAS KOLONIAL-WIRTSCHAFTLICHE KOMITEE
- IV. DER BAUMWOLLANBAU IN DEUTSCH-OSTAFRIKA
- IV.1. Die Phase von 1885 - 1902: Erste Pflanzungsversuche der DOAG und der Traum vom „Exportartikel Baumwolle“
- IV.2. Die Phase von 1902 - 1910: Die Nutzbarmachung des Schutzgebietes
- IV.2.1. Der Baumwollanbau durch das KWK - Zielsetzungen und Aktivitäten
- IV.2.1.1. Die Organisationsstruktur und das wissenschaftliche Versuchswesen
- IV.2.1.2. „Preisgarantien und Ginanlagen“ - Unterstützungsmaßnahmen für Einheimische und Siedler
- IV.2.2. Das „cotton scheme“ und der Maji-Maji-Aufstand
- IV.2.3. Reformen und Wirtschaftsansätze nach dem Maji-Maji-Aufstand
- IV.2.3.1. Kolonial-Staatssekretär Dernburgs Reformpläne
- IV.2.3.2. „Am Rufiji ist der Baumwollbau als Volkskultur eingeführt!“ - Die Eingeborenenkultur nach dem Maji-Maji-Aufstand
- IV.2.3.3. Neue Wirtschaftsformen: Weiße Siedler und europäische Plantagen
- IV.2.1. Der Baumwollanbau durch das KWK - Zielsetzungen und Aktivitäten
- Exkurs: Die „Otto-Pflanzung Kilossa“
- IV.3. Die Phase von 1910 - 1914: „Den kolonialen Baumwollbau auf eine breitere Grundlage stellen.“
- IV.3.1. Die Aufgaben der deutschen Kolonialverwaltung
- IV.3.2. Die Arbeit des Kolonial-Wirtschaftlichen Komitees nach 1910
- IV.4. Zwischenergebnis
- V. DER BAUMWOLLANBAU IN WESTAFRIKA
- V.1. Togo - Ein „deutsches Ägypten“?
- V.2. Kamerun - Neuer Hoffnungsträger in Westafrika
- VI. DER BAUMWOLLANBAU IN DEN ÜBRIGEN SCHUTZGEBIETEN
- VI.1. Deutsch-Südwestafrika
- VI.2. Die Südseebesitzungen
- VI.3. Das Pachtgebiet Kiautschou
- VII. EXKURS: MISSION UND BAUMWOLLANBAU
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Versorgung der deutschen Industrie mit Baumwolle aus den deutschen Kolonien im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert. Sie analysiert die Herausforderungen und Strategien, die mit dem Aufbau eines kolonialen Baumwollanbaus verbunden waren.
- Die Bedeutung von Baumwolle als Rohstoff für die deutsche Textilindustrie
- Die "Baumwollnot" und die Abhängigkeit Deutschlands von amerikanischen Baumwollimporten
- Die Rolle des Kolonial-Wirtschaftlichen Komitees und anderer Institutionen im kolonialen Baumwollanbau
- Der Baumwollanbau in Deutsch-Ostafrika, Westafrika und anderen deutschen Schutzgebieten
- Der Einfluss des kolonialen Baumwollanbaus auf die einheimische Bevölkerung und die koloniale Politik
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung stellt die These auf, dass die Beschaffung von Rohstoffen, insbesondere Baumwolle, aus Kolonien ein wichtiges Argument für die deutsche Kolonialpolitik war. Sie verortet die Arbeit im Kontext der sich entwickelnden deutschen Industrie und dem steigenden Bedarf an Baumwolle, der durch die Industrialisierung und die zunehmende Nachfrage nach Textilien entstand. Die Einleitung betont den Wandel von Baumwolle von einem Luxusgut zu einem Massenartikel und die damit verbundenen ökonomischen Implikationen für Deutschland.
I. DIE BAUMWOLLE - EIN ROHSTOFF VERÄNDERT DIE WELT: Dieses Kapitel untersucht die Entwicklung der Baumwollproduktion und den steigenden Bedarf der deutschen Textilindustrie. Es beleuchtet die Abhängigkeit von Importen und die damit verbundenen Kosten, die den Anstoß für die Suche nach alternativen Quellen in den deutschen Kolonien gaben. Es legt den Grundstein für die darauffolgenden Kapitel, die detaillierter auf die kolonialen Bemühungen zur Baumwollproduktion eingehen.
II. „COTTON FAMINE“ - „DIE BAUMWOLL(HUNGERS)NOT“: Dieses Kapitel beschreibt die sogenannte „Baumwollnot“ in Deutschland, verursacht durch die Abhängigkeit von amerikanischen Baumwollimporten. Die wirtschaftlichen Konsequenzen und der politische Druck, die durch diese Abhängigkeit entstanden, werden erläutert. Das Kapitel stellt die koloniale Baumwollproduktion als potenzielle Lösung für dieses Problem vor und leitet somit den Fokus auf die folgenden Kapitel über den kolonialen Baumwollanbau in verschiedenen deutschen Schutzgebieten.
III. DAS KOLONIAL-WIRTSCHAFTLICHE KOMITEE: Dieses Kapitel widmet sich der Organisation und den Aktivitäten des Kolonial-Wirtschaftlichen Komitees (KWK), einer zentralen Institution in der deutschen Kolonialverwaltung, die maßgeblich an der Förderung des kolonialen Baumwollanbaus beteiligt war. Seine Struktur, seine Ziele und seine Rolle bei der Koordinierung der Anstrengungen zur Baumwollproduktion werden analysiert. Dies bildet den institutionellen Rahmen für die folgenden Kapitel, die den Baumwollanbau in einzelnen Kolonien detailliert untersuchen.
IV. DER BAUMWOLLANBAU IN DEUTSCH-OSTAFRIKA: Dieses Kapitel analysiert die Entwicklung des Baumwollanbaus in Deutsch-Ostafrika über verschiedene Phasen hinweg. Es beschreibt die anfänglichen Schwierigkeiten, die Fortschritte durch die Arbeit des KWK und den Einfluss des Maji-Maji-Aufstands auf die kolonialen Wirtschaftspläne. Es verdeutlicht die Herausforderungen und Erfolge bei der Etablierung einer nachhaltigen Baumwollproduktion in der Kolonie, in Verbindung mit den politischen und sozialen Folgen.
V. DER BAUMWOLLANBAU IN WESTAFRIKA: Das Kapitel behandelt die Bemühungen um den Baumwollanbau in den deutschen Kolonien Togo und Kamerun. Es wird der Vergleich mit anderen Kolonialmächten gezogen und die jeweiligen Erfolgsaussichten und Herausforderungen für die deutsche Kolonialverwaltung beleuchtet. Der Fokus liegt auf den spezifischen Bedingungen in diesen Gebieten und der Anpassung der Strategien an die lokalen Gegebenheiten.
VI. DER BAUMWOLLANBAU IN DEN ÜBRIGEN SCHUTZGEBIETEN: Dieses Kapitel bietet einen Überblick über den Baumwollanbau in den übrigen deutschen Schutzgebieten, darunter Deutsch-Südwestafrika, die Südseebesitzungen und Kiautschou. Es fasst die wichtigsten Aspekte des Baumwollanbaus in diesen Regionen zusammen und stellt die Unterschiede zu den zuvor behandelten Gebieten heraus.
VII. EXKURS: MISSION UND BAUMWOLLANBAU: Dieses Kapitel analysiert die Beziehung zwischen der Missionsarbeit und dem kolonialen Baumwollanbau, beleuchtet die jeweiligen Rollen und die Interaktion zwischen religiösen Institutionen und den kolonialen Wirtschaftsplänen. Es befasst sich mit den möglichen Synergien und Konflikten zwischen diesen beiden Sphären.
Schlüsselwörter
Baumwolle, Kolonialismus, deutsche Kolonialgeschichte, Textilindustrie, Rohstoffversorgung, Deutsch-Ostafrika, Westafrika, Kolonialwirtschaft, Maji-Maji-Aufstand, Kolonial-Wirtschaftliches Komitee (KWK), DOAG, Abhängigkeit von Importen, Industrialisierung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Die deutsche Kolonialwirtschaft und der Baumwollanbau
Was ist der Hauptfokus dieser Arbeit?
Diese Hausarbeit untersucht die Bemühungen des Deutschen Kaiserreichs, seine Textilindustrie durch den Anbau von Baumwolle in seinen Kolonien im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert zu versorgen. Sie analysiert die Herausforderungen und Strategien, die mit dem Aufbau einer kolonialen Baumwollproduktion verbunden waren, und deren Auswirkungen auf die koloniale Politik und die einheimische Bevölkerung.
Warum war Baumwolle für Deutschland so wichtig?
Baumwolle war ein essentieller Rohstoff für die deutsche Textilindustrie. Die zunehmende Industrialisierung und der steigende Bedarf an Textilien führten zu einer starken Abhängigkeit von Importen, vor allem aus den USA. Diese Abhängigkeit galt es zu reduzieren, um die Versorgungssicherheit und die wirtschaftliche Unabhängigkeit Deutschlands zu gewährleisten.
Was war die „Baumwollnot“?
Die „Baumwollnot“ beschreibt die wirtschaftliche Krise, die durch die Abhängigkeit Deutschlands von amerikanischen Baumwollimporten entstand. Diese Abhängigkeit machte Deutschland anfällig für Preisschwankungen und Lieferengpässe, was zu wirtschaftlichen Schwierigkeiten und politischem Druck führte. Die Suche nach alternativen Bezugsquellen, insbesondere in den deutschen Kolonien, wurde daher zu einem zentralen Anliegen.
Welche Rolle spielte das Kolonial-Wirtschaftliche Komitee (KWK)?
Das KWK war eine zentrale Institution der deutschen Kolonialverwaltung, die den Aufbau des kolonialen Baumwollanbaus maßgeblich förderte. Es koordinierte die Anstrengungen, unterstützte den Anbau durch verschiedene Maßnahmen (z.B. Preisgarantien) und spielte eine Schlüsselrolle bei der Umsetzung der kolonialen Wirtschaftspolitik.
Wo wurde Baumwolle in den deutschen Kolonien angebaut?
Der Baumwollanbau wurde in verschiedenen deutschen Kolonien betrieben, hauptsächlich in Deutsch-Ostafrika, aber auch in Westafrika (Togo und Kamerun), Deutsch-Südwestafrika, den Südseebesitzungen und Kiautschou. Die Arbeit beschreibt die spezifischen Bedingungen und Herausforderungen in jedem Gebiet.
Welche Herausforderungen gab es beim kolonialen Baumwollanbau?
Der Aufbau einer erfolgreichen Baumwollproduktion in den Kolonien war mit zahlreichen Herausforderungen verbunden. Dazu gehörten klimatische Bedingungen, die mangelnde Erfahrung der einheimischen Bevölkerung im großflächigen Baumwollanbau, die Organisation der Produktion und des Transports sowie politische Konflikte, wie der Maji-Maji-Aufstand in Deutsch-Ostafrika.
Wie wirkte sich der koloniale Baumwollanbau auf die einheimische Bevölkerung aus?
Die Auswirkungen des kolonialen Baumwollanbaus auf die einheimische Bevölkerung waren komplex und oft negativ. Die Arbeit untersucht den Einfluss auf die Lebensbedingungen, die Arbeitsbedingungen und die soziale Struktur der betroffenen Bevölkerungsgruppen im Kontext des Maji-Maji-Aufstands und der kolonialen Politik.
Welche weiteren Themen werden in der Arbeit behandelt?
Neben den oben genannten Punkten werden auch die Rolle der Missionen im kolonialen Baumwollanbau, die Entwicklung verschiedener Wirtschaftsformen (z.B. weiße Siedler versus einheimische Bauern) und der Vergleich des deutschen Kolonial-Baumwollanbaus mit dem anderer Kolonialmächte behandelt. Die Arbeit bietet einen umfassenden Einblick in die deutsche Kolonialwirtschaft und ihre Bemühungen um die Rohstoffversorgung im Kontext des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts.
Details
- Titel
- Die Versorgung der deutschen Industrie mit Rohstoffen aus den eigenen Kolonien - Am Beispiel der Baumwolle
- Hochschule
- Universität Münster (Historisches Seminar - Philosophische Fakultät)
- Note
- sehr gut
- Autor
- Tobias Döpker (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 1999
- Seiten
- 125
- Katalognummer
- V30183
- ISBN (eBook)
- 9783638315029
- Dateigröße
- 4365 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Versorgung Industrie Rohstoffen Kolonien Beispiel Baumwolle
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 38,99
- Arbeit zitieren
- Tobias Döpker (Autor:in), 1999, Die Versorgung der deutschen Industrie mit Rohstoffen aus den eigenen Kolonien - Am Beispiel der Baumwolle, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/30183
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-