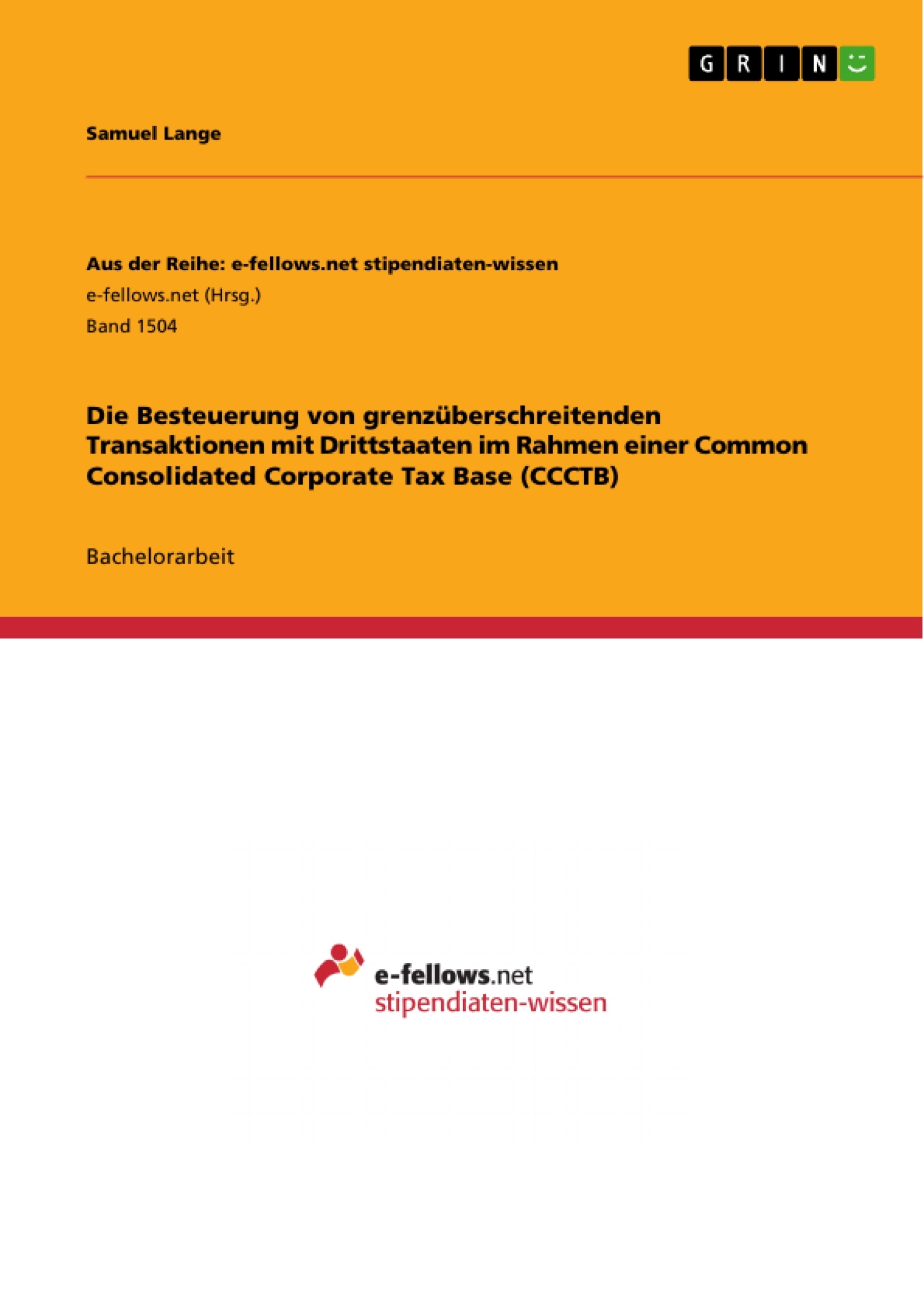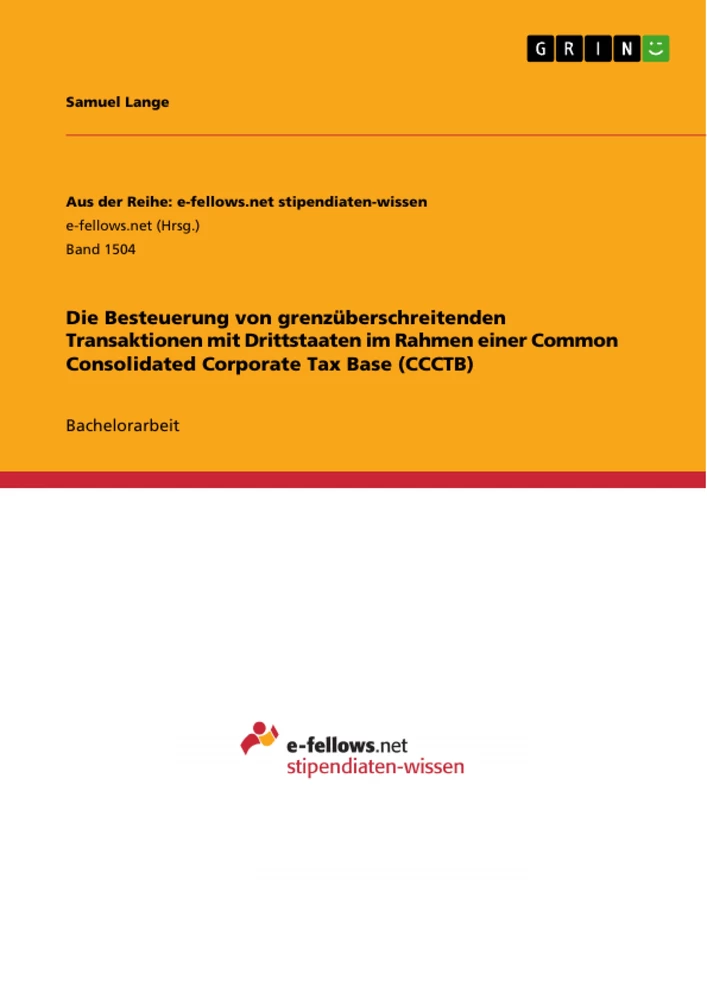
Die Besteuerung von grenzüberschreitenden Transaktionen mit Drittstaaten im Rahmen einer Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB)
Bachelorarbeit, 2012
32 Seiten
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- 1. Problemstellung, Zielsetzung und Aufbau der Arbeit
- 2. Die gemeinsame konsolidierte Körperschaftsteuerbemessungsgrundlage
- 2.1. Gründe und Ziele einer Neugestaltung
- 2.2. Konzeptionelle Ausgestaltung
- 3. Anforderungen an die Regelungen im Verhältnis zu Drittstaaten
- 3.1. Gesamtwirtschaftliche Perspektive
- 3.2. Perspektive der Unternehmen
- 3.3. Perspektive der Steuerbehörden der Mitgliedstaaten
- 4. Aktivitäten EU-ansässiger Konzerngesellschaften im Ausland
- 4.1. Bisherige Steuerregelungen in der EU im Außenverhältnis
- 4.2. Nichtharmonisierter Lösungsansatz
- 4.3. Harmonisierte Lösungsansätze
- 4.3.1. Besteuerung nach dem Quellenprinzip
- 4.3.2. Besteuerung nach dem Wohnsitzprinzip
- 4.3.3. Kombination von Quellen- und Wohnsitzprinzip
- 5. Aktivitäten ausländischer Konzerngesellschaften in der EU
- 5.1. Umfang der Quellenbesteuerung und Sicherung des Steuersubstrats
- 5.2. Zuordnung des Besteuerungsrechts
- 5.2.1. Separate Zuordnung
- 5.2.2. Formelhafte Aufteilung
- 6. Thesenförmige Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Besteuerung von grenzüberschreitenden Transaktionen mit Drittstaaten im Rahmen einer gemeinsamen konsolidierten Körperschaftsteuerbemessungsgrundlage (GKKB). Sie analysiert die Herausforderungen, die sich aus der systemischen Differenz zwischen der GKKB und der Besteuerung in Drittländern ergeben, und untersucht verschiedene Lösungsansätze.
- Analyse der Herausforderungen bei der Besteuerung von grenzüberschreitenden Transaktionen im Rahmen einer GKKB
- Bewertung verschiedener Lösungsansätze für die Besteuerung von Outbound- und Inbound-Investitionen
- Untersuchung der Auswirkungen auf Unternehmen, Steuerbehörden und die Gesamtwirtschaft
- Darlegung der Anforderungen an ein neues System der Unternehmensbesteuerung in Europa
- Entwicklung von Handlungsempfehlungen für die Gestaltung der Besteuerung von grenzüberschreitenden Transaktionen im Rahmen einer GKKB
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 führt in die Problemstellung ein und erläutert die Zielsetzung sowie den Aufbau der Arbeit. Kapitel 2 beschreibt das Konzept der GKKB und beleuchtet die Gründe und Ziele ihrer Einführung. Kapitel 3 analysiert die Anforderungen an die Regelungen im Verhältnis zu Drittstaaten aus gesamtwirtschaftlicher, unternehmerischer und behördlicher Perspektive. Kapitel 4 untersucht die Besteuerung von Outbound-Investitionen, während Kapitel 5 die Besteuerung von Inbound-Investitionen beleuchtet. Die Arbeit schließt mit einer thesenförmigen Zusammenfassung der Ergebnisse in Kapitel 6.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen der Unternehmensbesteuerung, grenzüberschreitenden Transaktionen, Drittstaaten, gemeinsamer konsolidierter Körperschaftsteuerbemessungsgrundlage (GKKB), Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB), Outbound-Investitionen, Inbound-Investitionen, Quellenprinzip, Wohnsitzprinzip, Formelhafte Aufteilung, Separate Zuordnung, Harmonisierung, Steuerrecht.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB)?
Die CCCTB (deutsch: GKKB) ist ein Vorschlag der EU-Kommission zur Harmonisierung der Unternehmensbesteuerung durch eine gemeinsame konsolidierte Körperschaftsteuerbemessungsgrundlage innerhalb der EU.
Wie werden Transaktionen mit Drittstaaten in der GKKB behandelt?
Da die GKKB auf die EU beschränkt ist, treffen an den Außengrenzen unterschiedliche Systeme aufeinander. Während intern eine formelhafte Gewinnaufteilung erfolgt, bleibt es gegenüber Drittstaaten bei transaktionsbezogenen Verrechnungspreisen.
Was ist der Unterschied zwischen Inbound- und Outbound-Investitionen?
Outbound-Investitionen sind Investitionen von EU-Unternehmen in Drittländer. Inbound-Investitionen sind Investitionen von Unternehmen aus Drittländern innerhalb der EU.
Welche Rolle spielen das Quellen- und das Wohnsitzprinzip?
Diese Prinzipien bestimmen, welcher Staat das Besteuerungsrecht hat. Die Arbeit analysiert harmonisierte Lösungsansätze, die diese Prinzipien kombinieren, um Doppelbesteuerung oder Steuervermeidung zu verhindern.
Welche Anforderungen werden an das neue Steuersystem gestellt?
Das System muss aus Sicht der Unternehmen, der Steuerbehörden und der Gesamtwirtschaft effizient, transparent und gerecht sein, um den Binnenmarkt zu stärken.
Details
- Titel
- Die Besteuerung von grenzüberschreitenden Transaktionen mit Drittstaaten im Rahmen einer Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB)
- Hochschule
- Universität Mannheim
- Autor
- Samuel Lange (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2012
- Seiten
- 32
- Katalognummer
- V302180
- ISBN (eBook)
- 9783668009240
- ISBN (Buch)
- 9783668009257
- Dateigröße
- 661 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- besteuerung transaktionen drittstaaten rahmen common consolidated corporate base ccctb
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 17,99
- Preis (Book)
- US$ 20,99
- Arbeit zitieren
- Samuel Lange (Autor:in), 2012, Die Besteuerung von grenzüberschreitenden Transaktionen mit Drittstaaten im Rahmen einer Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB), München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/302180
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-