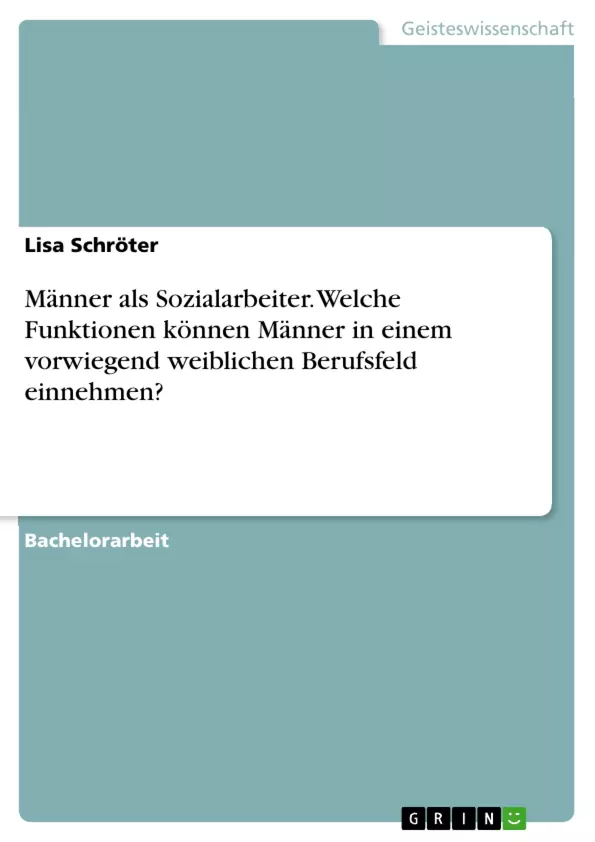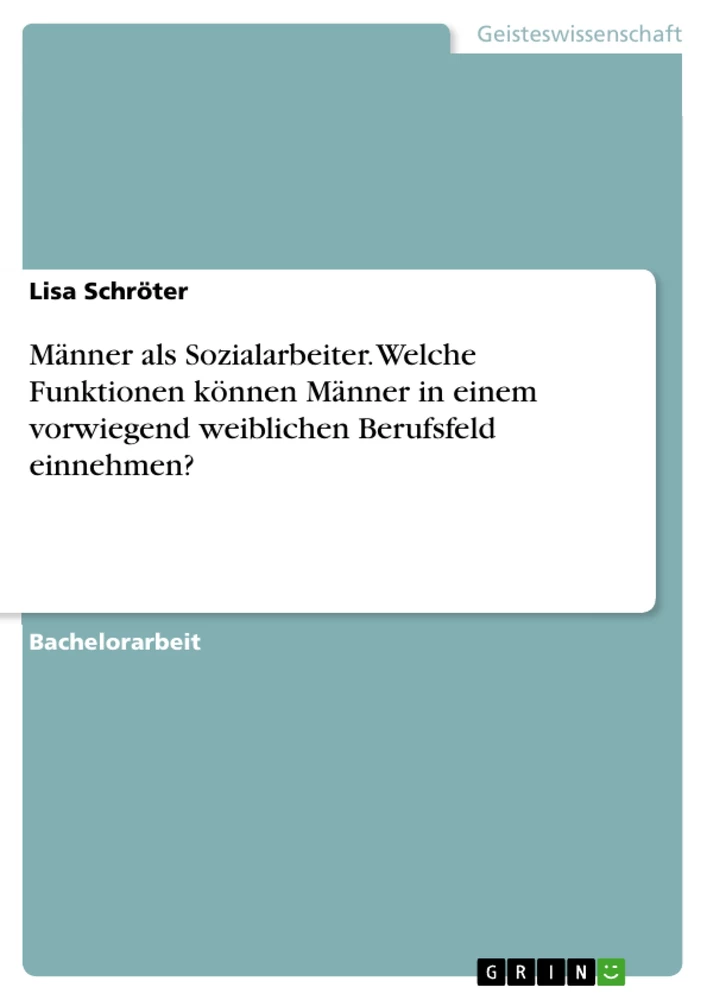
Männer als Sozialarbeiter. Welche Funktionen können Männer in einem vorwiegend weiblichen Berufsfeld einnehmen?
Bachelorarbeit, 2014
45 Seiten, Note: 2,0
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Geschlechtsspezifische Sozialisation als Teil der Erziehung
- Die Herausbildung „typisch männlicher“ Eigenschaften während der (frühen) Schulzeit
- Die Geschlechterrolle Mann
- Berufswahl und Geschlecht
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit befasst sich mit der Frage, wie männliche Sozialisation Männer in ihrer Berufswahl und -ausübung als Sozialarbeiter beeinflusst. Sie untersucht, ob und wie sich die traditionellen Geschlechterrollen auf die Wahrnehmung des sozialen Berufsfeldes durch Männer auswirken.
- Männliche Sozialisation und ihre Auswirkungen auf die Berufswahl
- Die Herausbildung von Geschlechterrollen in der Kindheit und Jugend
- Traditionelle und moderne Konzepte von Männlichkeit
- Die Wahrnehmung von Sozialarbeit als Berufsfeld durch Männer
- Die Bedeutung von Vorbildern und Stereotypen in der Berufswahl
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Relevanz des Themas vor und führt die persönlichen Erfahrungen der Autorin mit männlichen Sozialarbeitern an. Sie benennt die Forschungsfragen, die in der Arbeit beantwortet werden sollen.
- Geschlechtsspezifische Sozialisation als Teil der Erziehung: Dieses Kapitel beleuchtet den Prozess der Sozialisation und seine Bedeutung für die Entwicklung von Geschlechterrollen. Es wird auf die Definition von Sozialisation eingegangen und die Bedeutung der primären Sozialisation in den ersten Lebensjahren hervorgehoben.
- Die Herausbildung „typisch männlicher“ Eigenschaften während der (frühen) Schulzeit: Dieses Kapitel untersucht, wie geschlechtsspezifische Eigenschaften während der Schulzeit geprägt werden. Es wird auf die Rolle von Familie, Schule und Gleichaltrigen eingegangen und die Auswirkungen von Stereotypen und Vorbildern auf die Entwicklung von Geschlechterrollen analysiert.
- Die Geschlechterrolle Mann: Dieses Kapitel beleuchtet die traditionelle und moderne Konzeption der Geschlechterrolle „Mann“. Es werden die typischen Eigenschaften und Verhaltensweisen von Männern in der Gesellschaft diskutiert und die Veränderungen im Laufe der Zeit analysiert.
- Berufswahl und Geschlecht: Dieses Kapitel untersucht die Zusammenhänge zwischen Geschlechterrollen und Berufswahl. Es wird auf die Faktoren eingegangen, die die Berufswahl von Männern beeinflussen, und die spezifischen Herausforderungen, die sich für Männer in sozialen Berufen stellen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen männliche Sozialisation, Geschlechterrollen, Berufswahl, Sozialarbeit, Stereotypen, Vorbilder, moderne Männlichkeit und die Auswirkungen von traditionellen Geschlechterrollen auf die Berufswahl von Männern.
Details
- Titel
- Männer als Sozialarbeiter. Welche Funktionen können Männer in einem vorwiegend weiblichen Berufsfeld einnehmen?
- Hochschule
- Brandenburgische Technische Universität Cottbus
- Note
- 2,0
- Autor
- Lisa Schröter (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2014
- Seiten
- 45
- Katalognummer
- V303036
- ISBN (eBook)
- 9783668016521
- ISBN (Buch)
- 9783668016538
- Dateigröße
- 562 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Männer Sozialisation Sozialarbeiter Rollen männliche Sozialarbeiter Geschlechtsspezifische Sozialisation Gender primäre Sozialisation sekundäre Sozialisation tertiäre Sozialisation Geschlechterrolle Erziehung Rollenverteilung hegemoniale Männlichkeit hegemoniale Strukturen Marginalität Marginalisierung Entwicklung der Sozialarbeit zur Profession Erwerbstätigkeit Sozialarbeitsstudenten Studenten der Sozialen Arbeit geschlechterdifferenzierende Berufspraxis traditionelles Männerbild
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 20,99
- Preis (Book)
- US$ 29,99
- Arbeit zitieren
- Lisa Schröter (Autor:in), 2014, Männer als Sozialarbeiter. Welche Funktionen können Männer in einem vorwiegend weiblichen Berufsfeld einnehmen?, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/303036
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-