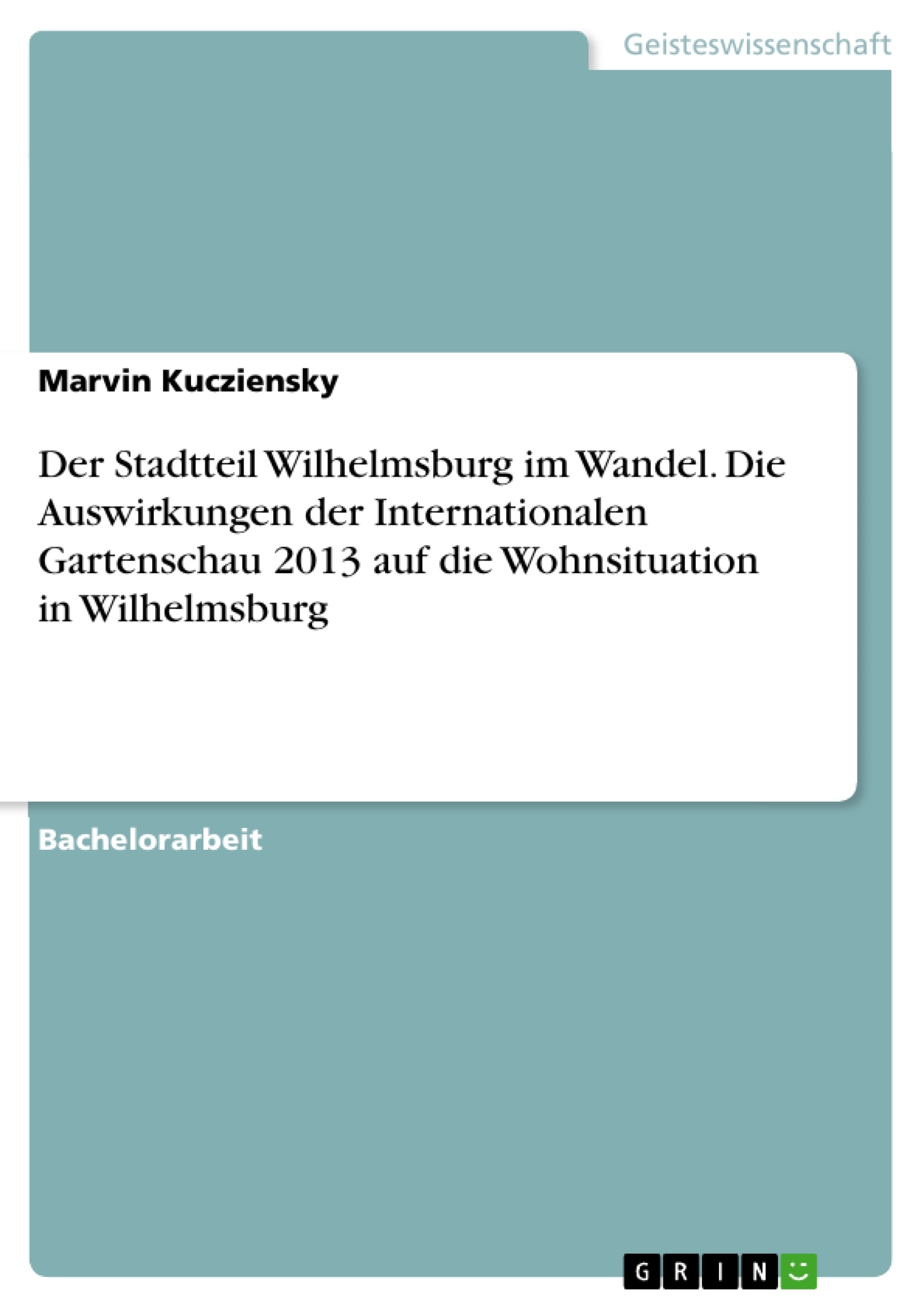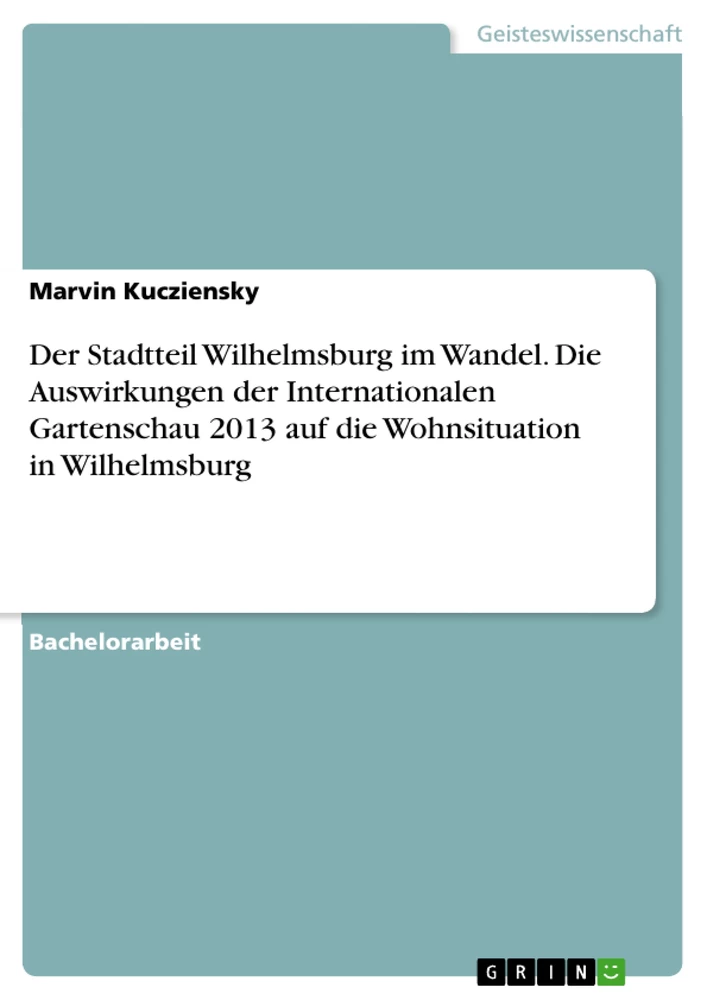
Der Stadtteil Wilhelmsburg im Wandel. Die Auswirkungen der Internationalen Gartenschau 2013 auf die Wohnsituation in Wilhelmsburg
Bachelorarbeit, 2015
61 Seiten, Note: 3,0
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Inhaltsverzeichnis
- Abbildungs- und Tabellenverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- Einleitung
- Problemstellung
- Zielsetzung der Arbeit
- Gliederung und Vorgehensweise der Arbeit
- Stadtentwicklung aus soziologischer Sicht
- Begriffserklärung Stadtentwicklung
- Stadt
- Entwicklung
- Stadtentwicklung
- Was versteht man unter einer nachhaltigen Stadtentwicklung?
- Stadtentwicklung in Hamburg
- Aktuelle Projekte
- Mögliche Probleme von Stadtentwicklungsmaßnahmen
- Gentrifizierung
- Segregation
- Begriffserklärung Stadtentwicklung
- Internationale Gartenschau 2013
- Hinführung zum Thema
- Das Konzept
- Bilanz der igs 2013
- Was blieb von der IGS 2013?
- Im Hinblick auf den Inselpark
- Im Hinblick auf die „igs 2013 GmbH”
- Im Hinblick auf die Unterhaltskosten
- Hinsichtlich des Leitprojektes „Sprung über die Elbe”
- Kritische Stimmen
- Im Hinblick auf die Umwelt
- Im Hinblick auf die Kosten
- Im Hinblick auf die Schaffung von sozialen Problemen
- Das Untersuchungsgebiet: Hamburg Wilhelmsburg
- Geschichte
- Entstehung
- Entwicklung
- Strukturdaten
- Wilhelmsburg 2010: Drei Jahre vor der igs
- Wilhelmsburg 2014: Das Jahr nach der igs
- Gegenüberstellung: Wie hat sich Wilhelmsburg strukturell verändert?
- Geschichte
- Fazit und Ausblick
- Fazit
- Quellenverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Bachelorarbeit befasst sich mit den Auswirkungen der Internationalen Gartenschau 2013 auf die Wohnsituation im Hamburger Stadtteil Wilhelmsburg. Ziel ist es, die Entwicklung des Stadtteils im Kontext der Gartenschau zu analysieren und zu bewerten, insbesondere in Bezug auf die städtebaulichen, sozialen und wirtschaftlichen Veränderungen.
- Die Auswirkungen der Internationalen Gartenschau 2013 auf die Wohnsituation in Wilhelmsburg.
- Die städtebauliche Entwicklung des Stadtteils im Kontext der Gartenschau.
- Die sozialen und wirtschaftlichen Veränderungen in Wilhelmsburg nach der Gartenschau.
- Die Rolle der Gartenschau als Motor für die Stadtentwicklung.
- Mögliche Herausforderungen und Chancen für die zukünftige Entwicklung Wilhelmsburgs.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Bachelorarbeit ein und erläutert die Problemstellung, die Zielsetzung und die Gliederung der Arbeit. Kapitel 2 beleuchtet den theoretischen Hintergrund der Stadtentwicklung aus soziologischer Sicht, definiert den Begriff der Stadtentwicklung und beleuchtet die Herausforderungen und Chancen einer nachhaltigen Stadtentwicklung. Kapitel 3 widmet sich der Internationalen Gartenschau 2013, ihrem Konzept, ihrer Bilanz und den kritischen Stimmen. Kapitel 4 analysiert den Stadtteil Wilhelmsburg als Untersuchungsgebiet und präsentiert Strukturdaten aus den Jahren 2010 und 2014, um die Veränderungen vor und nach der Gartenschau aufzuzeigen. Das Fazit fasst die wichtigsten Erkenntnisse der Arbeit zusammen und gibt einen Ausblick auf die zukünftige Entwicklung Wilhelmsburgs.
Schlüsselwörter
Internationale Gartenschau, Stadtentwicklung, Wilhelmsburg, Wohnsituation, Gentrifizierung, Segregation, Nachhaltigkeit, Stadtentwicklungsmaßnahmen, soziale und wirtschaftliche Veränderungen.
Häufig gestellte Fragen
Welchen Einfluss hatte die IGS 2013 auf Wilhelmsburg?
Die Internationale Gartenschau (IGS) 2013 war ein Motor für städtebauliche Veränderungen und Teil des Leitprojekts „Sprung über die Elbe“, um den Stadtteil besser an die Hamburger Metropole anzubinden.
Was versteht man unter Gentrifizierung in Wilhelmsburg?
Gentrifizierung bezeichnet die Aufwertung eines Stadtteils durch Sanierung und Neubau, was oft zu steigenden Mieten und der Verdrängung einkommensschwächerer Bevölkerungsschichten führt.
Was blieb nach der Gartenschau vom Inselpark übrig?
Der Inselpark blieb als dauerhafte Grün- und Erholungsfläche für die Bewohner erhalten, verursacht jedoch auch laufende Unterhaltskosten für die Stadt Hamburg.
Welche sozialen Probleme gibt es im Stadtteil Wilhelmsburg?
Wilhelmsburg war lange durch hohe Arbeitslosigkeit, geringen Bildungsstand und soziale Segregation geprägt. Die Stadtentwicklungsprojekte sollten diese Polarisierung mindern.
Wurde die IGS 2013 auch kritisiert?
Ja, Kritik gab es vor allem bezüglich der hohen Kosten, möglicher Umweltschäden durch Baumaßnahmen und der Befürchtung, dass soziale Probleme durch Aufwertung eher verlagert als gelöst werden.
Details
- Titel
- Der Stadtteil Wilhelmsburg im Wandel. Die Auswirkungen der Internationalen Gartenschau 2013 auf die Wohnsituation in Wilhelmsburg
- Hochschule
- Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg
- Note
- 3,0
- Autor
- Marvin Kucziensky (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2015
- Seiten
- 61
- Katalognummer
- V303156
- ISBN (eBook)
- 9783668012370
- ISBN (Buch)
- 9783668012387
- Dateigröße
- 1357 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Nachhaltige Stadtentwicklung Stadtentwicklung Internationale Gartenschau igs Wilhelmsburg Entwicklung Wohnsituation Segregation Gentrification
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 21,99
- Preis (Book)
- US$ 45,99
- Arbeit zitieren
- Marvin Kucziensky (Autor:in), 2015, Der Stadtteil Wilhelmsburg im Wandel. Die Auswirkungen der Internationalen Gartenschau 2013 auf die Wohnsituation in Wilhelmsburg, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/303156
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-