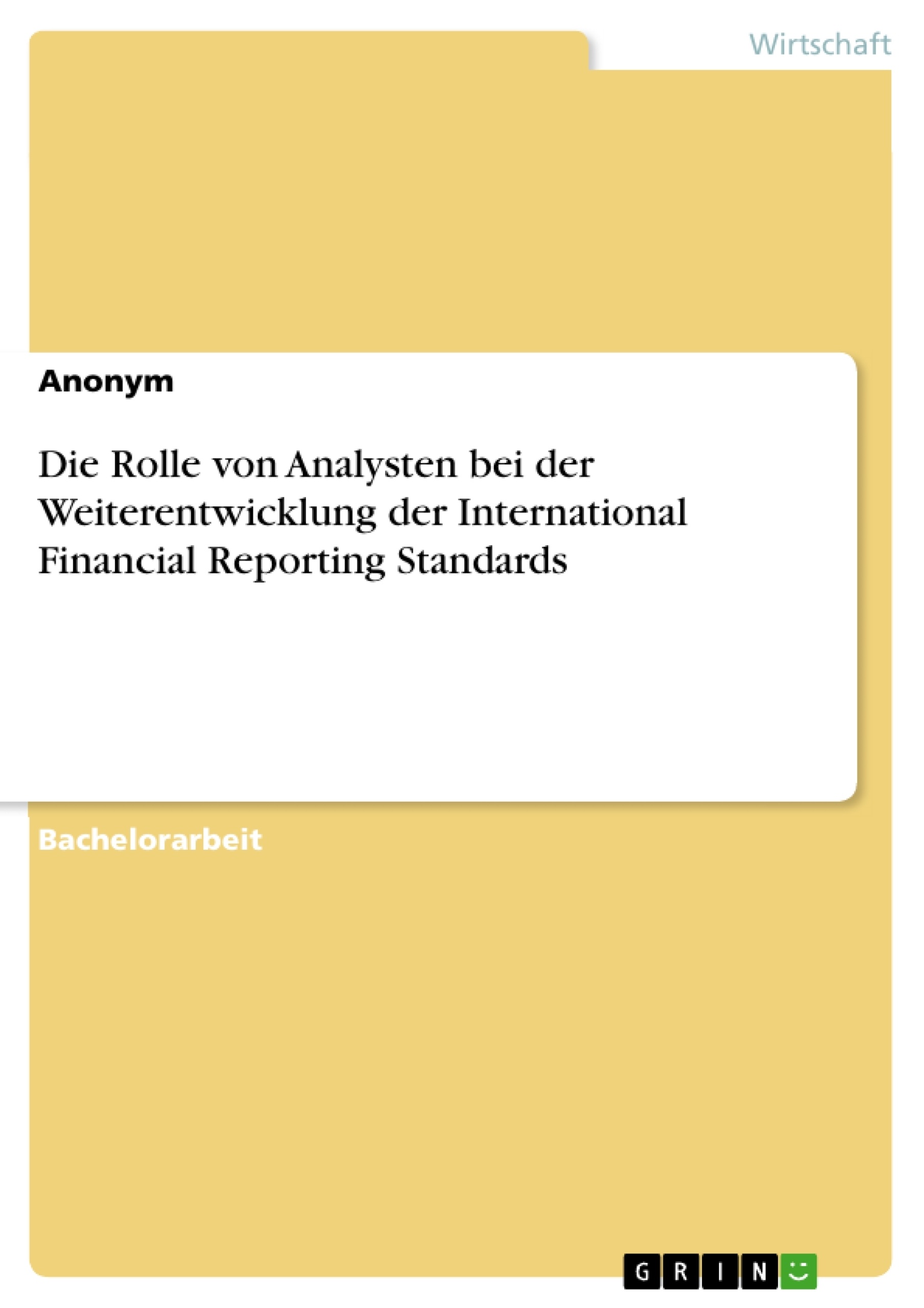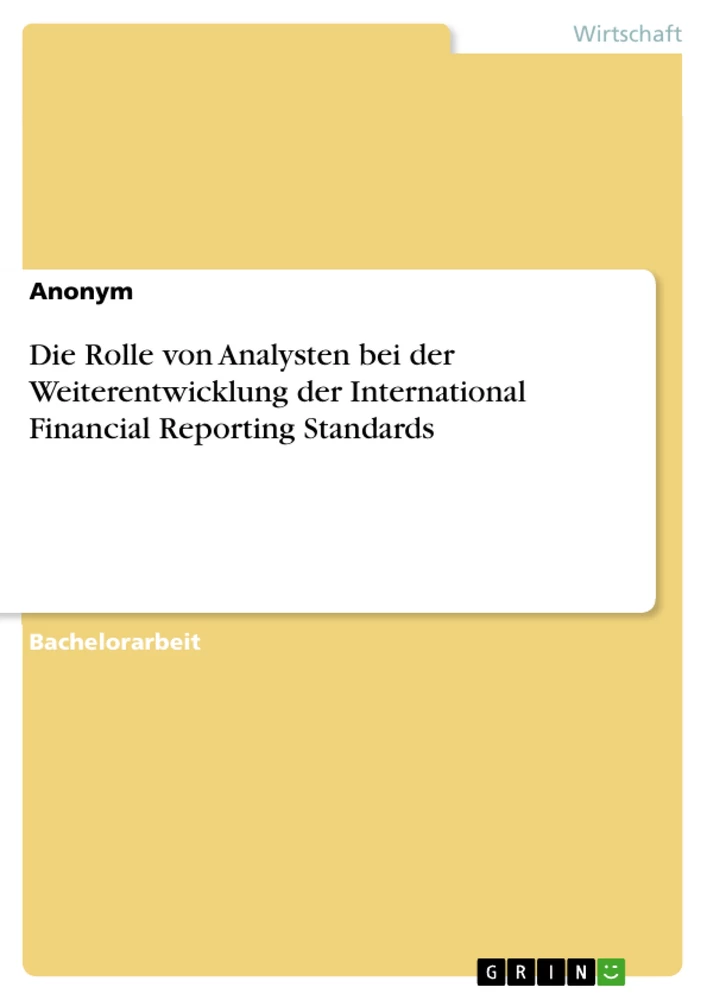
Die Rolle von Analysten bei der Weiterentwicklung der International Financial Reporting Standards
Bachelorarbeit, 2014
53 Seiten, Note: 1.3
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Problemstellung
- Die IFRS Foundation
- Zielsetzung der IFRS Foundation
- Aufbau der IFRS Foundation und ihrer Gremien
- Sonderstellung der EFRAG durch den EU-Endorsement Prozess
- Die Fortentwicklung der IFRS
- Der IASB als Entwickler von IFRS Standards
- Die User der IFRS
- Der Due Process des IASB
- Lobbying bei der Standardentwicklung und der IFRS Foundation
- Mögliche Lobbymethoden eines IFRS und der IFRS Foundation
- Analysten als Nutzergruppe der IFRS
- Der Kapitalmarkt, Rechnungslegung und Analysten
- Tätigkeit der Finanzanalysten am Kapitalmarkt
- Rolle der Finanzanalysten am Kapitalmarkt
- Die Rolle der Analysten bei der IFRS Fortentwicklung
- Wissenschaftliche Untersuchungen zur User-Preparer Imbalance
- Forschungsstand zur Einflussnahme von Analysten und Investoren
- Forschung zu den Gründen erhöhter Partizipation der Ersteller
- Theoretische Gründe für die Teilnahme von Analysten / Usern
- Forschung zu den Gründen der geringen Analysten / User Teilnahme
- Kritische Würdigung wissenschaftlicher Studien
- Anekdotische Evidenz
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Die vorliegende Bachelorarbeit befasst sich mit der Rolle von Analysten bei der Fortentwicklung der International Financial Reporting Standards (IFRS). Ziel ist es, den Einfluss von Analysten auf den Standardsetzungsprozess zu untersuchen und die Gründe für ihre (oft geringe) Beteiligung zu beleuchten. Hierzu werden wissenschaftliche Studien analysiert und anekdotische Evidenz herangezogen.
- Der Einfluss von Analysten auf die Standardentwicklung
- Die Gründe für die User-Preparer Imbalance im Standardsetzungsprozess
- Die Bedeutung der Lobbyarbeit für die IFRS Foundation
- Der Einfluss der Analysten auf den Kapitalmarkt
- Die Rolle der IFRS Foundation bei der Standardentwicklung
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Nach einer einleitenden Problemstellung widmet sich die Arbeit zunächst der IFRS Foundation und ihren Zielen sowie dem Aufbau der Organisation und ihrer Gremien. Die Sonderstellung der EFRAG im EU-Endorsement Prozess wird ebenfalls beleuchtet. Im Anschluss erfolgt eine Betrachtung der Fortentwicklung der IFRS, wobei der IASB als Entwickler von IFRS Standards im Fokus steht. Die User der IFRS werden vorgestellt und der Due Process des IASB erläutert. Lobbying bei der Standardentwicklung und die möglichen Lobbymethoden werden ebenfalls beleuchtet.
Das nächste Kapitel widmet sich den Analysten als Nutzergruppe der IFRS. Der Kapitalmarkt, Rechnungslegung und Analysten werden thematisiert. Die Tätigkeit und Rolle von Finanzanalysten am Kapitalmarkt werden genauer betrachtet. Im Folgenden wird die Rolle der Analysten bei der IFRS Fortentwicklung untersucht. Hierzu werden wissenschaftliche Untersuchungen zur User-Preparer Imbalance und zum Forschungsstand der Einflussnahme von Analysten und Investoren analysiert.
Die Gründe für die erhöhte Partizipation der Ersteller und die theoretischen Gründe für die Teilnahme von Analysten/Usern werden untersucht. Abschließend wird die Forschung zu den Gründen der geringen Analysten/User Teilnahme beleuchtet. Die Arbeit endet mit einer kritischen Würdigung der wissenschaftlichen Studien und anekdotischer Evidenz sowie einer Zusammenfassung der wichtigsten Erkenntnisse.
Schlüsselwörter (Keywords)
IFRS, Standardentwicklung, Analysten, Kapitalmarkt, User-Preparer Imbalance, Lobbying, IFRS Foundation, IASB, EFRAG, Due Process, Rechnungslegung, Finanzanalysten, Forschungsstand, wissenschaftliche Studien, anekdotische Evidenz.
Häufig gestellte Fragen
Welche Rolle spielen Analysten bei der Entwicklung der IFRS?
Analysten gelten als Hauptadressaten der IFRS. Die Arbeit untersucht, inwieweit sie durch Lobbying und die Teilnahme am "Due Process" des IASB Einfluss auf die Gestaltung der Standards nehmen.
Was ist die "User-Preparer Imbalance"?
Es beschreibt das Phänomen, dass sich Ersteller von Abschlüssen (Preparer) deutlich stärker am Standardsetzungsprozess beteiligen als die eigentlichen Nutzer (User) wie Investoren und Analysten.
Was versteht man unter dem "Due Process" des IASB?
Der Due Process ist ein geregeltes Verfahren zur Entwicklung von Standards, das die Beteiligung von Stakeholdern durch Kommentierungsphasen und öffentliche Diskussionen vorsieht.
Warum ist die Beteiligung von Analysten an der IFRS-Entwicklung oft gering?
Wissenschaftliche Studien untersuchen hierfür Gründe wie Zeitmangel, hohe Spezialisierung oder die Annahme, dass ihre Interessen bereits ausreichend vertreten werden.
Welche Bedeutung hat die EFRAG für die IFRS in Europa?
Die EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) spielt eine Sonderstellung im EU-Endorsement-Prozess, indem sie die EU-Kommission bei der Übernahme der IFRS in europäisches Recht berät.
Details
- Titel
- Die Rolle von Analysten bei der Weiterentwicklung der International Financial Reporting Standards
- Hochschule
- Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main
- Note
- 1.3
- Autor
- Anonym (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2014
- Seiten
- 53
- Katalognummer
- V305290
- ISBN (eBook)
- 9783668033627
- ISBN (Buch)
- 9783668033634
- Dateigröße
- 1053 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- IFRS Development Financial Analysts IFRS Stakeholder Due Process IFRS Lobbying IFRS
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 19,99
- Preis (Book)
- US$ 29,99
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2014, Die Rolle von Analysten bei der Weiterentwicklung der International Financial Reporting Standards, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/305290
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-