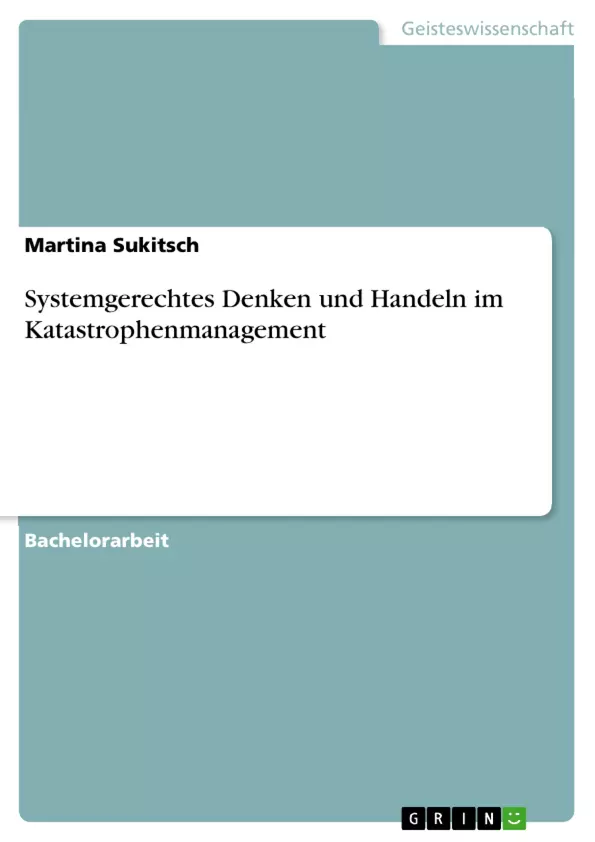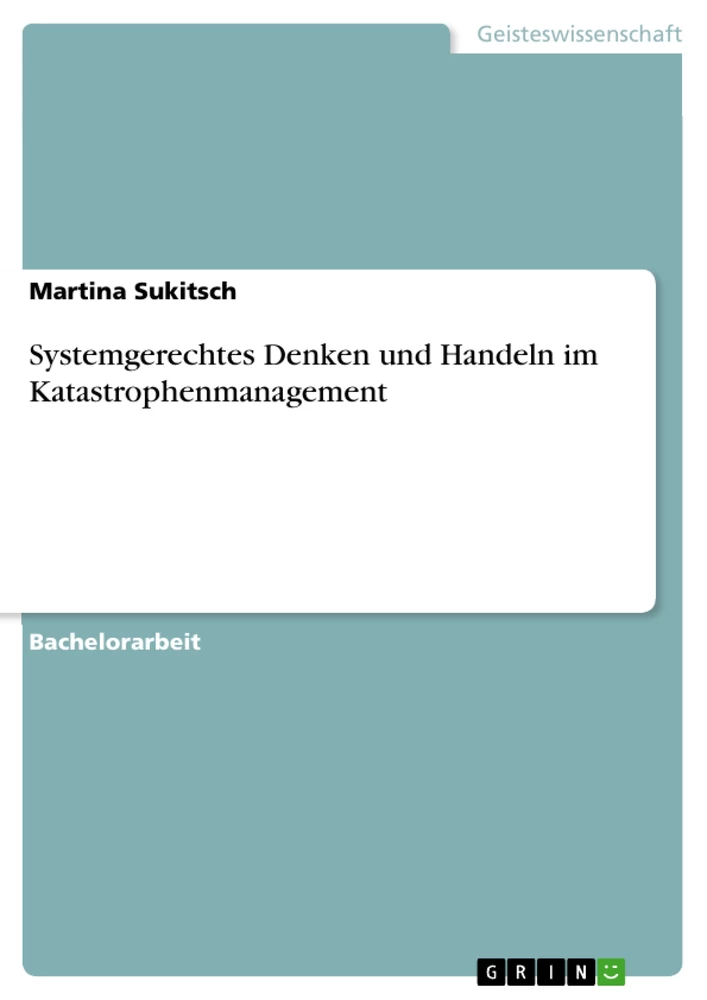
Systemgerechtes Denken und Handeln im Katastrophenmanagement
Bachelorarbeit, 2009
47 Seiten, Note: 1
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Aufbau und Ziel dieser Arbeit
- 2 Systemgerechtes Denken und Handeln
- 2.1 Was bedeutet systemisches Denken und Handeln?
- 2.1.1 Abschied vom kausal-deterministischen Denken
- 2.1.1.1 Veranschaulichung der Denkweisen
- 2.1.2 Metanoia-Prinzip
- 2.2 Entwicklung und Vertreter
- 2.3 Vier Dimensionen
- 2.3.1 Vernetztes Denken
- 2.3.2 Denken in zeitlichen Dynamiken
- 2.3.3 Denken in Modellen
- 2.3.4 Systemgerechtes Handeln
- 3 Wann von Katastrophen gesprochen wird
- 3.1 Allgemeine Begriffsklärung
- 3.1.1 Krisen
- 3.1.2 Katastrophen
- 3.1.3 Unterschiede und Gemeinsamkeiten im Überblick
- 3.2 Systemwissenschaftliche Begriffsklärung
- 3.2.1 Krise
- 3.2.2 Katastrophe
- 3.2.2.1 Systeme mit Katastrophenpotential
- 4 Katastrophen bewältigen
- 4.1 Einführung in das Katastrophenmanagement
- 4.1.1 Struktur des Katastrophenmanagements
- 4.1.1.1 Zwei Theorieansätze
- 4.1.1.2 Prävention - Intervention - Postvention
- 4.2 Elemente des Katastrophenmanagements
- 4.2.1 Aufgabenbereiche
- 4.2.2 Probleme/Fehler
- 4.2.3 Information und Kommunikation
- 4.3 Rahmenbedingungen und Schlüsselfaktoren
- 4.3.1 Rahmenbedingungen
- 4.3.2 Schlüsselfaktoren und Aktionsfelder
- 4.4 Bedeutung systemgerechten Denkens und Handelns
- 4.4.1 Katastrophen als komplexe Systeme wahrnehmen
- 4.4.2 Systemisches Management von Katastrophen
- 4.4.2.1 Prävention Intervention - Postvention
- 5 Katrina-Katastrophe in New Orleans
- 5.1 Wie alles kam
- 5.2 Der Hurrikan
- 5.3 Die Katastrophe
- 5.4 Das Katastrophenmanagement
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert das Katastrophenmanagement aus systemischer Sicht. Sie untersucht, wie komplexe und dynamische Wirkungsgefüge in Katastrophensituationen entstehen und wie ein effektives und effizientes Management dieser Situationen ermöglicht werden kann. Dabei werden verschiedene Theorien aus unterschiedlichen Disziplinen integriert, um ein umfassendes Verständnis des Themas zu ermöglichen.
- Systemisches Denken und Handeln als Grundlage für das Katastrophenmanagement
- Unterscheidung zwischen Krisen und Katastrophen unter systemwissenschaftlichen Gesichtspunkten
- Analyse der Struktur und der Elemente des Katastrophenmanagements
- Bedeutung von Prävention, Intervention und Postvention im Katastrophenmanagement
- Die Rolle von Kommunikation und Information in Katastrophensituationen
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel bietet eine Einleitung in die Thematik des Katastrophenmanagements und erläutert die Zielsetzung sowie den Aufbau der Arbeit. Kapitel zwei beschäftigt sich mit dem systemischen Denken und Handeln, beleuchtet die Abkehr vom kausal-deterministischen Denken und stellt verschiedene Denkmodelle vor. Im dritten Kapitel werden die grundlegenden Begriffe Krise und Katastrophe definiert und systemwissenschaftlich betrachtet. Kapitel vier behandelt das Katastrophenmanagement, wobei die Struktur und die Elemente des Managements sowie die Bedeutung von Prävention, Intervention und Postvention im Fokus stehen. Im fünften Kapitel wird die Katrina-Katastrophe in New Orleans als Beispiel für ein komplexes und dynamisches Wirkungsgefüge analysiert.
Schlüsselwörter
Katastrophenmanagement, Systemisches Denken, Systemisches Handeln, Komplexe Systeme, Krisenmanagement, Prävention, Intervention, Postvention, Information, Kommunikation, Naturkatastrophen, Anthropogene Katastrophen.
Details
- Titel
- Systemgerechtes Denken und Handeln im Katastrophenmanagement
- Hochschule
- Karl-Franzens-Universität Graz (Institut für Systemwissenschaften, Innovations- und Nachhaltigkeitsforschung)
- Veranstaltung
- Proseminar zu Qualitative Systemwissenschaften
- Note
- 1
- Autor
- Martina Sukitsch (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2009
- Seiten
- 47
- Katalognummer
- V307046
- ISBN (eBook)
- 9783668055988
- ISBN (Buch)
- 9783668055995
- Dateigröße
- 5423 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Katastrophenmanagement Krisenmanagement systemgerechtes Denken Katrina Hurrikan Hurricane
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 20,99
- Preis (Book)
- US$ 29,99
- Arbeit zitieren
- Martina Sukitsch (Autor:in), 2009, Systemgerechtes Denken und Handeln im Katastrophenmanagement, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/307046
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-