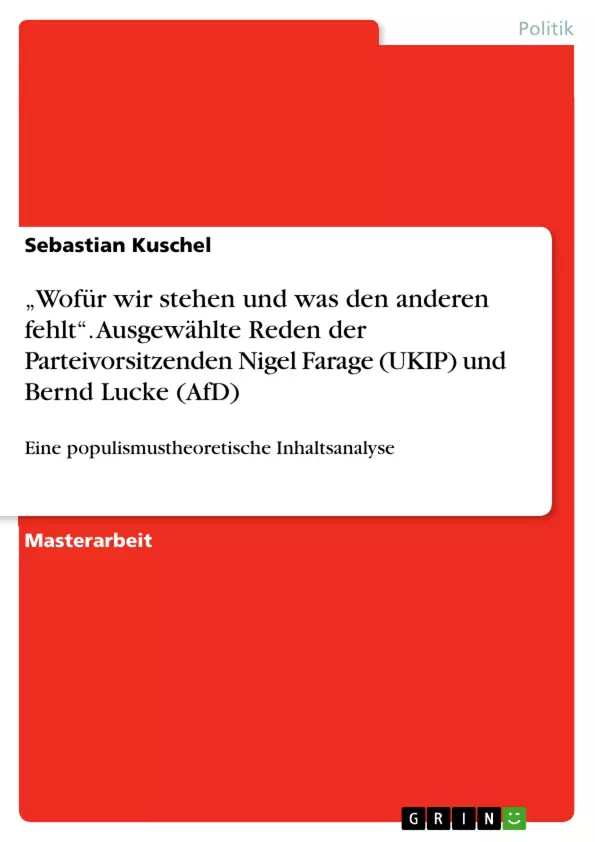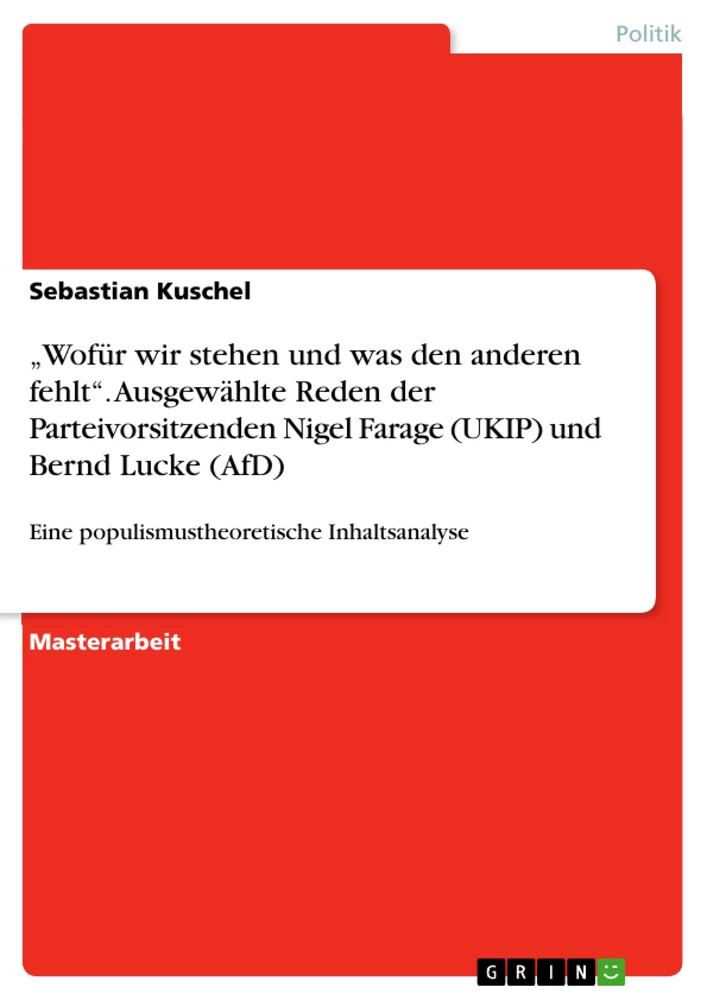
„Wofür wir stehen und was den anderen fehlt“. Ausgewählte Reden der Parteivorsitzenden Nigel Farage (UKIP) und Bernd Lucke (AfD)
Masterarbeit, 2015
146 Seiten, Note: 1,7
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- A Die britisch-deutsche Ausnahme? Das Phänomen des Populismus in Europa
- I. Relevanz der Forschungsfrage
- II. Aufbau der Arbeit
- III. Forschungsstand
- B Theoretischer Rahmen, Methode und Datenauswahl
- I. Annäherung an einen vagen Begriff: Populismus
- 1.1 Populisten und Volkstümler: Historische Populismen
- 1.2 Mannigfaltige Populismusverständnisse
- 1.3 Populismus als Diskurspaxis
- 1.4 Opposition gegen eine Elite – ganz ohne Klassenkampf
- 1.5 Krise als einigender Faktor
- 1.6 Die Quintessenz der (allgemeinen) Populismusforschung
- II. Der „Sonderfall“ des Rechtspopulismus
- II.1 Den Rechtspopulismus begünstigende Entwicklungsprozesse
- II.2 Das erneute Dilemma der begrifflichen Abgrenzung
- II.3 Euroskepsis als ein möglicher Bestandteil von Rechtspopulismus - Theoretischer Hintergrund
- III. Forschungsgegenstand, Methode und Datenkorpus
- III.1 Einordnung des Forschungsgegenstands
- III.2 Methode
- III.3 Auswahl und Festlegung des Datenmaterials sowie die Entstehungssituation
- C Komparativer Block / Analyse der Reden von Farage und Lucke
- I. Entwicklung und Einordnung der UKIP in Großbritannien
- I.1 Das Parteiensystem in Großbritannien
- I.2 Populismus und Euroskepsis in Großbritannien
- I.3 Geschichte und politische Verortung der UKIP
- I.4 Nigel Farage als „Kopf“ der UKIP
- II. Entwicklung und Einordnung der AfD in der Bundesrepublik Deutschland
- II.1 Das Parteiensystem in der BRD
- II.2 Populismus und Euroskeptizismus in der BRD
- II.3 Geschichte und politische Verortung der AfD
- II.4 Bernd Lucke als „Kopf“ der AfD?
- III. Analyse der Reden von Farage und Lucke
- III.1 Definition der Analyseeinheiten
- III.2 Analyseschritte mittels des Kategoriensystems
- III.2.1 Bestimmung der Typisierungsdimensionen
- III.2.2 Bestimmung der Ausprägungen (theoriegeleitet), Formulierung von Definitionen, Ankerbeispielen und Kodierregeln und Gesamtdarstellung in einem Kodierleitfaden
- III.2.3 Rücküberprüfung des Kategoriensystems an Theorie und Material
- IV. Präsentation und Interpretation der Ergebnisse vor dem Hintergrund der Forschungsfrage
- IV.1 Auftreten der Rechtspopulismuskategorien am Beispiel besonders eindeutiger Codierungen (Ankerbeispiele)
- IV.2 Gemeinsamkeiten und Unterschiede in den Reden von Farage und Lucke / Code-Relationen
- D Fazit, aktuelle Entwicklungen und Ausblick
- E Anhang
- F Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Reden der Parteivorsitzenden Nigel Farage (UKIP) und Bernd Lucke (AfD), um rechtspopulistische Strategien und deren Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu analysieren. Die Untersuchung konzentriert sich auf die Konstruktion antagonistischer Pole und die verwendeten Attribute. Die Forschungsfrage zielt darauf ab, die Verwendung von Schlüsselbegriffen und politischen Strategien aus der Populismustheorie in den Reden aufzudecken.
- Analyse rechtspopulistischer Rhetorik in Reden von Farage und Lucke
- Vergleich der Strategien beider Parteivorsitzender
- Identifizierung antagonistischer Pole und verwendeter Attribute
- Anwendung populistischer Kategorien auf die Reden
- Untersuchung der Verwendung von Schlüsselbegriffen im Diskurs
Zusammenfassung der Kapitel
A Die britisch-deutsche Ausnahme? Das Phänomen des Populismus in Europa: Dieses Kapitel untersucht das Aufkommen und den Erfolg populistischer Parteien in Europa, unter besonderer Berücksichtigung von Großbritannien und Deutschland, die lange Zeit als weniger anfällig für Rechtspopulismus galten. Es werden Beispiele aus verschiedenen europäischen Ländern genannt, um den zunehmenden Einfluss populistischer Parteien zu veranschaulichen, und hebt die UKIP und die AfD als besonders erfolgreiche Beispiele hervor. Das Kapitel legt den Grundstein für die Untersuchung, indem es den Kontext und die Relevanz der Forschungsfrage im europäischen politischen Umfeld verdeutlicht und den Fokus auf die ausgewählten Parteien lenkt.
B Theoretischer Rahmen, Methode und Datenauswahl: Dieses Kapitel beschreibt den theoretischen Rahmen der Arbeit, die methodische Vorgehensweise und die Auswahl des Datenmaterials. Es beleuchtet verschiedene Populismusverständnisse und den „Sonderfall“ des Rechtspopulismus, der durch spezifische Entwicklungsprozesse begünstigt wird. Die methodische Herangehensweise und die Auswahl der Reden von Farage und Lucke als Datenkorpus werden detailliert erläutert und begründet. Der Fokus liegt auf der Begründung der gewählten Methodik und der Rechtfertigung der Datenauswahl für eine valide und nachvollziehbare Analyse.
C Komparativer Block / Analyse der Reden von Farage und Lucke: Dieses Kapitel bildet den Kern der Arbeit und analysiert die Reden von Nigel Farage und Bernd Lucke vergleichend. Es beginnt mit der Einordnung der UKIP und der AfD in ihre jeweiligen politischen Systeme, bevor es auf die detaillierte Analyse der Reden eingeht. Die Analyse konzentriert sich auf die Identifizierung und den Vergleich von politischen Strategien, die Konstruktion antagonistischer Pole, und die verwendete Rhetorik im Kontext der Populismustheorie. Die Ergebnisse dieser Analyse sollen die Forschungsfrage beantworten.
Schlüsselwörter
Populismus, Rechtspopulismus, UKIP, AfD, Nigel Farage, Bernd Lucke, Euroskepsis, Rhetorikanalyse, Inhaltsanalyse, politische Strategien, Diskurs, antagonistische Pole.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Die britisch-deutsche Ausnahme? Das Phänomen des Populismus in Europa
Was ist der Gegenstand dieser wissenschaftlichen Arbeit?
Die Arbeit analysiert die Reden der Parteivorsitzenden Nigel Farage (UKIP) und Bernd Lucke (AfD), um rechtspopulistische Strategien, deren Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu untersuchen. Der Fokus liegt auf der Konstruktion antagonistischer Pole und der verwendeten Attribute in ihren Reden. Die zentrale Forschungsfrage untersucht, wie Schlüsselbegriffe und politische Strategien aus der Populismustheorie in den Reden eingesetzt werden.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in jedem Kapitel?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: A: Einführung in das Thema Populismus in Europa, mit besonderem Fokus auf Großbritannien und Deutschland, und Einordnung der UKIP und AfD. B: Definition von Populismus, methodische Vorgehensweise (Inhaltsanalyse von Reden) und Begründung der Datenauswahl (Reden von Farage und Lucke). C: Vergleichende Analyse der Reden von Farage und Lucke, einschließlich der Einordnung der jeweiligen Parteien in das politische System ihres Landes und der Identifizierung von Gemeinsamkeiten und Unterschieden in ihren Strategien. D: Zusammenfassung der Ergebnisse, Ausblick auf aktuelle Entwicklungen. Zusätzlich beinhaltet die Arbeit einen Anhang und Literaturverzeichnis.
Welche Methoden werden in der Arbeit verwendet?
Die Arbeit verwendet eine vergleichende Inhaltsanalyse der Reden von Nigel Farage und Bernd Lucke. Es wird ein Kategoriensystem entwickelt und angewendet, um die Reden nach bestimmten Kriterien (z.B. Konstruktion antagonistischer Pole, verwendete Attribute) zu analysieren und zu vergleichen. Die Methodik wird im Kapitel B detailliert beschrieben.
Welche theoretischen Konzepte werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit befasst sich mit verschiedenen Populismusverständnissen und dem "Sonderfall" des Rechtspopulismus. Es werden theoretische Ansätze herangezogen, um die Reden zu analysieren und die Ergebnisse zu interpretieren. Ein Schwerpunkt liegt auf der begrifflichen Abgrenzung von Populismus und Rechtspopulismus.
Welche Daten werden in der Arbeit analysiert?
Die Datenbasis der Arbeit besteht aus Reden von Nigel Farage (UKIP) und Bernd Lucke (AfD). Die Auswahl dieser Reden und die Begründung der Datenauswahl werden im Kapitel B detailliert erläutert.
Welche Ergebnisse werden in der Arbeit präsentiert?
Die Arbeit präsentiert die Ergebnisse der vergleichenden Inhaltsanalyse der Reden von Farage und Lucke. Die Ergebnisse werden im Hinblick auf die Forschungsfrage interpretiert und Gemeinsamkeiten und Unterschiede in den Strategien beider Politiker aufgezeigt. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Verwendung von Schlüsselbegriffen und der Konstruktion antagonistischer Pole.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die Schlussfolgerungen der Arbeit werden im Kapitel D präsentiert. Hier werden die Ergebnisse zusammengefasst und in einen grösseren Kontext eingeordnet. Ein Ausblick auf aktuelle Entwicklungen rundet die Arbeit ab.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit am besten?
Populismus, Rechtspopulismus, UKIP, AfD, Nigel Farage, Bernd Lucke, Euroskepsis, Rhetorikanalyse, Inhaltsanalyse, politische Strategien, Diskurs, antagonistische Pole.
Details
- Titel
- „Wofür wir stehen und was den anderen fehlt“. Ausgewählte Reden der Parteivorsitzenden Nigel Farage (UKIP) und Bernd Lucke (AfD)
- Untertitel
- Eine populismustheoretische Inhaltsanalyse
- Hochschule
- Universität Augsburg
- Note
- 1,7
- Autor
- Sebastian Kuschel (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2015
- Seiten
- 146
- Katalognummer
- V307322
- ISBN (eBook)
- 9783668054783
- ISBN (Buch)
- 9783668054790
- Dateigröße
- 2711 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Populismus Großbritannien Deutschland AfD UKIP Euroskepsis Euroskeptizismus Populismustheorie Parteienforschung Europäische Union Wahlen Parteien Bernd Lucke Nigel Farage Topic_Rechtspopulismus
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 38,99
- Preis (Book)
- US$ 49,99
- Arbeit zitieren
- Sebastian Kuschel (Autor:in), 2015, „Wofür wir stehen und was den anderen fehlt“. Ausgewählte Reden der Parteivorsitzenden Nigel Farage (UKIP) und Bernd Lucke (AfD), München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/307322
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-