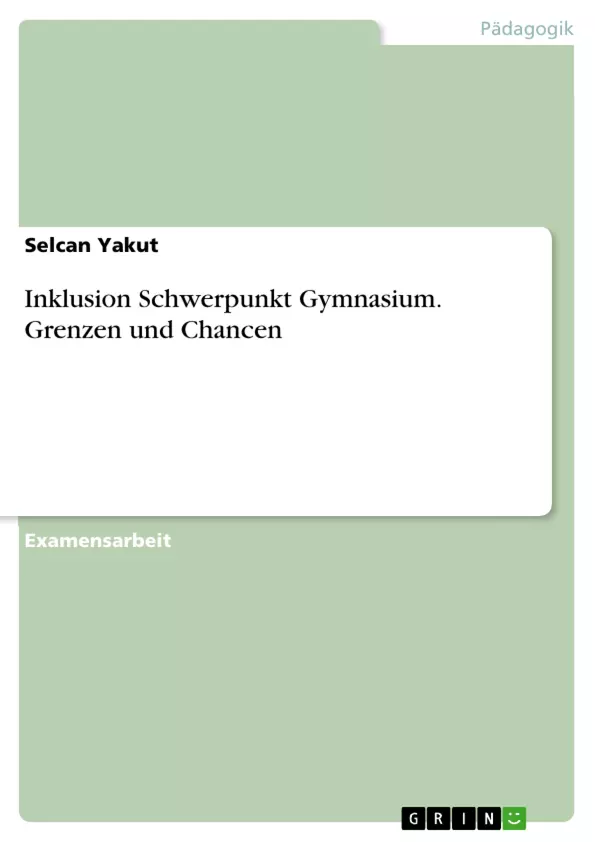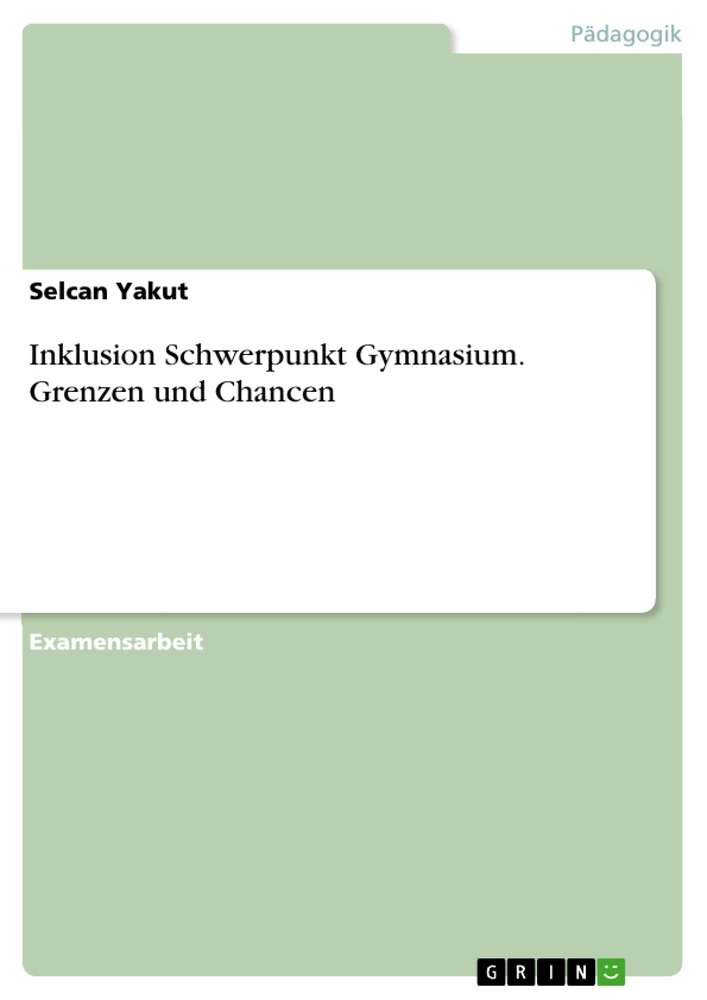
Inklusion Schwerpunkt Gymnasium. Grenzen und Chancen
Examensarbeit, 2015
59 Seiten, Note: 3,0
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- 1. Einleitung
- 2. Definitionen und Aspekte der Inklusion
- 2.1 Heterogenität
- 2.2 Subjektivität
- 2.3 Individualität
- 3. Theoretische Grundlagen
- 3.1 Gesellschaftspolitische Bedeutung der Inklusion
- 3.2 Pädagogische Bedeutung der Inklusion
- 3.3 Juristische Bedeutung der Inklusion
- 4. Inklusion und die Menschenrechtsdebatte
- 5. Bedeutung der Inklusion für die Schule
- 5.1 Auswirkungen auf die Schüler
- 5.2 Auswirkungen auf die Lehrer
- 5.3 Auswirkungen auf die Institution Schule am Beispiel der Schulform des Gymnasiums
- 6. Auswertung und Diskussion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Konzept der Inklusion, beleuchtet dessen Bedeutung für die Gesellschaft und insbesondere für das deutsche Bildungssystem. Das Hauptziel ist es, ein umfassendes Verständnis des Inklusionsgedankens zu vermitteln und dessen Relevanz für die Gestaltung einer gerechten und vielfältigen Gesellschaft zu verdeutlichen.
- Definition und Entwicklung des Begriffs der Inklusion
- Theoretische Grundlagen und gesellschaftliche Relevanz der Inklusion
- Die Rolle der Inklusion im Bildungswesen
- Auswirkungen der Inklusion auf Schüler, Lehrer und die Institution Schule
- Die Bedeutung der Inklusion für das Gymnasium
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Kapitel 1 bietet eine Einführung in das Thema Inklusion und skizziert den Hintergrund und die Relevanz des Begriffs in Bezug auf gesellschaftliche Unterschiede. Kapitel 2 befasst sich mit verschiedenen Aspekten der Inklusion, darunter Heterogenität, Subjektivität und Individualität. Kapitel 3 beleuchtet die theoretischen Grundlagen der Inklusion, wobei die gesellschaftlichen, pädagogischen und juristischen Aspekte im Fokus stehen. Kapitel 4 diskutiert die Verbindung zwischen Inklusion und der Menschenrechtsdebatte. Kapitel 5 untersucht die Bedeutung der Inklusion für die Schule und analysiert die Auswirkungen auf Schüler, Lehrer und die Institution Schule selbst.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit den zentralen Begriffen und Konzepten der Inklusion, darunter Heterogenität, Subjektivität, Individualität, gesellschaftliche Teilhabe, Bildungsgerechtigkeit, inklusive Pädagogik, Menschenrechte, Sonderpädagogik, Integration, Förderschulsystem, Gymnasium, Schulsystem und Schulform.
Details
- Titel
- Inklusion Schwerpunkt Gymnasium. Grenzen und Chancen
- Hochschule
- Universität Paderborn
- Note
- 3,0
- Autor
- Selcan Yakut (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2015
- Seiten
- 59
- Katalognummer
- V308180
- ISBN (eBook)
- 9783668066205
- ISBN (Buch)
- 9783668066212
- Dateigröße
- 763 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Inklusion Grenzen Heruasforderung sekundarstufe
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 10,99
- Preis (Book)
- US$ 15,99
- Arbeit zitieren
- Selcan Yakut (Autor:in), 2015, Inklusion Schwerpunkt Gymnasium. Grenzen und Chancen, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/308180
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-