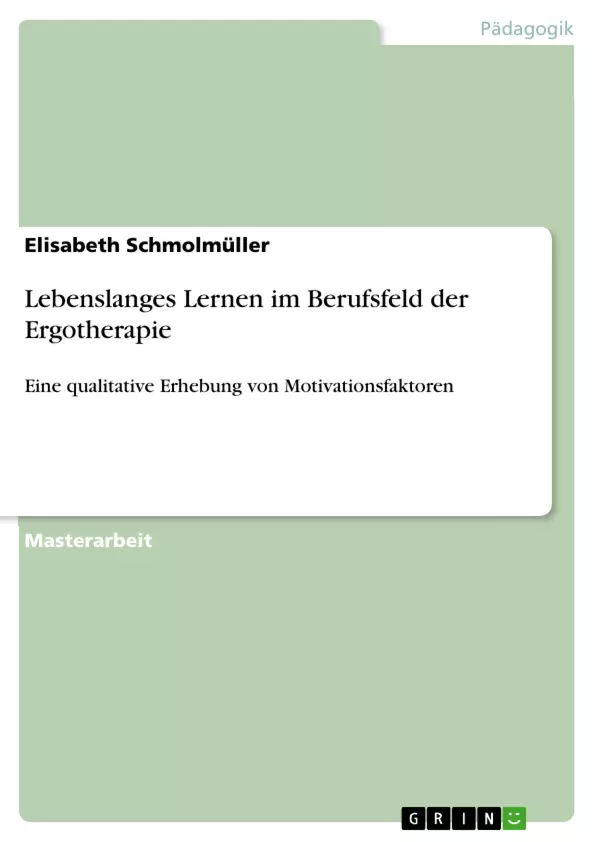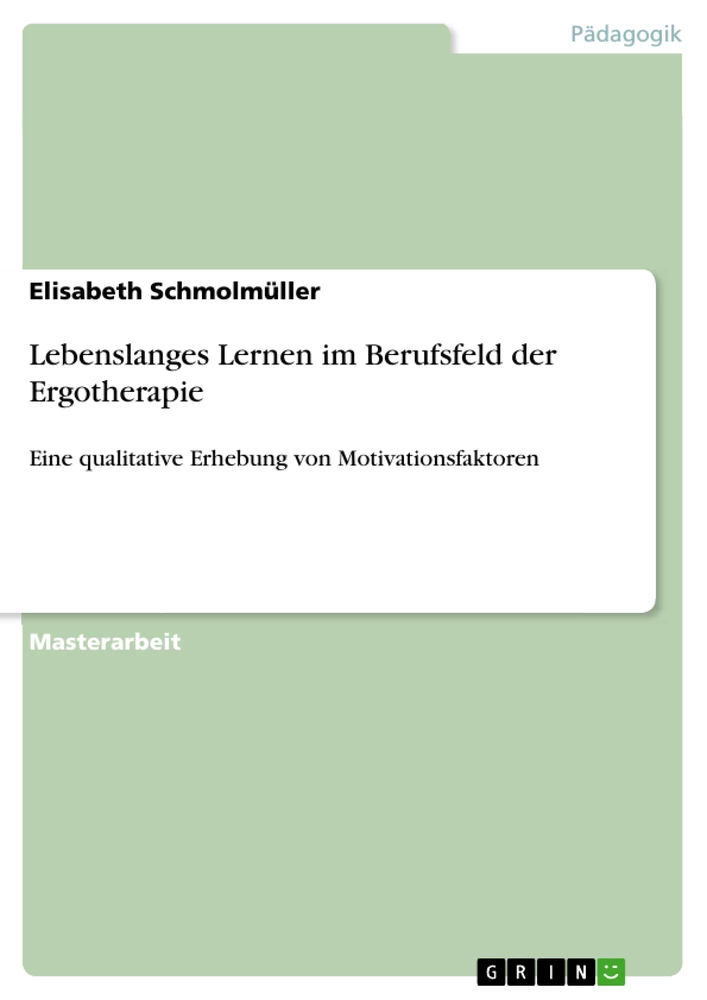
Lebenslanges Lernen im Berufsfeld der Ergotherapie
Masterarbeit, 2006
108 Seiten, Note: 2
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Zusammenfassung / Abstract
- Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Einleitung
- I. Theoretische Aspekte zum Untersuchungsgegenstand
- I. 1. Berufsprofil der Ergotherapie
- I.1.1. Professionalisierungsprozesse und Professionalität in der Ergotherapie
- I.1.2. Die Ergotherapieausbildung in Österreich
- I.2. Weiterbildung und lebenslanges Lernen in der Ergotherapie
- I.2.1. Begriffsbestimmungen zur beruflichen Weiterbildung
- I.2.2. Weiterbildungssituation in der Ergotherapie
- I.3. Kompetenzentwicklung in der Ergotherapie
- I.3.1. Kompetenz - Versuch einer begrifflichen Annäherung
- I.3.2. Kompetenzen in der Ergotherapie
- I.4. Motivationsfaktoren für lebenslange Lernprozesse
- I.4.1. Lernen im Erwachsenenalter
- I.4.2. Motivationstheoretische Überlegungen
- I.4.3. Motivationsprozesse erwachsener Lernender
- II. Empirische Untersuchung
- II. 1. Anliegen der Untersuchung und Untersuchungsfragen
- II.2. Methodisches Vorgehen der Untersuchung
- II.2.1. Das Experteninterview
- II.2.2. Auswahl der Stichprobe
- II.2.3. Konstruktion des Interviewleitfadens für das Experteninterview
- II.2.4. Interviewerhebungsphase
- II.2.5. Analysephase
- II.2.6. Auswertungsverfahren
- III. Ergebnisse
- III.1. Soziodemographische Daten
- III.2. Ergebnisse des Leitfadeninterviews
- III.2.1. Weiterbildungsmotive
- III.2.1.1. Motiv „persönliches Interesse“
- III.2.1.2. Motiv „berufliche Notwendigkeit“
- III.2.1.3. Motiv „Kompetenz- und Wissenserweiterung“
- III.2.1.4. Motiv „Karrierechancen verbessern“
- III.2.1.5. Motiv „sozialer Austausch“
- III.2.1.6. Interpretation und Diskussion
- III.2.2. Form und Inhalt der Weiterbildung
- III.2.2.1. Interpretation und Diskussion
- III.2.3. Hemmende und fördernde Einflussfaktoren
- III.2.3.1. Persönliche Situation
- III.2.3.2. Betriebliche Anreizsysteme
- III.2.3.3. Merkmale des Weiterbildungsmarktes
- III.2.3.4. Persönliche Dispositionen
- III.2.3.5. Interpretation und Diskussion
- III.2.4. Veränderungen durch Weiterbildung
- III.2.4.1. Interpretation und Diskussion
- III.2.5. Visionen und Zukunftswünsche
- III.3. Grenzen der Methodik
- IV. Zusammenfassung und Aussichten
- V. Verzeichnisse
- VI. Anhang
- Motivationsfaktoren für Weiterbildung bei ErgotherapeutInnen
- Strukturelle Bedingungen und Anreizsysteme für Weiterbildung
- Professionalisierungsprozesse in der Ergotherapie
- Kompetenzentwicklung und lebenslanges Lernen in der Ergotherapie
- Die Rolle der Ergotherapie im Gesundheitswesen und in der Gesellschaft
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Die Dissertation untersucht die Motivation von ErgotherapeutInnen in Österreich für Weiterbildungsaktivitäten im Kontext des lebenslangen Lernens. Das Hauptziel der Studie ist es, ein tieferes Verständnis der Faktoren zu erlangen, die die Teilnahme an Weiterbildungsmaßnahmen beeinflussen, sowohl in Bezug auf die persönlichen Motive als auch auf strukturelle Bedingungen und Anreizsysteme.
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Die Studie beginnt mit einer Einführung in das Thema lebenslanges Lernen im Berufsfeld der Ergotherapie und beschreibt die Bedeutung von Weiterbildung für die Qualitätssicherung in der therapeutischen Arbeit. Kapitel I beleuchtet theoretische Aspekte, beginnend mit einer Beschreibung des Berufsprofils der Ergotherapie, der Professionalisierungsprozesse und der Ausbildungssituation in Österreich. Es werden außerdem verschiedene Definitionen und Aspekte der beruflichen Weiterbildung sowie die Bedeutung von Kompetenzentwicklung im Kontext von lebenslangem Lernen erörtert.
Kapitel II beschreibt die empirische Untersuchung, die mittels Leitfadeninterviews mit 22 ErgotherapeutInnen durchgeführt wurde. Die Methode des Experteninterviews, die Auswahl der Stichprobe und die Konstruktion des Interviewleitfadens werden detailliert dargestellt. Darüber hinaus werden die Analysephase und die Auswertungsmethodik erläutert.
Kapitel III präsentiert die Ergebnisse der Untersuchung. Neben soziodemographischen Daten werden die wichtigsten Ergebnisse der Leitfadeninterviews in Bezug auf Weiterbildungsmotive, die Form und den Inhalt der Weiterbildung, hemmende und fördernde Einflussfaktoren, Veränderungen durch Weiterbildung sowie Visionen und Zukunftswünsche der Befragten dargestellt und interpretiert.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die zentralen Themen der Dissertation sind lebenslanges Lernen, Weiterbildung, Motivation, Ergotherapie, Professionalisierung, Kompetenzentwicklung, strukturelle Bedingungen, Anreizsysteme und Berufslaufbahngestaltung. Die Untersuchung konzentriert sich auf die Erhebung von Motivationsfaktoren für Weiterbildungsaktivitäten bei ErgotherapeutInnen in Österreich.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist lebenslanges Lernen für Ergotherapeuten wichtig?
Es dient der Qualitätssicherung der therapeutischen Arbeit, der Kompetenzerweiterung und der Positionierung des Berufsstandes im Gesundheitswesen.
Was motiviert Ergotherapeuten zur Weiterbildung?
Vorherrschend sind intrinsische Motive wie persönliches Interesse, der Wunsch nach Wissenserweiterung für effizientere Therapien und berufliche Notwendigkeit.
Welche Faktoren hemmen die Weiterbildungsbereitschaft?
Hemmende Faktoren sind oft mangelnde strukturelle Bedingungen am Arbeitsplatz, hohe Kosten, fehlende Karrieremöglichkeiten und eingeschränkter Zugang zu spezifischen Angeboten.
Wie ist die Ergotherapieausbildung in Österreich strukturiert?
Die Arbeit beleuchtet die Ausbildungssituation in Österreich und den laufenden Professionalisierungsprozess innerhalb der Gesundheitsberufe.
Welche Rolle spielen Anreizsysteme für das Lernen im Beruf?
Betriebliche Anreizsysteme und die Schaffung von Lernfreiräumen während der Arbeitszeit sind entscheidend, um die Motivation für lebenslange Lernprozesse aufrechtzuerhalten.
Details
- Titel
- Lebenslanges Lernen im Berufsfeld der Ergotherapie
- Untertitel
- Eine qualitative Erhebung von Motivationsfaktoren
- Hochschule
- University of Derby
- Note
- 2
- Autor
- Elisabeth Schmolmüller (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2006
- Seiten
- 108
- Katalognummer
- V308396
- ISBN (eBook)
- 9783668070059
- ISBN (Buch)
- 9783668070066
- Dateigröße
- 1856 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Ergotherapie Weiterbildung Lermotivation Qualitative Studie
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 39,99
- Preis (Book)
- US$ 50,99
- Arbeit zitieren
- Elisabeth Schmolmüller (Autor:in), 2006, Lebenslanges Lernen im Berufsfeld der Ergotherapie, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/308396
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-