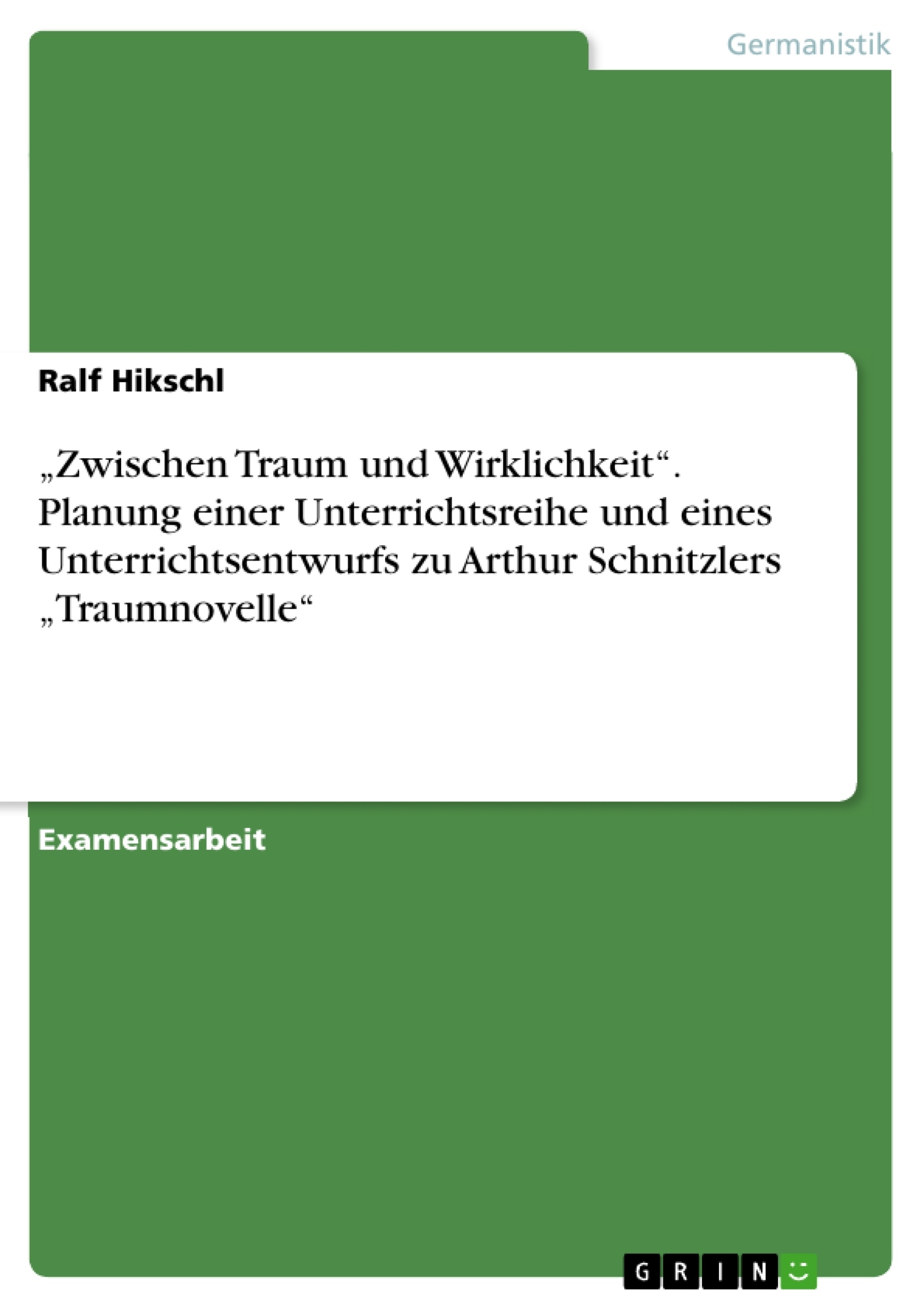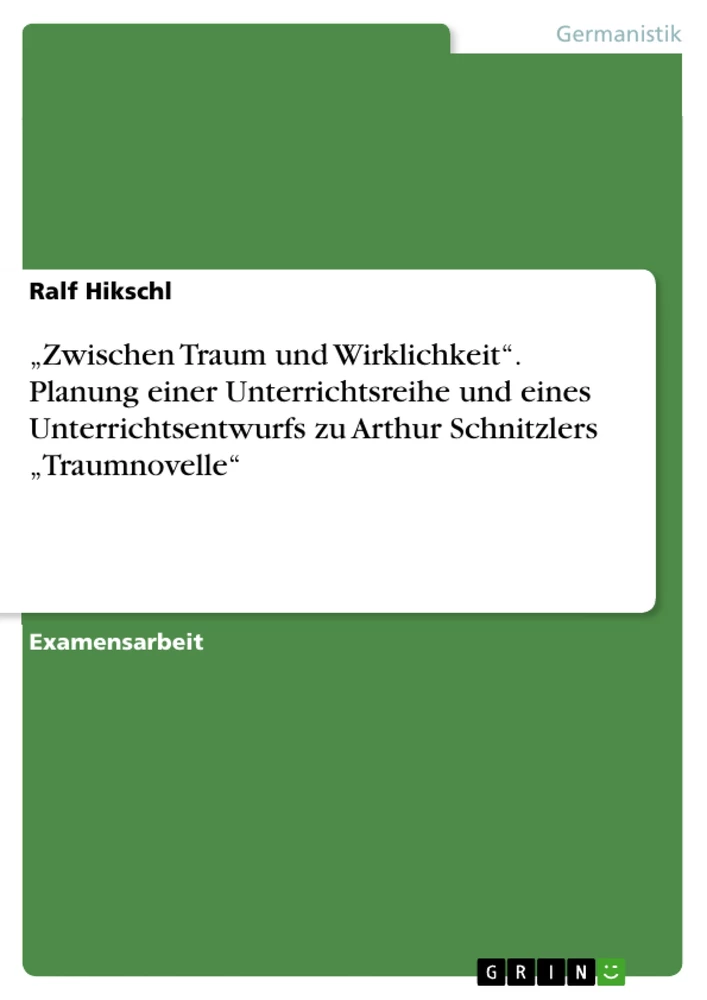
„Zwischen Traum und Wirklichkeit“. Planung einer Unterrichtsreihe und eines Unterrichtsentwurfs zu Arthur Schnitzlers „Traumnovelle“
Examensarbeit, 2013
20 Seiten, Note: 1,3
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Einleitung
- Curriculare Legitimation
- Übersicht über Kompetenzen im Rahmen der Unterrichtsreihe
- Reihenplanung „Das Ich zwischen Traum und Wirklichkeit“
- Themen und didaktischer Schwerpunkt
- Übersicht über die erwarteten Kompetenzen
- Verlaufsplan der Reihe
- Unterrichtsentwurf „Fridolin in der geheimen Gesellschaft“
- Sachanalyse
- Didaktisch/methodischer Kommentar
- Lehr- und Lernziele
- Tabellarischer Verlaufsplan
- Klausur
- Aufgabenstellung mit Erwartungshorizont
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Die Unterrichtsreihe „Das Ich zwischen Traum und Wirklichkeit – Die Macht des Unbewussten“ zielt darauf ab, Schnitzlers „Traumnovelle“ im Kontext der bürgerlichen Moral und der psychoanalytischen Theorien des Fin de Siècle zu analysieren. Die Reihe soll Schülerinnen und Schülern helfen, die literarische Form der Novelle zu verstehen, die Figurenkonstellation zu analysieren und den Konflikt zwischen Traum und Wirklichkeit in der Novelle zu deuten.
- Die Bedeutung des Traumes in Schnitzlers Werk und seine Verbindung zum Unbewussten
- Der Einfluss der Psychoanalyse Sigmund Freuds auf die literarische Darstellung des Traums
- Die Konflikte zwischen bürgerlicher Moral und sexuellen Bedürfnissen in der „Traumnovelle“
- Die Bedeutung der symbolischen Sprache in Schnitzlers Werk
- Die Rolle der Figurenkonstellation in der Entwicklung des Konflikts
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Die ersten beiden Stunden der Reihe dienen als Einstieg und sollen den Schülerinnen und Schülern einen persönlichen Bezug zum Thema Traum ermöglichen. In den darauffolgenden Stunden werden Sigmund Freud und seine Traumdeutung sowie die Zeit des Fin de Siècle und Arthur Schnitzlers Leben und Werk behandelt. Es folgt eine Einführung in die Textgattung der Novelle, die Handlung, den Inhalt und die Struktur von Schnitzlers „Traumnovelle“. Die folgenden Stunden befassen sich mit der Figurenkonstellation und den Beziehungen der Figuren zum Protagonisten Fridolin. Die siebte Doppelstunde, die den Schwerpunkt der Reihe bildet, konzentriert sich auf die Analyse der Szene, in der Fridolin die nächtliche Gemeinschaft besucht.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die wichtigsten Schlüsselwörter der Unterrichtsreihe sind „Traum“, „Unbewusstes“, „Psychoanalyse“, „Fin de Siècle“, „bürgerliche Moral“, „sexuelle Bedürfnisse“, „Novelle“, „Figurenkonstellation“, „Symbol“, „Motiv“, „Traumnovelle“, „Arthur Schnitzler“ und „Fridolin“.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in Arthur Schnitzlers „Traumnovelle“?
Die Novelle handelt von einer Ehekrise des Wiener Paares Fridolin und Albertine, ausgelöst durch unterdrückte sexuelle Sehnsüchte und die Vermischung von Traum und Wirklichkeit.
Welche Rolle spielt die Psychoanalyse Freuds in dem Werk?
Schnitzler integriert Freuds Theorien über das Unbewusste und die Traumdeutung, um die verborgenen Triebe und Ängste seiner Figuren darzustellen.
Was ist das zentrale Leitmotiv der Novelle?
Das zentrale Motiv ist der Traum, der als Brücke zum Unbewussten dient und die Grenze zur Realität im Laufe der Handlung verschwimmen lässt.
Welche Kompetenzen sollen Schüler durch diese Unterrichtsreihe erwerben?
Schüler sollen die Gattung der Novelle verstehen, literarische Symbole deuten und den Konflikt zwischen bürgerlicher Moral und individuellen Bedürfnissen analysieren können.
Warum wird die Traumnovelle oft als „Plädoyer für die Ehe“ gelesen?
Trotz der schweren Krise und der Infragestellung bürgerlicher Normen versöhnen sich Fridolin und Albertine am Ende, was als Bestärkung der ehelichen Bindung gedeutet werden kann.
Was kennzeichnet die Epoche des „Fin de Siècle“ in Bezug auf das Werk?
Das Fin de Siècle ist geprägt von einer Endzeitstimmung, der Beschäftigung mit der menschlichen Psyche und dem Aufbrechen traditioneller gesellschaftlicher Werte.
Details
- Titel
- „Zwischen Traum und Wirklichkeit“. Planung einer Unterrichtsreihe und eines Unterrichtsentwurfs zu Arthur Schnitzlers „Traumnovelle“
- Hochschule
- Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen (Germanistik)
- Veranstaltung
- Mündliches Examen
- Note
- 1,3
- Autor
- Ralf Hikschl (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2013
- Seiten
- 20
- Katalognummer
- V309740
- ISBN (eBook)
- 9783668103030
- ISBN (Buch)
- 9783668103047
- Dateigröße
- 720 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- zwischen traum wirklichkeit planung unterrichtsreihe unterrichtsentwurfs arthur schnitzlers traumnovelle
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 14,99
- Preis (Book)
- US$ 18,99
- Arbeit zitieren
- Ralf Hikschl (Autor:in), 2013, „Zwischen Traum und Wirklichkeit“. Planung einer Unterrichtsreihe und eines Unterrichtsentwurfs zu Arthur Schnitzlers „Traumnovelle“, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/309740
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-