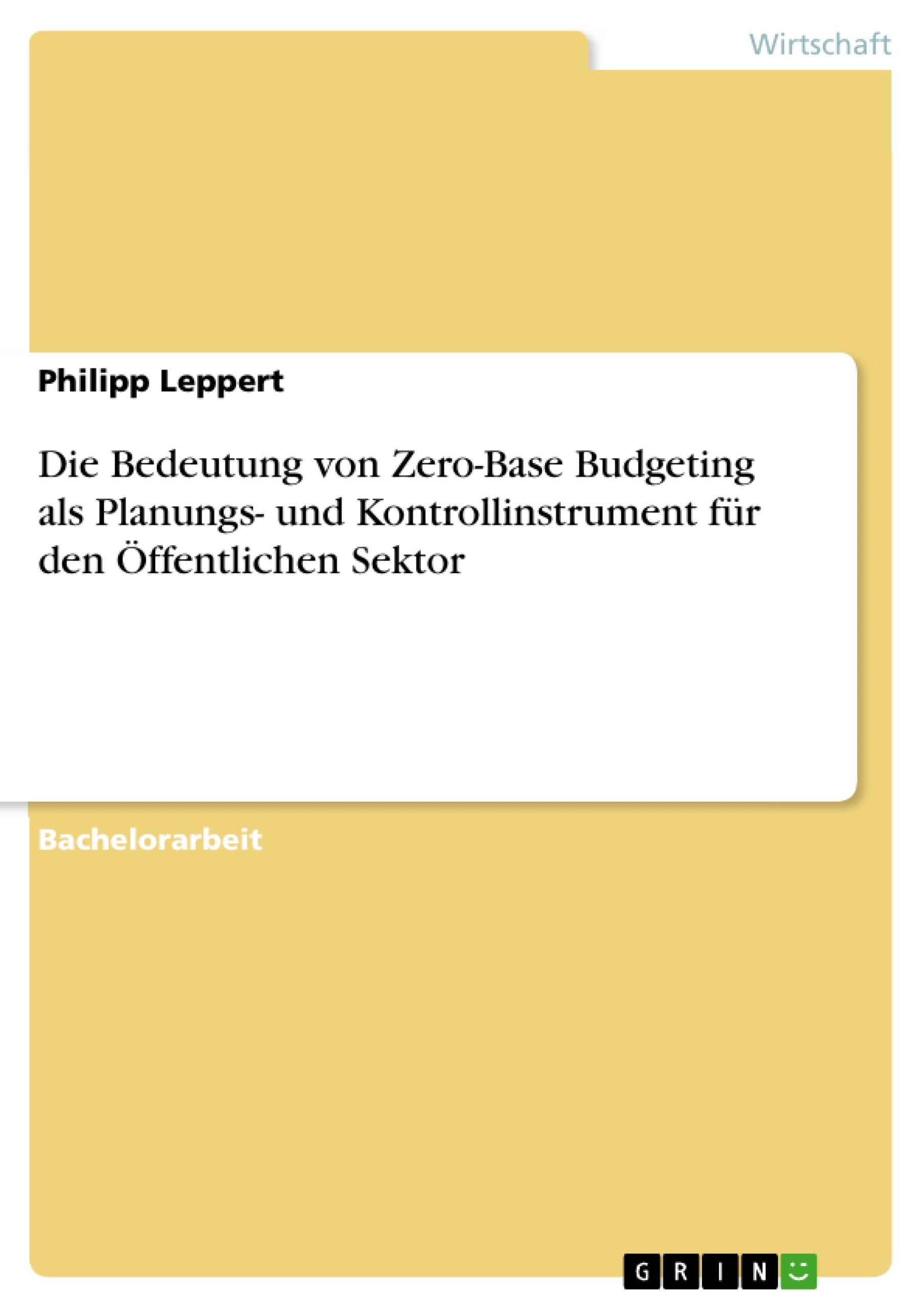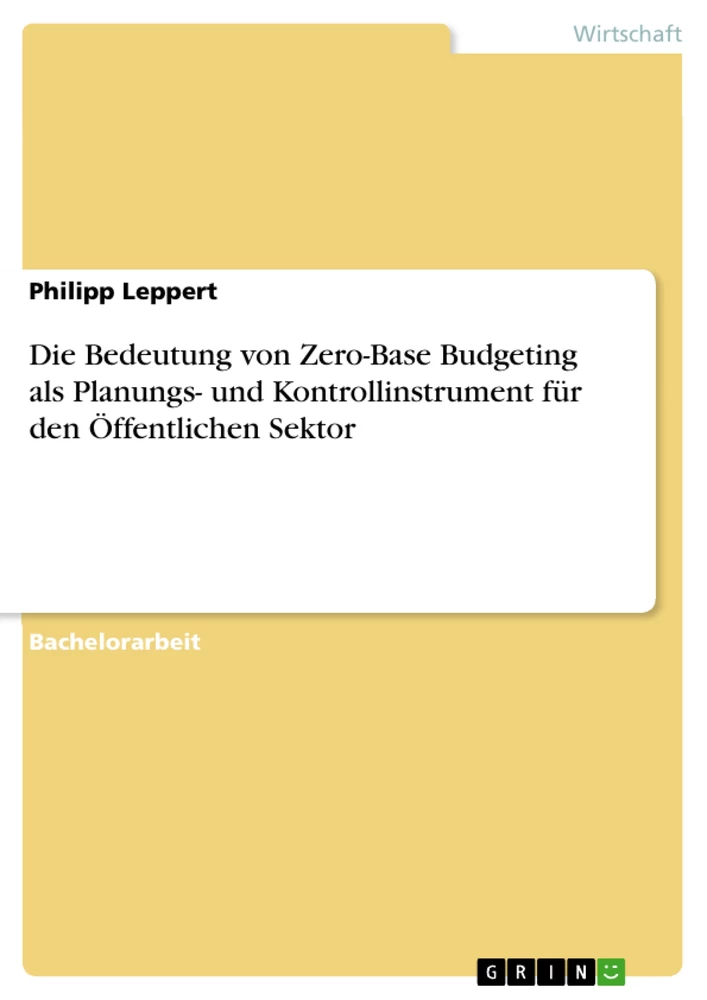
Die Bedeutung von Zero-Base Budgeting als Planungs- und Kontrollinstrument für den Öffentlichen Sektor
Bachelorarbeit, 2014
47 Seiten, Note: 1,3
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Problemstellung
- Historische Entwicklung
- Entstehung des Zero-Base Budgeting Konzeptes bei Texas Instruments
- Erste Implementierung im öffentlichen Sektor
- Folgejahre und Bezug zur Gegenwart
- Theoretische Grundlagen des Zero-Base Budgeting
- Anwendungsbereiche und Zielsetzung
- Private Unternehmen versus öffentliche Organisationen
- Zielerreichung durch systematische Evaluation
- Mission und Ziele von Organisationen - Planungsbezug
- Strukturierung und Durchführung
- Definition der Entscheidungseinheiten
- Entwicklung von Entscheidungspaketen
- Rangordnungsverfahren
- Anwendungsbereiche und Zielsetzung
- Das Zero-Base Budgeting Konzept in der öffentlichen Verwaltung
- Anwendung in den Vereinigten Staaten von Amerika
- Zero-Base Budgeting auf kommunaler Ebene
- Zero-Base Budgeting im Bundesstaat Georgia
- Zero-Base Budgeting in der Bundesregierung
- Implementierungsprobleme und praktische Bedeutung
- Innerer & Äußerer Widerstand gegen Zero-Base Budgeting
- Vermeidung von Budgetverschwendungen
- Performance Measurement in staatlichen Organisationen
- Anwendung in den Vereinigten Staaten von Amerika
- Zero-Base Budgeting im Vergleich
- Planning-Programming-Budgeting-System
- Target Base Budgeting
- Sunset-Legislation Konzept
- Program Review
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Die Arbeit befasst sich mit der Methode des Zero-Base Budgeting (ZBB) und untersucht ihre Anwendung im öffentlichen Sektor. Ziel ist es, die historische Entwicklung, Aktualität und grundlegende Methodik des ZBB-Konzepts zu beleuchten. Darüber hinaus wird analysiert, ob sich ZBB in der Vergangenheit im öffentlichen Bereich bewährt hat und ob sich Kostenreduktionen durch die Methode erreichen lassen.
- Historische Entwicklung und Aktualität von Zero-Base Budgeting
- Theoretische Grundlagen und Methodik des Zero-Base Budgeting
- Anwendung und Implementierung von Zero-Base Budgeting im öffentlichen Sektor
- Bewertung der Wirksamkeit von Zero-Base Budgeting in Bezug auf Kostenreduktionen
- Vergleich von Zero-Base Budgeting mit anderen Budgetierungskonzepten
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Das erste Kapitel führt in die Problemstellung ein und beleuchtet die Bedeutung von Budgetierung in betriebswirtschaftlichen und volkswirtschaftlichen Bereichen, insbesondere im öffentlichen Sektor. Es werden aktuelle Herausforderungen wie hohe Haushaltsdefizite und die Notwendigkeit einer effizienten Budgetplanung hervorgehoben.
Das zweite Kapitel behandelt die historische Entwicklung von Zero-Base Budgeting. Es beschreibt die Entstehung des Konzepts bei Texas Instruments und dessen erste Implementierung im öffentlichen Sektor. Die Kapitel beleuchtet auch die Folgejahre und den Bezug zur Gegenwart.
Das dritte Kapitel konzentriert sich auf die theoretischen Grundlagen von Zero-Base Budgeting. Es behandelt Anwendungsbereiche und Zielsetzung, wie Private Unternehmen versus öffentliche Organisationen, Zielerreichung durch systematische Evaluation und die Bedeutung von Mission und Zielen für die Planung. Außerdem werden die Strukturierung und Durchführung des ZBB-Prozesses, einschließlich der Definition von Entscheidungseinheiten, der Entwicklung von Entscheidungspaketen und des Rangordnungsverfahrens, erklärt.
Das vierte Kapitel befasst sich mit der Anwendung von Zero-Base Budgeting in der öffentlichen Verwaltung, insbesondere in den Vereinigten Staaten von Amerika. Es untersucht die Implementierung des Konzepts auf kommunaler Ebene, im Bundesstaat Georgia und in der Bundesregierung. Darüber hinaus werden Implementierungsprobleme und praktische Bedeutung von Zero-Base Budgeting diskutiert, einschließlich des inneren und äußeren Widerstands gegen die Methode und der Vermeidung von Budgetverschwendungen.
Das fünfte Kapitel vergleicht Zero-Base Budgeting mit anderen Budgetierungskonzepten wie Planning-Programming-Budgeting-System, Target Base Budgeting, Sunset-Legislation und Program Review. Dieser Vergleich soll die Stärken und Schwächen der verschiedenen Methoden hervorheben und die Eignung von Zero-Base Budgeting im Kontext der jeweiligen Alternativen beleuchten.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die Arbeit beschäftigt sich mit dem Themenbereich Zero-Base Budgeting (ZBB), einem Budgetierungskonzept, welches im öffentlichen Sektor Anwendung findet. Die wichtigsten Schlüsselbegriffe sind: Budgetplanung, Haushaltsdefizit, Kostenreduktion, öffentliche Verwaltung, Implementierung, Performance Measurement, Planung-Programmierung-Budgetierung, Zielgerichtetes Budgetierungssystem, Sunset-Legislation, Program Review, und Controlling.
Details
- Titel
- Die Bedeutung von Zero-Base Budgeting als Planungs- und Kontrollinstrument für den Öffentlichen Sektor
- Hochschule
- Hochschule Schmalkalden, ehem. Fachhochschule Schmalkalden
- Note
- 1,3
- Autor
- Philipp Leppert (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2014
- Seiten
- 47
- Katalognummer
- V310060
- ISBN (eBook)
- 9783668084032
- ISBN (Buch)
- 9783668084049
- Dateigröße
- 1078 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- bedeutung zero-base budgeting planungs- kontrollinstrument öffentlichen sektor
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 19,99
- Preis (Book)
- US$ 29,99
- Arbeit zitieren
- Philipp Leppert (Autor:in), 2014, Die Bedeutung von Zero-Base Budgeting als Planungs- und Kontrollinstrument für den Öffentlichen Sektor, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/310060
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-