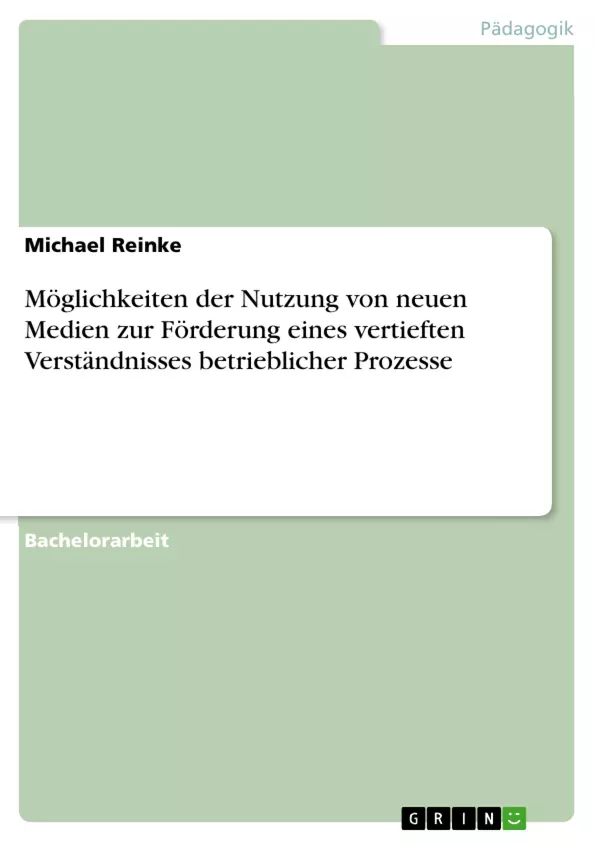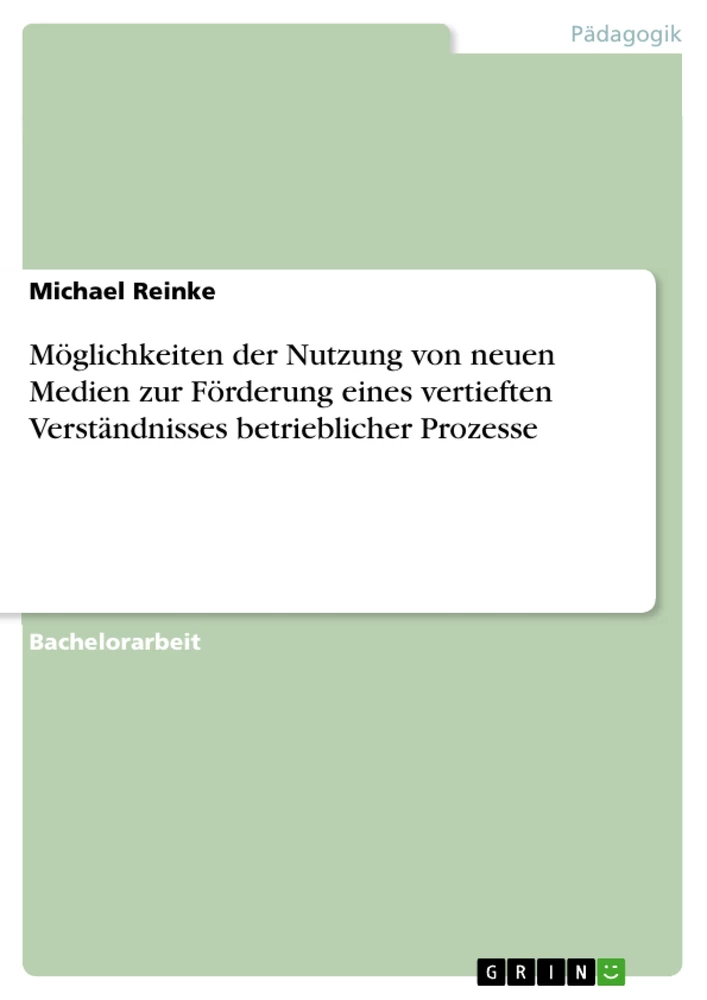
Möglichkeiten der Nutzung von neuen Medien zur Förderung eines vertieften Verständnisses betrieblicher Prozesse
Bachelorarbeit, 2013
32 Seiten, Note: 2,0
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- 1. Einleitung
- 1.1 Motivation
- 1.2 Vorgehensweise
- 1.3 Ausgangsbedingungen
- 2. Hauptteil
- 2.1 Prozessorientierung
- 2.1.2 Das Berufsbildungskonzept
- 2.1.2 Veränderung der Rahmenbedingungen
- 2.1.3 Prozessorientierung – ERP Einsatz
- 2.1.4 Medienkompetenz als Element einer zukunftsfähigen Bildung
- 2.2 Vertieftes Verständnis betrieblicher Prozesse fördern
- 2.2.1 Was bedeutet Lernen unter dem Aspekt einer (neuen) beruflichen Qualifizierung?
- 2.2.3 Situiertes Lernen in multimedialen Lernumgebungen
- 2.3 Umsetzung durch Neue Medien
- 2.3.1 Neue Medien und ihr Potenzial
- 2.3.2 E-Learning
- 2.3.3 Neue Medien in der beruflichen Bildung - Entwicklungsstand
- 3. Zusammenfassung - Diskussion - Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Diese Arbeit befasst sich mit dem Einsatz neuer Medien zur Förderung eines vertieften Verständnisses von betrieblichen Prozessen in der beruflichen Bildung. Sie untersucht die aktuellen Herausforderungen und Entwicklungen in diesem Bereich, insbesondere den Einfluss des demografischen Wandels und der Globalisierung. Die Arbeit zielt darauf ab, die Potenziale neuer Medien zur Anpassung von Bildungsangeboten an die veränderten Anforderungen der Arbeitswelt aufzuzeigen.
- Der Einfluss neuer Medien auf die berufliche Bildung
- Die Bedeutung von Prozessorientierung in der Berufsausbildung
- Die Förderung von Medienkompetenz als Schlüsselqualifikation
- Die Rolle von E-Learning und situiertem Lernen in multimedialen Lernumgebungen
- Herausforderungen und Chancen für die zukünftige Entwicklung der beruflichen Bildung
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
- Kapitel 1: Einleitung
Dieses Kapitel liefert einen einleitenden Überblick über die Motivation und den Kontext der Arbeit. Es beleuchtet die rasante Entwicklung neuer Medien und ihren Einfluss auf verschiedene Lebensbereiche, insbesondere die berufliche Bildung. Die Ausgangsbedingungen für den Einsatz neuer Medien in der beruflichen Bildung werden im Kontext des demografischen Wandels und der Globalisierung analysiert.
- Kapitel 2: Hauptteil
Der Hauptteil der Arbeit setzt sich mit der Prozessorientierung in der beruflichen Bildung auseinander. Er beleuchtet das Berufsbildungskonzept und die Veränderungen in den Rahmenbedingungen. Außerdem werden die Potenziale von neuen Medien wie E-Learning und multimediale Lernumgebungen für die Förderung von Medienkompetenz und einem vertieften Verständnis von betrieblichen Prozessen untersucht.
Schlüsselwörter (Keywords)
Neue Medien, berufliche Bildung, Prozessorientierung, Medienkompetenz, E-Learning, multimediale Lernumgebungen, demografischer Wandel, Globalisierung, betriebliche Prozesse, Qualifizierung, Bildungstechnologien, situiertes Lernen.
Details
- Titel
- Möglichkeiten der Nutzung von neuen Medien zur Förderung eines vertieften Verständnisses betrieblicher Prozesse
- Hochschule
- Ludwig-Maximilians-Universität München
- Note
- 2,0
- Autor
- M.Sc. Michael Reinke (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2013
- Seiten
- 32
- Katalognummer
- V311978
- ISBN (eBook)
- 9783668110144
- ISBN (Buch)
- 9783668110151
- Dateigröße
- 919 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Berufsbildungskonzept ERP Einsatz Medienkompetenz E-Learning Neue Medien
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 17,99
- Preis (Book)
- US$ 19,99
- Arbeit zitieren
- M.Sc. Michael Reinke (Autor:in), 2013, Möglichkeiten der Nutzung von neuen Medien zur Förderung eines vertieften Verständnisses betrieblicher Prozesse, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/311978
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-