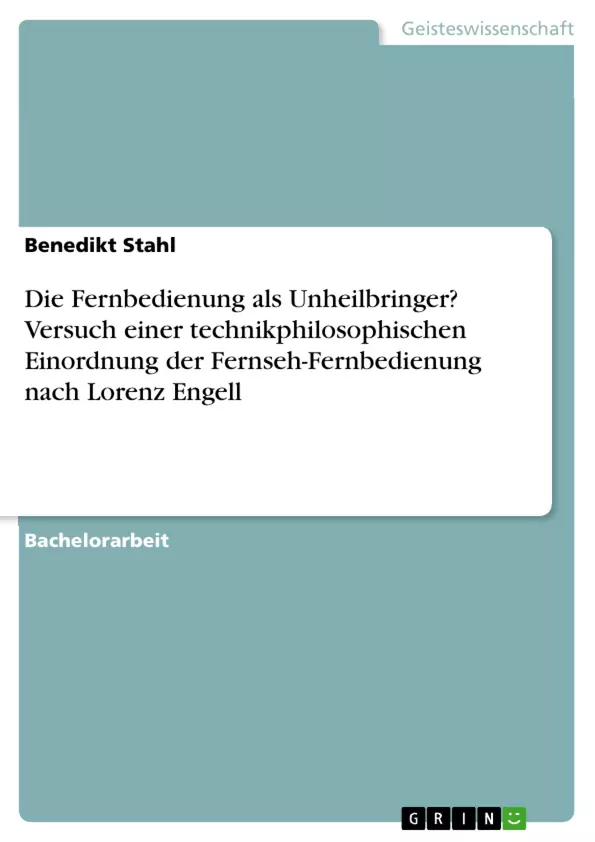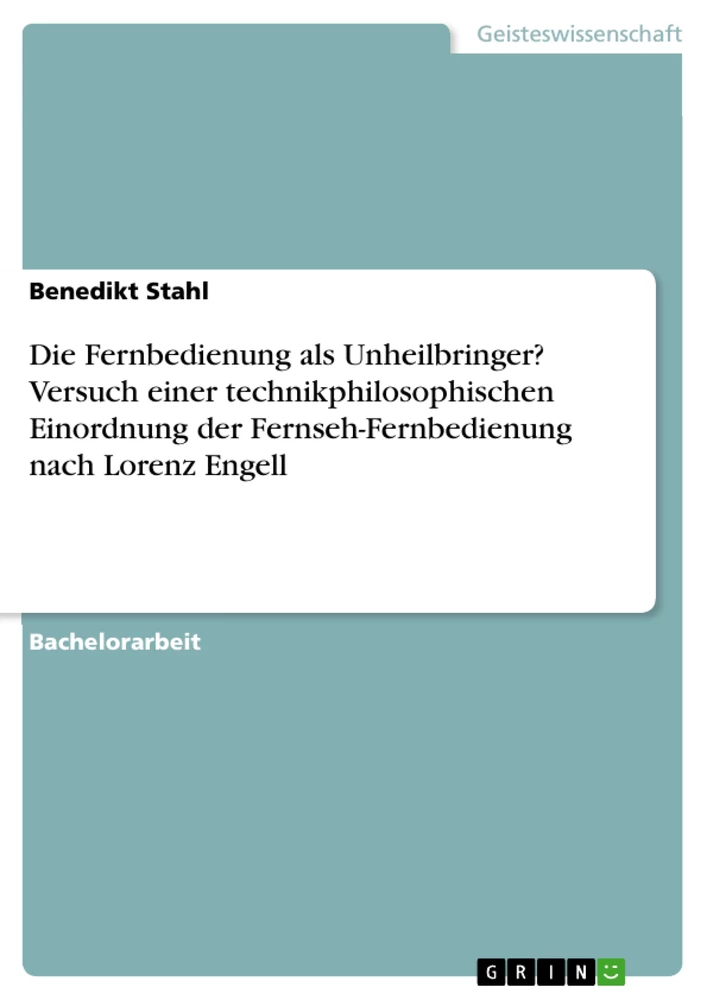
Die Fernbedienung als Unheilbringer? Versuch einer technikphilosophischen Einordnung der Fernseh-Fernbedienung nach Lorenz Engell
Bachelorarbeit, 2013
48 Seiten, Note: 1,0
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Lorenz Engell: Die Fernbedienung als Philosophische Apparatur
2.1. Fernsehtheorie nach Engell
2.2. Die Fernbedienung als Selektionsmaschine
2.3. Kritik
3. Konzeptionelle Folgen
3.1. Folgen fürdie Entwicklung der Fernsehlandschaft
3.1.1. Historische Entwicklung der Sendervielfalt
3.1.2. Das duale Rundfunksystem und seine inhaltlichen Folgen
3.2. Folgen fürden Fernsehkonsum
4. Technikphilosophische Betrachtung
4.1. Begriffskl ä rung Technikphilosophie
4.2. Die Fernbedienung als Unheilbringer
4.2.1. Günther Anders
4.2.1.1. Anders und die Prometheische Scham
4.2.1.2. Anders, das Fernsehen und die Fernbedienung
4.2.2. Martin Heidegger
4.2.2.1. Heidegger und die Frage nach der Technik
4.2.2.2. Heidegger und die Fernbedienung
4.3. Ernst Cassirer: die Fernbedienung als menschliche Kulturleistung
4.3.1. Die Symbolische Form nach Cassirer
4.3.2. Cassirer und die Technik
4.3.3. Cassirer und die Fernbedienung
5. Fazit
6. Einordnung innovativer Fernbedienungssysteme
6.1. Sprachsteuerung
6.2. Gestensteuerung
6.3. Einordnung
7. Kritik
Literaturverzeichnis
1. Einleitung
Besonders in den letzten 20 Jahren entfachen sich Diskussionen über das Für und Wider des Fernsehens immer wieder neu. Am heftigsten wird der Widerstreit, wenn ein neues Fernsehformat im Begriff ist, den Markt zu erobern. Was Anfang der 1990er Jahre mit den Daily Talks begann, nahm in der Folge seinen Lauf mit Formaten wie Big Brother, Castingshows und Gerichtssendungen bis hin zu den Scripted-Reality-Formaten, die heute ihren Marktanteil immer weiter ausbauen.
Neben dem allgegenwärtigen Bild des „Couchpotatoes“ ist dann immer wieder die Rede von „Volksverdummung“, „Niveauverfall“ und „Qualitätsverlust“. Als erster Verantwortlicher wurde schnell der Kampf um die Quote ausgemacht. Die Wissenschaft ließ derartige Vorwürfe nicht ungeprüft im Raum stehen und untersuchte das Phänomen Fernsehen in etlichen Studien zum Rezipientenverhalten oder durch umfangreiche Programm- und Marktanalysen. Den empirischen Erhebungen folgten ausgiebige Auseinandersetzungen von Medientheoretikern, die den grundlegenden Zusammenhängen von Fernsehen und Menschheitsentwicklung auf der Spur waren.
Die wenigsten von ihnen kamen jedoch darauf, auch das Fernsehzubehör in ihre Betrachtungen mit aufzunehmen. Die Fernbedienung fristete lange Zeit ein wissenschaftliches Schattendasein und entzog sich so jeglicher medientheoretischer Verantwortung. Lorenz Engell versuchte sich schließlich in seinem Aufsatz Tasten, w ä hlen, denken. Genese und Funktion einer Philosophischen Apparatur an einer fernsehtheoretischen Charakterisierung der Fernbedienung. Damit ist aber die Fernbedienung nur zu einem Teil analysiert. Denn was sie eigentlich ausmacht, aber gerne von ihren Benutzern und auch von der Fernsehtheorie übersehen wird, ist ihre Eigenschaft, ein technisches Gerät zu sein.
Damit eröffnet sich ein völlig neuer Betrachtungshorizont. Denn als technisches Gerät reiht sich die Fernbedienung dann in die kontroversen Diskussionen über Fluch und Segen der Technik ein. Zwar scheint die Fernbedienung angesichts der aktuellen Konflikte um Atomenergie, grüne Gentechnik oder Nanotechnologie eher bedeutungslos. Aber gerade am Beispiel der Fernbedienung kann deutlich gemacht werden, dass eine Reflexion über unsere technisierte Welt nicht erst dann beginnen kann, wenn bereits „Leib und Leben“ bedroht sind.
In dieser Ansicht gründet die Motivation der vorliegenden Arbeit. Denn gerade, wenn man sich professionell mit Technikkommunikation auseinandersetzt, sollte ein grundlegendes Verständnis vom Wesen der Technik vorhanden sein. In vielen Diskussionen über neue Technologien werden schlichtweg Nutzen und Nachteile gegenübergestellt, um dann vom Fluch oder Segen der Technik zu sprechen. Eine Reflexion, warum es überhaupt zur Entwicklung der jeweiligen Technologie gekommen ist, findet kaum statt. Diese Reflexion kann allerdings nur unter der Voraussetzung ablaufen, dass eine gewisse Grundkenntnis dessen, was Technik sein kann, vorhanden ist. Nur so lassen sich Technikentwicklungen und deren Folgen auf Mensch und Natur in ihrem vollen Umfang adäquat einordnen. Der Weg zu dieser Grundkenntnis soll hiermit am Beispiel der Fernbedienung nach Lorenz Engell geebnet werden.
Wenn wir nach dem Wesen der Technik fragen, befinden wir uns bereits im Feld der Technikphilosophie. Diese noch junge philosophische Disziplin (siehe 4.1.) beschäftigt sich mit der Ergründung der Zusammenhänge zwischen der Technik, dem Menschen und der Welt und geht dabei in besonderem Maße darauf ein, was Technik an sich ausmacht. Sie wird damit neben Engells Ausführungen zur Fernbedienung zum zweiten wichtigen Standbein dieser Arbeit.
In den nächsten Abschnitten soll nun also anhand der Frage, ob die Fernbedienung als Unheilbringer angesehen werden kann, erörtert werden, inwiefern der Mensch sich der Übermacht der Technik beugen muss oder sich ihr erwehren kann. Ausgehend von Lorenz Engells Aufsatz zur Fernbedienung nähert sich die vorliegende Arbeit der Beantwortung dieser Frage aus der Sicht der Technikphilosophie. Medien- oder fernsehtheoretische Aspekte, die keinen direkten Bezug zur Fernbedienung aufweisen, werden dabei außer Acht gelassen.
Im ersten Schritt soll allgemein die Fernsehtheorie Engells sowie im Speziellen seine Theorie der Fernbedienung untersucht werden. In einer darauffolgenden Darstellung der konzeptionellen Folgen der „Fernbedienung als Selektionsmaschine“ wird die Entwicklung der Sendervielfalt in Deutschland umrissen und ein Einblick in die Entstehung prägender TV-Formate gegeben. Auf dieser Grundlage wird die Arbeit nach einer Begriffsklärung der Technikphilosophie in zwei dialektische Stränge aufgeteilt, um die Frage nach dem Unheilbringer Fernbedienung zu beantworten. Auf der einen Seite wird anhand der Philosophen Günther Anders und Martin Heidegger das Entfremdungspotential der Fernbedienung dargestellt. Auf der anderen Seite steht die Technik als menschliche Kulturleistung. Hier werden die Ansichten Ernst Cassirers erläutert. Nach der Analyse des Technikverständnisses aller drei Philosophen wird der Versuch unternommen, die Fernbedienung technikphilosophisch zu bewerten. Als letzter Schritt folgt dann die Einordnung neuer Fernbedienungssysteme wie der Sprach-und Gestensteuerung.
2. Lorenz Engell: Die Fernbedienung als Philosophische Apparatur
Wie bereits in einleitend angekündigt, ist der Ausgangspunkt dieser Arbeit der Aufsatz Tasten, w ä hlen, denken. Genese und Funktion einer Philosophischen Apparatur von Lorenz Engell. Er wurde 2003 in einem Sammelwerk veröffentlicht, dass zur Klärung des Begriffs Medienphilosophie beitragen sollte. Engell konzentriert sich hierbei nur auf einen Teilaspekt der Medienlandschaft: Das Fernsehen. Über seine Grundauffassung der Fernsehtheorie kommt er schnell auf die Fernbedienung als Philosophische Apparatur zu sprechen. Bevor allerdings diese Vorstellung von der Fernbedienung genauer vertieft werden kann, ist es notwendig, das grundsätzliche Medienverständnis Engells zu kennen. Dankenswerterweise gibt Engell in ebendiesem Aufsatz auch eine einleitende Klärung der Voraussetzungen (also seines grundlegenden Medienverständnisses), die hier zunächst erläutert werden soll.
2.1. Fernsehtheorie nach Engell
Engells Fernsehtheorie leitet sich maßgeblich vom Medienverständnis Niklas Luhmanns ab. Luhmann definiert Kommunikationsmedien als „die operative Verwendung der Differenz von medialem Substrat und Form“ (Luhmann 1998, S. 195). Dieses mediale Substrat stellt nichts anderes dar als eine Menge lose gekoppelter Ereignisse, die unter bestimmten Umständen eine strikte Kopplung erfahren und somit zur Form werden. Als grundlegendstes Beispiel nennt Luhmann die Wahrnehmungsprozesse der Organismen: „Sie [die Wahrnehmungsprozesse] setzen spezifische Wahrnehmungsmedien wie Licht oder Luft oder elektromagnetische Felder voraus, die durch den wahrnehmenden Organismus zu bestimmten Formen gebunden werden können, die dann auf Grund komplexer neurophysiologischer Prozesse als bestimmte Dinge, bestimmte Geräusche, spezifische Signale usw. erscheinen und verwertet werden können“ (Luhmann 1998, S. 197).
Engell schlussfolgert daraus, dass erst durch die Bindung gekoppelter Ereignisse, z.B. durch Selektion, aus einem Medium eine wahrnehmbare und damit auch kommunikationsfähige Form entsteht. Die so geschaffene Form tritt dann in einen kontinuierlichen Prozess des ständigen Veränderns ein. „Diese Oszillation erst, in der ein in sich wandelbarer Bestand an möglichen Formen sich ständig selbst durch Aktualisierung überarbeitet, ist ein Medium“ (Engell 2003, S. 55). Engell sieht ein Medium an sich als zunächst nicht greifbar an. Medien seien Ermöglichungen, aus deren diffusem Zustand heraus sich Dinge entwickeln könnten. Medien seien grundsätzlich generativ (Engell 2003, S. 54). Bezogen auf das Medium Fernsehen, findet diese These auf besonders anschauliche Art und Weise Gültigkeit. Die Masse der Bilder, die durch die zahlreichen Fernsehstationen bereitgestellt wird, ist in ihrer Gesamtheit nicht zu ergreifen. Aber durch die Wahl (Selektion) eines Senders entsteht aus dem Medium eine greifbare Form, und für den Moment des Umschaltens überlagern sich das Medium als Gesamtraum der Möglichkeiten und die Form, das ausgewählte Programm. Mit jedem Umschalten entsteht durch Selektion etwas Neues, wird ein neuer Horizont aufgetan. Und mit nur einem Tastendruck fällt dieser in sich zusammen, um einem neuen Platz zu machen (Engell 2012, S. 137-138). Selektion wird hier zu dem zentralen Begriff in Engells Theorie des Fernsehens.
Bis es allerdings so weit kommen konnte, dass der Zuschauer vom Erwählten zum Wählenden wurde, war ein grundlegender Wandel notwendig. Während das Fernsehen in seiner Anfangszeit ein Objekt am Ort A an einen auserwählten - außerwählt deshalb, weil die Verbreitung von TV-Geräten anfangs auf privilegierte Orte oder Personen beschränkt war - Ort B visuell übertrug, kehrte sich dieses Selektionsprinzip mit der flächendeckenden Verbreitung der Fernsehapparate um. „Aus dem beliebigen und privilegierten Ort B werden schlichtweg alle Orte. Nicht mehr Strahlen der Erwählung in einen Möglichkeitsraum projiziert das Fernsehen, sondern eine dichte Zone der Erreichbarkeit, in der die Orte nicht einzeln, sondern spezifischerweise alle zugleich erreicht werden“ (Engell 2003, S. 60). Nun ist der Zuschauer vor dem TV-Gerät in der Position des Selektierenden.
Für Engell gipfelt dieser Prozess in dem Fernsehereignis schlechthin - der Liveübertragung der Mondlandung und den damit verbundenen TV-Aufnahmen des Planeten Erde im Ganzen. Denn als die Erde als Fernsehbild in die Haushalte der Menschen geschickt wurde, war das Objekt an Ort A gleichzeitig auch alle Orte B. Engell behauptet, dass durch diese Übertragung der Erde auf die Erde denkbar wurde, „dass alles zu jeder Zeit an jedem Ort sichtbar werden könnte“ (Engell 2003, S. 62). Und eben dieser Sachverhalt stelle das Sichtbarmachen als eigentliche Grundaufgabe des Fernsehens in den Hintergrund und mache schärfste Selektion und zwar des aktuell Sichtbaren vom möglich Sichtbaren nötig. (ebd.).
In seiner Rolle als Selektierender bedient sich der Zuschauer der Fernbedienung. Dieser Umstand führt in logischer Folge zu der Frage, wie die Fernbedienung in diesen Selektionsprozess einzuordnen ist. Engell äußert sich in seinem Aufsatz ausgiebig zu dieser Thematik und den daraus resultierenden Folgen. Seine Überlegungen sollen in den nächsten Abschnitten nicht nur zusammenfassend dargestellt werden, sondern auch auf ihre Gültigkeit hin überprüft werden.
2.2. Die Fernbedienung als Selektionsmaschine
Engell attestiert dem Fernsehen also ein Selektionsproblem, das aus der Denkbarmachung des möglich Sichtbaren (aber noch nicht sichtbar Gemachtem) resultiert. Er findet in der Geschichte der Entwicklung des Fernsehens drei Lösungsansätze, mit diesem Selektionsproblem umzugehen.
Der historisch gesehen erste Ansatz versucht, der Problematik zeitlich zu begegnen, indem das Fernsehprogramm anhand der verschiedenen Zielgruppen in Vormittags- (Hausfrauen), Nachmittags- (Kinder) und Abendprogramm (Vater und ganze Familie) unterteilt wird. So war der typische Haushalt in den 1960er Jahren gut versorgt. Doch dadurch ist das Problem nur solange gelöst, wie es keinen weiteren Sender gibt, der sein Programm zur gleichen Zeit ausstrahlt. Während in Deutschland zunächst nur ein Sender zur Verfügung stand, sendeten in den USA teilweise drei bis fünf Sender gleichzeitig (Engell 2003, S. 63).
Daher wich der zweite Lösungsansatz auf die räumliche Ebene aus. Was durch extra Fernseher, beispielsweise in Küche oder Hauswirtschaftsraum, begann, weitete sich schnell auf portable Minifernseher oder Bildschirme im öffentlichen Raum aus (ebd.).
Der dritte Ansatz schließlich bezieht sich auf die Fernbedienung. Wenn Engell diese als Selektionsmaschine beschreibt, meint er damit nicht eine Maschine, die automatisiert Auswahlprozesse ausführt. Vielmehr stellt die Fernbedienung eine schier unbegrenzte Anzahl an Auswahlmöglichkeiten bereit. Vor- und Zurückschalten, die Direktwahl eines anderen Programms, jede Einzelentscheidung eröffnet wiederum eine große Anzahl von Folgeentscheidungen. Damit scheint das Selektionsproblem alles andere als gelöst, da der Entscheidungsdruck nun ein viel größerer ist. Diesem Einwand hält Engell entgegen, dass in den gestiegenen Wahlmöglichkeiten immer auch die schnelle Revidierbarkeit einer (Fehl-)Entscheidung enthalten ist. Deswegen sei es durch geschickte Handhabung sogar möglich, mehrere Sendungen gleichzeitig zu verfolgen und so dem ungeheuren Selektionsdruck Herr zu werden (Engell 2003, S. 64).
Vor dem Hintergrund dieser Überlegung wagt Engell eine These, die die Grundlage der technikphilosophischen Betrachtungen der nächsten Kapitel bilden soll: Allein die Fernbedienung sei es, „ die ü berhaupt erst die explosionsartige Vermehrung des Programmangebots seit dem Ende der 70er Jahre erm ö glicht hat (Engell 2003, S. 67). Alle anderen Gründe (siehe 2.3.) hält er für „Symptome oder Auskristallisierungen eines mithilfe der Fernbedienung instrumentierten umbruchartig gesteigerten Selektionsprinzips“ (Engell 2003, S. 67). Damit kommt dem unscheinbaren Zubehörartikel Fernbedienung plötzlich die Rolle des Auslösers einer der bedeutendsten kulturellen Entwicklungen des ausgehenden 20. Jahrhunderts zu. Nämlich die des Fernsehens, wie es sich heute in seiner überwältigenden Flut verschiedenster Programme zeigt. Bevor diese Entwicklung des Fernsehens beschrieben wird - sie ist für die spätere technikphilosophische Einordnung von großer Bedeutung -, muss überprüft werden, ob die These Engells überhaupt haltbar ist und somit als Basis für die kommenden Betrachtungen dienen kann.
2.3. Kritik
Zu behaupten, die Fernbedienung sei alleinverantwortlich für die gestiegene Programmvielfalt und ihre Folgen (diese werden im nächsten Abschnitt behandelt), ist zweifelsfrei eine mutige Position. Denn es existieren durchaus Argumente, die Engells These deutlich in Frage stellen.
Der wichtigste Bezugsraum in dieser Diskussion ist die Historie. Exemplarisch für Westdeutschland können unterschiedliche historische Daten für die Beurteilung dienen. Als erstes die Etablierung der Fernbedienung als Standardzubehör für Fernseher ab 1976 (Engell 2003, S. 64). Darauf folgend die 3.
Rundfunkentscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 16. Juni 1981, die die prinzipielle Zulässigkeit von Privatsendern feststellte (Altendorfer 2001, S. 136). Ab 1983 die Verlegung des Kabelnetzes, das zunächst maximal 29 TVProgramme in die deutschen Haushalte brachte (Bundeszentrale für politische Bildung 2012a). Schließlich startete am 11. Dezember 1988 der Satellit Astra 1A ins All, der mit maximaler Abdeckung für theoretischen Fernsehempfang in ganz Deutschland und eine zusätzliche Erweiterung der Sendefrequenzen sorgte (Bundeszentrale für politische Bildung 2012b).
Rein historisch betrachtet ist es somit unmöglich, der Theorie von Lorenz Engell entgegenzustellen, dass die Fernbedienung erst durch die rechtlichen und technischen Grundvoraussetzungen ihre Existenzberechtigung erhält. De facto hatte sie sich nämlich bereits vorher in den Wohnzimmern ausgebreitet. Auch wenn hier die These Engells historisch nicht widerlegt werden kann, heißt dies im Umkehrschluss allerdings nicht, dass sie nun als bestätigt gilt.
Denn es ist zweifellos so, dass das Bundesverfassungsgericht bei seiner Urteilsfindung im Jahr 1981 weniger den Selektionsdruck der Fernbedienung im Sinn hatte, als vielmehr die Sicherung der Meinungsvielfalt in Deutschland. (Altendorfer 2001, S. 135). Zusätzlich muss hierbei auch auf den Zusammenhang zwischen technischem Entwicklungsstand und der Zulässigkeit von privaten Rundfunkangeboten hingewiesen werden. Denn bereits 1961 urteilte das Bundesverfassungsgericht in der 1. Rundfunkentscheidung, dass privater Rundfunk grundsätzlich möglich ist, allerdings nur, wenn die technischen Voraussetzungen einen wirtschaftlichen Betrieb ermöglichen (Strohmeier 2006). Während zuvor die Zahl der zur Verfügung stehenden Frequenzen in der terrestrischen Übertragungstechnik schlicht zu gering war, bot nun die Kabel- und Satellitentechnik die grundsätzliche Möglichkeit privater Rundfunkanstalten. Eine durch die Fernbedienung motivierte Einflussnahme auf die rechtlichen Rahmenbedingungen, genauso wie auf die Förderung der technischen Infrastruktur, kann daher nicht nachgewiesen werden.
Trotz der historisch klaren Sachlage, bleibt doch verwunderlich, warum die Fernbedienung zum Standard-Accessoire eines jeden Fernsehers wurde, noch bevor die Anzahl der Sender - bis 1984 existierten nur ARD, ZDF und Dritte Programme (Grisko 2009, S. 327) - auch nur annähernd das Potential dieses Apparats herausfordern konnten. Diese Frage will ich allerdings zunächst unbeantwortet lassen, da in ihrer möglichen Beantwortung ein gehöriges Maß an technischen Aspekten mitschwingt, die in dieser Arbeit erst zu einem späteren Zeitpunkt angemessen betrachtet werden können.
Weiter wäre, gerade wegen des Auftretens der privaten Sender, das Argument des wirtschaftlich-gewinnorientierten Handelns der These Engells gegenüberzustellen. Man könnte nämlich behaupten, der Konkurrenzkampf einer gestiegenen Anzahl von Sendern, die Gewinn erwirtschaften müssen, besäße eine Eigendynamik, die automatisch für eine gestiegene Programmvielfalt sorgte. Betrachtet man sich die Zusammenhänge genauer, wird man jedoch schnell zu dem Schluss kommen, dass die Einschaltquote viel zu eng mit der Betätigung der Fernbedienung verbunden ist, als dass eine Verneinung des Einflusses der Fernbedienung auf den Konkurrenzkampf der Sender haltbar wäre.
Es bleibt also festzuhalten, dass der Einfluss der Fernbedienung auf die Programmvielfalt nicht lückenlos nachgewiesen werden kann. Trotzdem kann er ebenso wenig komplett widerlegt werden. Vielmehr ist ein Zusammenspiel zu beobachten, in dem die Fernbedienung zuerst in einer Art „Stand-by“-Modus beteiligt war, um dann, beflügelt durch gesetzliche Regelungen und technische Innovationen, ihr volles Potential auszuschöpfen. Insofern behält die Behauptung von Engell für die weiteren Betrachtungen Gültigkeit, da der Einfluss der Fernbedienung auf die Verweildauer des Fernsehzuschauers bei einem Programm nicht geleugnet werden kann.
3. Konzeptionelle Folgen
Nach dieser abschließenden Kritik der Theorie der Fernbedienung, soll nun eine kurze Entwicklungsgeschichte hin zur heutigen Fernsehlandschaft gegeben werden. Denn wenn die Frage nach der Fernbedienung als Unheilbringer technikphilosophisch beantwortet werden soll, muss klar sein, was dieser technische Apparat an Entwicklungen und Folgen mit sich gebracht hat.
Angenommen Lorenz Engells These entspricht der Wahrheit: Die Fernbedienung ist der Grund für den rapiden Anstieg der Programmvielfalt. So ist die Schlussfolgerung berechtigt, dass die Fernbedienung einen maßgeblichen Faktor für die stark verschärfte Konkurrenzsituation im Wettbewerb der verschiedenen Fernsehsender darstellt. Diese sehen sich durch den unbekümmerten, da reversiblen Einsatz der Fernbedienung der ständigen Gefahr ausgesetzt, Zuschauer an andere Sender zu verlieren. Im Gegensatz zu den öffentlich-rechtlichen Sendern, die ihre finanzielle Sicherung durch die Rundfunkgebühr erfahren, sind die privaten Fernsehanstalten auf die Einnahmen aus der Werbung angewiesen. Dass die Werbeeinnahmen der Fernsehanstalten an ihre Einschaltquoten gebunden sind, muss in diesem Kontext nicht genauer erläutert werden. Der einzig logische Schluss für die Programmgestalter ist dann aber, auf eine konstante Reizansprache beim Zuschauer Wert zu legen. So soll dafür gesorgt werden, dass bereits
Zusehende nicht umschalten, während Umschaltende abgeworben werden können. Dieser wirtschaftliche Faktor wird im Rahmen der technikphilosophischen Betrachtung noch wichtig werden.
Die folgende Darstellung soll nun ausdrücklich kein Bild von Qualitätsverfall oder Qualitätsanstieg zeichnen, da die Frage nach dem Unheilbringer Fernbedienung, wie bereits der Untertitel dieser Arbeit vermuten lässt, der Technikphilosophie und nicht medientheoretischen Überlegungen überlassen werden soll. Außerdem interessiert natürlich nur der zeitliche Horizont, der mit der Auslieferung der Fernbedienung als Standardzubehör für Fernseher beginnt. Dabei soll, um den Rahmen dieser Arbeit nicht zu sprengen, auf Detailbetrachtungen verzichtet und nur die Entwicklung in Deutschland beleuchtet werden.
3.1. Folgen für die Entwicklung der Fernsehlandschaft
Rein historisch wäre die Entwicklung der Fernsehlandschaft anhand der immer neu entstehenden Sender in Kürze abzuhandeln. Aber damit sind noch nicht alle Folgen betrachtet. Denn das Auftreten der privaten Rundfunkanbieter resultierte nicht nur in einem höheren Programmangebot, sondern machte, in Deutschland wie auch in beinahe allen anderen europäischen Staaten, eine neue systematische Grundstrukturierung des Rundfunksystems notwendig.
Deswegen wird im ersten Schritt die historische Entwicklung der Sendervielfalt dargestellt, bevor in einem zweiten Schritt die inhaltlichen Folgen behandelt werden, die durch den Wechsel vom Public Service Model zum Dualen Rundfunksystem verursacht wurden.
3.1.1. Historische Entwicklung der Sendervielfalt
Die Kabelgebundene Fernbedienung taucht erstmals 1956 auf und wird in den 1960er Jahren durch die Ultraschallfernbedienung abgelöst. Seit 1976 liegt die Infrarotfernbedienung praktisch jedem neu erworbenen Fernsehgerät bei (Engel 2003, S. 64). Nachdem die bereits erwähnte 3. Rundfunkentscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 16. Juni 1981 die prinzipielle Zulässigkeit von Privatsendern feststellte und die technische Entwicklung soweit war, tauchte etwas zeitverzögert mit RTLplus (1984) der erste private Fernsehsender Deutschlands auf der Bildfläche auf. Kurz darauf folgten die ebenfalls privaten Sender Sat.1 (1985), MTV-Europe (1987) sowie Pro Sieben und Eurosport (beide 1989) (Grisko 2009, S. 327-328). Diese Reihe lässt sich so bis Mitte der 1990er Jahre fortführen. Ab 1994 ist dann ein neues Phänomen zu beobachten. Sowohl im öffentlich-rechtlichen, als auch im privaten-rechtlichen Bereich werden keine eigenständigen Vollprogramm-Sender mehr ins Leben gerufen. Stattdessen fokussieren sich die etablierten Sendeanstalten auf die Ausdifferenzierung ihres Angebots, indem sie Spartensender einrichten, die auf ein stark zielgruppenorientiertes Spezialangebot setzen (Woelke 2013, S. 166).
Mit dem Sendebeginn von Super RTL (Kinderprogramm) am 28. April 1995 begannen auch die Vollprogramm-Sender, speziell zugeschnittenes Spartenprogramm mit eigens dafür ins Leben gerufenen „Sub“-Sendern anzubieten. Ab 1997 gingen ARD und ZDF mit extra Angeboten (EinsPlus, Einsfestival, KiKA, ZDFinfo, ZDFneo etc.) für Kultur, Nachrichten und Jugend/Kinder auf Sendung (ARD 2013).
Die Privaten Sender differenzierten nach der Jahrtausendwende ihre Zielgruppen noch weiter und bieten mittlerweile Sender für Dokumentationsfans (DMAX), Männer (RTL Nitro), Frauen (sixx) und speziell für Frauen zwischen 49 und 64 Jahren (Sat.1 Gold) an (ProSiebenSat.1 Media AG 2013). Der neueste Vertreter dieser Sendergattung ist ProSieben MAXX, der seinen Betrieb Anfang September 2013 aufnahm. Damit zeichnet sich ein Bild etablierter Fernsehsender, die ihr Angebot durch ständig neu entstehende Spartensender auf jede denkbare Zielgruppe auszuweiten suchen.
Wie bereits einleitend erwähnt, bringt die gestiegene Programmvielfalt auch einen schärferen Konkurrenzkampf mit sich. Die Fernbedienung, die gewissermaßen als Katalysator für den Umschaltvorgang fungiert, reiht sich nun in einen Kreislauf ein, dessen Resultat ein ständig erweitertes Programmangebot ist. Um Zuschauer, die den Sender wechseln, nicht gänzlich zu verlieren, etablieren die Fernsehanstalten neue Spartensender. Die neuen Sender wiederum erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass umgeschaltet wird, was wieder neue Sender auf den Plan ruft.
Der Vollständigkeit halber seien auch noch die Pay-TV Sender erwähnt. Zwar hat sich deren Zahl allein in den Jahren 2004 bis 2010 von 34 auf 76 mehr als verdoppelt (Messner 2013, S. 69), allerdings reißt der vorgeschaltete Bezahlvorgang diese Sendergattung aus dem Zusammenhang der hier stattfindenden Betrachtungen heraus.
3.1.2. Das duale Rundfunksystem und seine inhaltlichen Folgen
Bis heute besteht in Deutschland das duale Rundfunksystem aus öffentlich- und privat-rechtlichen Sendern und hat seinen Ursprung in der bereits erwähnten 3. Rundfunkentscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Während die Privatsender darauf ausgelegt sind, durch Werbeeinnahmen Gewinn zu machen, sind die öffentlich-rechtlichen Sender durch die Rundfunkgebühren finanziert und gleichzeitig durch den Staatsvertrag f ü r Rundfunk und Telemedien (RStV 01.06.2009) verpflichtet, "der Bildung, Information, Beratung und Unterhaltung zu dienen. Sie haben Beiträge insbesondere zur Kultur anzubieten" (§ 11, Ziffer
1). Aber auch die privaten Sender haben nach der 4. Rundfunkentscheidung des Bundesverfassungsgerichts gewisse Mindestanforderungen zu erfüllen, „dazu gehöre der Schutz der Meinungsvielfalt, die Möglichkeit der Artikulation aller Meinungsrichtungen, auch von Minderheiten sowie der Schutz vorherrschender Meinungsmacht“ (Altendorfer 2001, S. 138).
Genau hier liegt aber ein entscheidendes Problem. Die privaten Sender, getrieben von Gewinnorientierung und freier von inhaltlichen Verpflichtungen, suchten ihr Heil im Unterhaltungssegment. Das zeigt sich deutlich in Erhebungen der Arbeitsgemeinschaft der Landesmedienanstalten Deutschland aus dem Jahr 2010. Demnach machte der Anteil reiner Unterhaltungsformate bei den Vollprogramm- Sendern der RTL Group (RTL, VOX, RTL II) jeweils mindestens 45% (RTL: 45%, VOX: 49%, RTL II: 54%) des Gesamtprogramm aus. Abzüglich der Sendezeit für Werbung und Mischformate aus Unterhaltung und Information blieben so nur 7,6% des Sendetages für reine Informationsformate. Noch drastischer stellen sich die Verhältnisse bei den Vollprogrammsendern der ProSiebenSat.1 Media AG (ProSieben, Sat.1, kabeleins) dar. Mit einem Unterhaltungsanteil von jeweils deutlich mehr als 50% (Sat.1: 57%, ProSieben: 62%, kabeleins: 60%) blieb für rein informierende Formate nur ein durchschnittlicher Sendezeitanteil von ca. 7,3% übrig. Im Vergleich dazu positionieren sich die ARD (44% Unterhaltung, 31% Information) und das ZDF (37% Unterhaltung, 37% Information) relativ ausgewogen. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass den Öffentlich-rechtlichen bei einem Werbeanteil von jeweils nur 5% ein weitaus höherer Netto-Anteil an Sendezeit für die Platzierung informierender Formate zur Verfügung steht (Weiß und Schwotzer 2012, S. 52- 57).
Es soll nun allerdings keine Aufzählung und Gegenüberstellung von Unterhaltungs- und Informationsformaten gegeben werden. Vielmehr soll gezeigt werden, wie die Programmentwicklung der privaten Sender Einfluss auf die Formate der öffentlich-rechtlichen genommen hat. Dabei wird sich die Betrachtung auf zwei für die deutsche Fernsehlandschaft äußerst prägende Beispiele beschränken. Der Daily Talk (Die t ä gliche Talkshow) und die Scripted- Reality -Formate.
In den 1990er Jahren wurde die „tägliche Talkshow“ zum maßgeblichen Bestandteil des Vor- und Nachmittagsprogramm. Thema dieser Talkshows waren die Alltagsprobleme „normaler Leute“. Allein diese Gattung zählte zeitweise mehr als 20 Vertreter, deren größter Teil um die Jahrtausendwende wieder verschwunden war.
Demgegenüber stehen die informierenden Talkshows, die sich mit den Bereichen Politik, Kultur oder Gesellschaft beschäftigen und in der Regel einmal pro Woche auf den Sendeplätzen öffentlich-rechtlicher Sender zu finden sind. Im Gegensatz zu den täglichen Talkshows haben sich diese Formate bis heute gehalten. Exemplarisch seien hier Anne Will, Hart aber fair oder Riverboat genannt. Bemerkenswert ist dabei, dass die tägliche Talkshow, das einstige Steckenpferd der privaten Sender, ihre letzte Vertreterin im öffentlich-rechtlichen Fernsehen fand. Inka! lief bis zum 08. November 2013 im Nachmittagsprogramm des ZDF (Wunschliste 2013).
Der nächste Trend, den die privaten Sender für sich entdeckten, waren die Scripted-Reality-Formate. Der Kampf um die Zuschauergunst sollte zunächst im Gerichtssaal ausgetragen werden. Zwar existierten im ZDF schon zuvor Gerichtssendungen, aber mit dem Start von „Richterin Barbara Salesch“ im Jahr 1999 folgten dann auch die privaten Sender diesem Trend. Sie machten aus dem öffentlich-rechtlichen Ansatz, durch die Nachstellung echter Fälle, Wissen über Gesetze und Gerichtsabläufe zu vermitteln, ein reines Unterhaltungsformat, dass sich mehr am Drehbuch der Autoren als an der Realität orientierte (Schröder 2013). Wenn sich auch die Gerichtsshow an sich auf dem Rückzug befindet, so wurde der Einfluss des Drehbuchs auf vermeintlich realitätsnahe Sachverhalte immer größer.
Mittlerweile hat sich die Scripted-Reality zu einem wichtigen Standbein der privaten Sender entwickelt. Bei den Formaten der fiktionalen Fernsehunterhaltung stieg beispielweise beim Sender VOX der Anteil der Scripted-Reality-Formate von 7,9% im Jahr 2011 auf 23% im Frühjahr 2012. Ähnliches ist bei Sat.1 mit einem Anstieg von 5,8% im selben Zeitraum zu beobachten (die medienanstalten 2013, S. 269). Scripted-Reality scheint außerdem dafür verantwortlich zu sein, dass RTL 2010 und 2011 zum Sender mit dem höchsten Marktanteil in Deutschland aufgestiegen ist. Den größten Zuschauerzuwachs konnte RTL nämlich in der Zeit von 12-18 Uhr verzeichnen, also dann, „wenn RTL seinen gescripteten Programmteppich ausgelegt hat“ (Weiß und Ahrens 2012, S. 62).
Weil mit solchen Sendungen allem Anschein nach der Zuschauernerv getroffen wird, läuft die Produktionsmaschinerie auf Hochtouren. Und selbst vor den öffentlich-rechtlichen Sendern macht diese neue Unterhaltungsform keinen Halt. Ein internes Dokument des NDR belegt, dass Redakteuren der Einsatz von Scripted-Reality-Elementen nahegelegt wird (Arbeitsgemeinschaft Dokumentarfilm 2010). Auch wenn hier die Qualität solcher Formate nicht diskutiert werden soll, so ist dennoch wichtig, nochmals darauf hinzuweisen, dass in Scripted-Reality-Formaten dem Zuschauer keine offensichtlichen Anhaltspunkte für das Einordnen von erfundenen und wahren Anteilen gegeben werden.
Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass durch die Aufgabenteilung im dualen Rundfunksystem rein formal eine ausgewogene Berichterstattung mit genügend Weiterbildungs- und Informationsmöglichkeiten gewährleistet wird. Durch den Konkurrenzkampf, in dem sich öffentlich-rechtliche und private Sender befinden, ist aber auf beiden Seiten ein Hang hin zu den Unterhaltungsformaten festzustellen, die mittlerweile in grotesken Formen ein völlig verzerrtes Bild der Wirklichkeit zeichnen und kulturelle oder informierende Formate in den Hintergrund drängen.
3.2. Folgen für den Fernsehkonsum
Inwiefern wirkt sich nun aber die Fernbedienung auf die Art des Fernsehkonsums aus? Mit ihrer Hilfe bewegt sich der Zuschauer in einer schier unerschöpflichen Programmauswahl aus den Bereichen Unterhaltung, Politik, Kultur, Musik, Wissen, etc. Wenn er seinen Fernsehkonsum nicht detailliert vorausgeplant hat, so sieht er sich mit jedem Tastendruck einem neuen Genre gegenüber, das er zunächst in einen Gesamtzusammenhang einordnen muss, um es für sich verarbeiten zu können. Abhängig von der Qualität seiner Auffassungsgabe können die kurzen Ausschnitte, die ihm die Fernbedienung anbietet, Orientierung und Wissen oder eben in Irritationen und Fehlinterpretationen hervorrufen.
Auf der anderen Seite steht das „Berieselungsfernsehen“. Beim Switchen durch die Programme kann sich der Zuschauer - rein theoretisch - in eine endlose Schleife des Suchlaufes begeben, ohne je eine Zielrichtung ausgegeben zu haben. Hartmut Winkler beschäftigt sich in Switching, Zapping ausgiebig mit dem Phänomen des ständigen Umschaltens, wie es die Fernbedienung möglich gemacht hat. Er stellt fest, dass die Konzentration des Zusehers, die durch das Fernsehen und gleichzeitig stattfindende Nebenbeschäftigungen (Hausarbeit, etc.) ohnehin schon gemindert ist, durch das Switchen noch diffuser wird (Winkler 1991, S. 53). Außerdem befreie sich der Zuseher mithilfe der Fernbedienung von den zeitlichen Vorgaben, die ihm das Fernsehen durch seine Programmgestaltung aufzuzwängen versucht. Allerdings werden durch die Fähigkeit, bei uninteressanten oder sich lang hinziehenden Stellen wegschalten zu können, auch Szenen aus ihrem ursprünglichen Sinnzusammenhang gerissen (Winkler 1991, S. 63-69) und dann in einem neuen, individuellen Sinnzusammenhang zusammengesetzt (Engell 2012, S. 130).
Ob diese Erscheinungen nun in Isolation von der Außenwelt und einem verzerrten Wirklichkeitsempfinden münden, oder einfach nur ein gelegentliches Abschalten vom ständigen Konzentriert-Sein bedeuten, soll, wie gesagt, nicht medientheoretisch erarbeitet werden. Es interessiert jetzt vielmehr, welche Einschätzungen die Technikphilosophie diesbezüglich liefern kann.
4. Technikphilosophische Betrachtung
Nun ist also die Charakteristik der Fernbedienung geklärt und ein Abriss über den Möglichkeitsraum, d.h. die möglichen strukturellen Folgen der Fernbedienung für das Programmangebot im Fernsehen, gegeben. Auf Grundlage der Erkenntnisse aus Kapitel 2 und 3 kann jetzt überprüft werden, welche Gestalt dieser technische Apparat Fernbedienung im Licht der Technikphilosophie annimmt.
Zu Beginn einer solchen technikphilosophischen Betrachtung ist aber, um Missverständnissen vorzubeugen, noch ein Zwischenschritt zu gehen. Erst wenn Herkunft, Methoden und das Wesen der Technikphilosophie geklärt sind, kann die Fernbedienung, die zweifelsfrei eine technische Errungenschaft ist, auch adäquat in den technikphilosophischen Gesamtzusammenhang eingeordnet werden. Außerdem wird zum Ende dieser Begriffsklärung das weite Feld der technikphilosophischen Betrachtungen sinnvoll eingeschränkt, um eine umfangsgerechte Untersuchung der Fernbedienung zu ermöglichen.
4.1. Begriffsklärung Technikphilosophie
Betrachtet man den stetigen technischen Fortschritt unserer Zeit und die weit vorangeschrittene Technisierung unseres Alltags, ist eine gründliche Auseinandersetzung mit den Verflechtungen zwischen unserer Welt und der Technik unabdingbar. Geht es in aktuellen öffentlichen Diskussionen z.B. um die Frage nach einem verantwortungsvollen Umgang mit der Atomenergie oder um die Einschätzungen von Nano- oder Gentechnologie, dann stecken dahinter immer auch technikphilosophische Fragestellungen. Auch wenn die Technik schon mit der Herstellung des ersten Werkzeugs die Menschheitsgeschichte begleitet, so ist die Technikphilosophie nicht mit traditionsreichen Disziplinen wie der Erkenntnistheorie oder der philosophischen Anthropologie gleichzusetzen. Vielmehr gestaltet sich eine Begriffsklärung der Technikphilosophie insofern als schwierig, da sie sich selbst zunächst vor drei Grundsatzproblemen sieht.
Alfred Nordmann hat sich an einer allgemeinen Einschätzung der Technikphilosophie versucht und dabei drei Probleme formuliert, die eine eindeutige Charakterisierung erschweren:
1. Technikphilosophie ist ein Fachgebiet ohne eigene Tradition
2. Technikphilosophie hat keine eigenen Fragen
3. Technikphilosophie hat keinen klar definierten Gegenstand (Nordmann 2008, S. 9-13)
Nordmann datiert die erstmalige explizite Erwähnung des Begriffes Technikphilosophie auf das Jahr 1877, nämlich in Ernst Kapps Grundlinien einer Philosophie der Technik (Kapp 1978). Das macht sie im Vergleich zu anderen philosophischen Disziplinen zu einer vergleichsweise jungen Vertreterin. Auch wenn sich bereits bei Philosophen wie Aristoteles, Kant oder Hegel grundsätzliches Interesse an technikphilosophischen Fragestellungen erkennen lässt (Nordmann 2008, S. 9), so brauchte es wohl erst die Industrialisierung und den weiteren technischen Fortschritt mit all seinen Vor- aber auch Nachteilen, um der Technikphilosophie als solcher genügend Eigendynamik zu verleihen, dass sich die ersten Denker ausgiebig mit ihr auseinandersetzten. Durch diese fehlende Tradition lässt sich die Technikphilosophie nur schwer mit wiederkehrenden Mustern beschreiben. Ob diese allerdings im Prozess der immer neuen technischen Entwicklungen jemals beobachtbar werden, darf als fraglich angesehen werden.
Vielleicht ist aber die Technikphilosophie gar nicht auf eine ausgeprägte Tradition angewiesen. Das zweite Problem, das Fehlen eigener Fragen, resultiert im Grunde nämlich nur daraus, dass technikphilosophische Fragestellungen eng mit den Fragen der philosophischen Anthropologie, der Natur- und Geschichtsphilosophie sowie der Erkenntnistheorie verknüpft sind (Nordmann 2008, S. 10). Wenn Nordmann darauf hinweist, dass Technikphilosophie im Grunde die ganze Philosophie noch einmal von vorn sei - diesmal unter Einbeziehung der Technik (Nordmann 2008, S. 10), dann nutzt sie die traditionsreiche Vorarbeit anderer Disziplinen und erweitert diese um den Technikgesichtspunkt. Sie stellt „die alten Fragen neu und angemessener“ (Nordmann 2008, S. 11). Angemessener schlicht deswegen, weil die Technik spätestens im letzten Jahrhundert einen viel zu hohen Stellenwert erlangt hat, als dass philosophische Grundfragen von ihr getrennt betrachtet werden könnten. Der Einfluss der technischen Entwicklungen auf das Wesen des Menschen, die Technik als Mittler zwischen uns und der Natur, aber auch die Entwicklung der Technisierung auf unserer Welt und der verantwortungsvolle Umgang mit technischem Wissen - all das sind unbestreitbar wichtige Fragen, die immer Elemente zweier Fachrichtungen beinhalten.
Bevor jetzt aber die nötige Einschränkung für die Betrachtung der Fernbedienung folgen kann, muss zunächst der wichtigste Aspekt der Drei-Punkte-Liste von Nordmann geklärt werden: Technikphilosophie hat keinen klar definierten Gegenstand. Damit ist gemeint, dass Technik ein weiter Begriff ist, unter dem man vom Herstellen eines simplen Werkzeuges über komplexe Maschinen bis hin zur Koordinationsfähigkeit eines Sportlers alles verstehen kann. Um dieses Problem zu umgehen, behilft sich Nordmann mit einer Definition von Armin Grunwald und Yannick Julliard: Technik sei das, was wir meinen, wenn wir über Technik reden (Grunwald/Julliard 2005, zit. aus: Nordmann 2008, S. 12). Damit wird Technik zum Reflexionsbegriff, eine Assoziation von Technik wird zu ihrem Ursprung zurückverfolgt und so zu einem Sinnbild von Technik. Nordmann schlussfolgert, dass Technikphilosophie, von einer unreflektierten Assoziation ausgehend, Fragen nach der Beziehung zwischen Mensch, Technik und der Welt stellt. Das sei die einzige Methode, die der Technikphilosophie zur Verfügung stehe (Nordmann 2008, S. 13).
Und genau hier kann nun die Fernbedienung in diesem Wechselspiel aus philosophischer Anthropologie, Erkenntnistheorie, Naturphilosophie und eben der Technikphilosophie betrachtet werden. Die Fernbedienung ist jetzt der (noch) unreflektierte Technikrepräsentant, von dem ausgehend gefragt werden soll, wie sich die Technik auf den Menschen und seine Umwelt auswirkt. Da die Diskussion um die Technik sich meist darum dreht, ob sie der Welt Fluch oder Segen bedeutet, wird die Fernbedienung anhand dieser beiden entgegengesetzten Grundhaltungen betrachtet werden. Auf der einen Seite die Technik als die Symbolisierung der Entfremdung des Menschen von sich selbst. Der Mensch soll hier eindringlich auf die Technik als Unheilbringer hingewiesen und vor ihr gewarnt werden. Auf der anderen Seite steht die Technik als menschliche Kulturleistung. Der Mensch, der sich mithilfe der Technik eine eigene Kultur erschafft, mit der er sich in der Welt zurechtzufinden versucht. Stellvertretend für die erste Richtung werden die Ansichten von Martin Heidegger und Günther Anders untersucht. Für die Ansicht der Technik als Kulturleistung steht Ernst Cassirer im Mittelpunkt. Die Arbeit aller drei Philosophen liegt zwar mehr als 50 Jahre zurück. Da sie aber für ein grundlegendes Verständnis von Technik gesorgt haben, auf dem auch heutige Technikphilosophen aufbauen, wird diese Arbeit sich auf diese „Grundlagenforschung“ beschränken. Ausgehend von einer allgemeinen Einordnung jedes einzelnen Vertreters wird zunächst dargestellt, in welcher Weise sie sich allgemein gegenüber der Technik positionieren. Danach wird analysiert, wie die Fernbedienung sich in das jeweilige Gedankengerüst einordnen lässt.
4.2. Die Fernbedienung als Unheilbringer
Den Anfang macht hier die negative Sichtweise der Technik. Das düstere Bild einer Technik, die Überhand über die Menschen gewinnt, ist ein allgegenwärtiges Thema. Selbst im dem von Technik durchdrungenen Medium Fernsehen wird es immer wieder aufgegriffen, was schon fast selbstironische Züge annimmt. Angefangen bei Filmen wie Metropolis (1927) von Fritz Lang oder Modern Times (1936) von Charly Chaplin, wo die Menschen an riesigen Maschinen schuften und auf den Rhythmus der Automaten getaktet werden, sind wir heute bei Filmen wie Matrix oder Terminator angelangt. Jetzt geben sich die Maschinen nicht mehr mit der Bestimmung unserer Arbeitsabläufe zufrieden. Sie haben ihr eigenes Bewusstsein entwickelt und sinnen auf das Auslöschen der Menschheit. Der drastische Anstieg dieser Gefahrendarstellung ist jedenfalls nicht zu übersehen. Und auch an der Philosophie ging das Gefahrenpotential der Technik natürlich nicht ungesehen vorüber. Das Warnen vor den Gefahren der modernen Technik ist in der Philosophie ebenfalls ein oft praktiziertes Vorgehen, weswegen die technikkritischen Philosophen im folgenden Vergleich zahlenmäßig überrepräsentiert sind. Dass sie deshalb im Laufe dieser Arbeit Recht behalten werden, ist allein deswegen allerdings noch nicht gesagt.
Nun mag es auf den ersten Blick schwer erscheinen, die Fernbedienung in diesen unheilbringenden Kontext todbringender Maschinen einzuordnen. Dieses, meist aus Plastik gefertigte, unscheinbare Kästchen mit vielen Tasten hat sich heute schon so in den Alltag eingefügt, dass es beinahe nicht mehr als technisches Gerät angesehen wird. Wer könnte dem schon eine größere Wirkung zuschreiben als die, die Szenerie auf dem Bildschirm zu verändern. Wie aber bereits gezeigt, hat die Benutzung der Fernbedienung noch viel weitreichendere Folgen. Deren negative Seiten sollen nun aus einem technikphilosophischen Blickwinkel betrachtet werden.
4.2.1. Günther Anders
Günther Anders (1902-1992) unterscheidet sich in vielerlei Hinsicht von den beiden anderen Philosophen, die noch Gegenstand dieser Arbeit werden sollen. Zum einen pflegte er nach seiner Promotion 1923 und einem gescheiterten Habilitationsversuch 1929 ein distanziertes Verhältnis zur wissenschaftlichen Hochschulphilosophie. Ein Umstand, der sich auf seine direkte Wortwahl und den weitestgehenden Verzicht auf philosophische Fachtermini auswirkte. Er selbst bezeichnete seine Arbeit als hybride Kreuzung von Metaphysik und Journalismus (Anders, 1961, S. 8). Zum anderen ist die Technik bei Anders nicht nur ein Teilaspekt, sondern das zentrale Thema, an dem er sich in seinem Hauptwerk Die Antiquiertheit des Menschen (1956) abarbeitet.
In seiner Technik- und (durchaus auch) Gesellschaftskritik zeichnet er ein sehr düsteres, fast schon apokalyptisches Bild der Technik. Neben der Atombombe und ihren Folgen für die Gesellschaft wird auch, und das macht Anders für diese Betrachtung besonders interessant, das Fernsehen und seine Wirkung auf den Menschen zu einem seiner Hauptthemen. Damit nimmt er die Einordnung der Fernbedienung in sein technikphilosophisches Gedankengerüst weitestgehend vorweg. Zunächst aber eine kurze Einführung in seine Technikauffassung und die Klärung, was Anders mit der Prometheische Scham zu beschreiben versucht. Danach werden seine Befürchtungen, die er mit dem Fernsehen verbindet, auf einen Zusammenhang mit der Fernbedienung untersucht werden.
4.2.1.1. Anders und die Prometheische Scham
„Die Tatsache der täglich wachsenden A-synchronisiertheit des Menschen mit seiner Produktewelt, die Tatsache des von Tag zu Tag breiter werdenden Abstandes, nennen wir ‚ das prometheische Gef ä lle ‘“ (Anders 1961, S. 16). Anders bedient sich hier der griechischen Mythologie, wonach Prometheus den Menschen das Wissen um den Zeitpunkt ihres Untergangs nahm, ihnen aber im Gegenzug die blinde Hoffnung sowie das Feuer - und damit die Technik - schenkte (Aeschylus 1819, S. 18). Damit beginnt für Anders eine Entwicklung der Technik, in der die Geräte und Maschinen immer perfekter und akkurater wurden, während der Mensch in seinem „imperfekten Handwerk“ verharrte (Grisko 2009, S. 99).
Während also die Technik sich zu immer neuen Höhen aufschwingt, ist der Mensch zu einem „Nachhumpeln“ verdammt. Für Anders hat das mehrere verheerende Folgen. Denn mit einem immer größer werdenden prometheischen Gef ä lle entzieht sich die Technik der Vorstellungskraft der Menschen. Für Anders gipfelt dieser Prozess in der Existenz der Atom- und der Wasserstoffbombe, die der Mensch zwar bauen kann, ihre Konsequenzen aber längst nicht mehr abzuschätzen im Stande ist (Anders 1961, S. 17). Ein direkter Bezug zu Prometheus´ Ausspruch: „Vorschau des Misglücks fernt´ ich von den Sterblichen“ (Aeschylus 1819, S. 18)
Aus dem prometheischen Gef ä lle leitet Anders außerdem den Ausdruck prometheische Scham ab. Er meint damit die Scham des Menschen für seinen eigenen Körper, der mit den Leistungen der Maschinen nicht mehr mithalten kann und ihnen in beinahe jeder Hinsicht unterlegen ist. Er schämt sich dafür, kein Teil der perfekten Dingwelt zu sein, die er geschaffen hat. Weil die erste Reaktion des Menschen auf Scham, wie Anders im Vorfeld erklärt, das Verstecken dieser Scham ist (Anders 1961, S. 28), flüchtet er - der Mensch - in eine Bejahung seiner Dinglichkeit und schaltet sich so mit den Dingen, also der Technik, gleich.
Er sieht die Welt nicht mehr aus seinem Blickwinkel, sondern aus dem der Technik (Anders 1961, S. 30).
Damit steuert der Mensch aber geradewegs auf die nächste Barriere zu. Mit dem weiteren Fortschritt der Technik findet sich der Mensch immer häufiger in Situationen wieder, in denen er sich selbst gewissermaßen als begrenzenden Faktor erlebt. Anders beschreibt eine solche Situation am Beispiel der Raumfahrt: Allein vom Standpunkt der Technik aus gesehen, wäre es möglich, in ausreichend schneller Geschwindigkeit andere Planeten zu erreichen. Aber die zu geringe Belastungsfähigkeit des menschlichen Körpers verurteile dieses Vorhaben bereits im Vorhinein zum Scheitern (Anders 1961, S. 34). Oder anders ausgedrückt: Der Mensch erfährt an den Möglichkeiten, an der Freiheit der Technik seine eigenen Grenzen, seine Unfreiheit. Alfred Nordmann fasst Anders´ Gedanken treffend zusammen, wenn er resümiert, die Technik vollziehe sich nicht mehr im Medium der Geschichte, sondern die Geschichte im Medium der Technik (Nordmann 2008, S. 114-115).
Dieses Diktat der Technik, das hier postuliert wird, schlägt auch schon die Brücke zu Anders´ Betrachtungen über Rundfunk und Fernsehen. Denn neben der Entwicklung der Atombombe sieht er auch hier zahlreiche Indizien für die Richtigkeit seiner These.
4.2.1.2. Anders, das Fernsehen und die Fernbedienung
Zwar erschien Die Antiquiertheit des Menschen bereits 1956, in einer Zeit also, in der an die heutige Fernbedienung noch nicht zu denken war. An Aktualität aber hat die Kritik, die Anders am Fernsehen übt, eher gewonnen als verloren. Wir erinnern uns an die Folgen der Fernbedienung, wie sie in Punkt 3 dieser Arbeit dargestellt wurden. Das immer weiter gestiegene Programmangebot, das der Fernbedienung zugeschrieben wird, macht die Ausführungen Anders´ geradezu brandaktuell. Es wird daher im Folgenden erlaubt sein, aus seinen Aussagen über das Fernsehen auf den „Verursacher“ oder zumindest den „Multiplikator“ Fernbedienung zurückschließen zu dürfen.
Anders macht an der Etablierung des Fernsehens einen tiefgreifenden Wandel im Welterleben des Menschen fest. War dieser zuvor „gezwungen“, Filme im Kino als Gemeinschaftserlebnis zu erfahren, so bewegt er sich jetzt, mit seinem eigenen Fernseher im Wohnzimmer, auf ein immer häufiger stattfindendes Individualerlebnis zu. Das Massenmedium Fernsehen macht ihn zu einem „Masseneremiten“, der isoliert von seinen Mitmenschen, die Welt nur noch an seinem Bildschirm erlebt. Das schlimmste daran: Er bemerkt sein Absinken in die Welt des Massenkonsums, den Identitätsverlust und seine Transformation in einen Massenmenschen nicht. Durch die vermeintliche Individualität (der eigene Fernseher im eigenen Haus) geht er davon aus, seine persönliche Freiheit zu wahren, obwohl er sie schon längst an das Fernsehen abgegeben hat (Anders 1961, S. 102-104). Auf die Fernbedienung bezogen, würde in diesem Fall die Illusion der individuellen Freiheit geradezu potenziert werden. Denn die vielen Programmtasten in direkter Nähe zum Zuschauer, lassen ein zeitlich selbstbestimmtes Umschalten zur leichtesten Übung werden.
Der Trend zur Eremitisierung hört für Anders allerdings nicht im eigenen Wohnzimmer auf. Auch innerhalb der Familie stellt er eine zunehmende soziale Isolation fest. Der Wohnzimmertisch, zuvor Symbol der kommunikativen Familienzusammenkunft, wird zunehmend vom TV-Apparat abgelöst. Vor diesem sitzen die Menschen zwar zusammen, sind sich aber eigentlich weit entfernt. Anders nennt es den „negativen Familienmensch“ (Anders 1961, S. 106), wenn alle Familienmitglieder vor dem Fernseher versammelt sind, jede Kommunikation oder andere soziale Interaktion aber hinter den flimmernden Bildern zurücktreten muss (ebd.). Der Fernbedienung allerdings muss hier, wenn auch in geringem Maße, eine gegenteilige Funktion zugesprochen werden. Denn sie entfacht ja zumindest widerstreitende Diskussionen über die Wahl des passenden Programms für die gesamte Familie. Ein Effekt, der natürlich nicht auftritt, wenn der Zuseher alleine vor dem Apparat sitzt.
Anhand eines leicht überspitzten Wortspiels leitet Anders eine Konsequenz dieser Sprachlosigkeit vor dem Fernseher ab. Die Menschen, die das Sprechen an die Geräte abgegeben haben, beschränken sich nur noch auf das Hören. Das degradiere sie zu Hörigen und Unmündigen (Anders 1961, S. 107). In direkter Folge attestiert Anders den Menschen eine zunehmende Sprach- und Erlebensverarmung und damit eine Verarmung des Menschen selbst, weil „das ¸Innere’ des Menschen: dessen Reichtum und Subtilität, ohne Reichtum und Subtilität der Rede keinen Bestand hat“ (Anders 1961, S. 109).
Nach diesen einleitenden Beispielen für den Einfluss des Fernsehens auf das Wesen des Menschen kommt Anders zu dem für ihn wichtigsten Punkt seiner Betrachtungen. Mit der Lieferung der Welt in das Haus des Zuschauers verändert sich nämlich nicht nur der Zuschauer, sondern mit ihm auch die Realität der Welt. Denn wenn die Welt nur noch über den Fernseher zu uns kommt, nehmen wir nicht mehr an der Welt teil, sondern konsumieren diese nur. Die mangelnde reale Welterfahrung wiederum nimmt dem Menschen die Fähigkeit, das Fernsehbild von der Wirklichkeit zu unterscheiden. Fehlgeleitet vom Vorbild dieser virtuellen Wirklichkeit - dem Phantom, wie Anders es ausdrückt -, strebt der Mensch im echten Leben diesen „falschen Idealen“ nach und lässt sie somit doch echte Wirklichkeit werden (Anders 1961, S. 111-112). Ein Effekt, der durch die neu entstandenen Scripted-Reality-Formate natürlich noch verstärkt wird. Kurzum: Das Fernsehen hat wirklichkeitsverändernden Charakter und zwängt so den unfreien Zuschauer in seine vorgegebenen Strukturen.
Inwiefern kann nun der Fernbedienung eine Mitschuld an dieser Entwicklung gegeben werden? Der erste Gedanke wäre doch, dass durch die massenhaften Auswahlmöglichkeiten, die die Fernbedienung verursacht hat, ein umfangreicheres und dadurch wirklichkeitsnäheres Bild der Welt beim Betrachter ankommt. Das allerdings würde den Prozess der Wirklichkeitsveränderung ja allenfalls abbremsen aber nicht aufhalten. Abgesehen davon kann dieses Argument auch leicht ins Gegenteil verkehrt werden, wenn man sich Hartmut Winklers Worte (siehe 3.2.) ins Gedächtnis ruft und behaupten kann, dass durch das ständige Wechseln der Programme ein noch stärker verzerrtes Bild der Welt entsteht, als dies allein durch das Fernsehen schon der Fall ist. Hinzukommt noch das Zustandekommen von Scripted-Reality-Formaten, das in den konzeptionellen Folgen (Punkt 3) bereits genannt wurde. Hier wird der wirklichkeitsverzerrende Faktor natürlich sehr drastisch aufgezeigt.
Deutlich fördernd wirkt sich die Fernbedienung auf den Phantomcharakter der Welt aus. Durch das ständige Aufblitzen immer neuer Bildausschnitte, verstärkt sich der Eindruck einer „halb an- und halbabwesenden“ Welt (Anders 1961, S. 111). Ebenfalls unbestreitbar ist, dass durch das massenhafte Programmangebot und den leichten Wechsel vom fad Gewordenen zum interessanten Neuen die Hemmschwelle steigt, sich eben doch vom Fernsehsessel aufzuraffen und die Welt selbst zu erfahren, statt sie geliefert zu bekommen. Bis jetzt hat sich also der Eindruck vom Unheilbringer Fernbedienung bestätigt. Ob sich dieses Bild von der Fernbedienung hält, soll zunächst an Heideggers Ansicht der Technik überprüft werden.
4.2.2. Martin Heidegger
Martin Heidegger (1889-1976) spielt in der Philosophie des 20. Jahrhunderts eine herausragende und gleichermaßen umstrittene Rolle. In seinem ersten Hauptwerk Sein und Zeit (1927) hat er sich mit der Frage nach dem Sinn von Sein beschäftigt. Stand zu diesem Zeitpunkt eine Daseinsanalytik, also eine Analyse des „faktischen Lebens“ im Vordergrund, so sollte er diese im späteren Verlauf seines Schaffens revidieren und als neuen Ausgangspunkt aller Überlegungen das „Sein selbst“ fordern, also das Sein als Ereignis und nicht als verdinglichtes Subjekt. Damit wendet sich Heidegger von den Herangehensweisen der abendländischen Philosophie und somit von metaphysischen Betrachtungsweisen ab (Trawny 2003, S. 15-17). Diese sogenannte seinsgeschichtliche Kehre verursachte bei vielen Lesern Ablehnung oder ein Gefühl der Unzugänglichkeit (Fischer 2012, S. 213).
Ein Teil seiner Kritik an der Metaphysik richtet sich an die durch Descartes begründete Subjektphilosophie. Hier wird der Mensch zum „Grund des »Seins«, als Subjekt, als dasjenige, was allem anderen zu Grunde liegt (subiectum = das Untergelegte)“ (Trawny 2003, S. 52). Dieser Ansicht widerspricht Heidegger und findet gerade bei der Technik und der Frage nach ihrem Wesen entsprechende Gegenargumente (siehe 4.2.2.1.).
Die Tatsache, dass Heidegger in seinen Schriften eine neue philosophische Sprache entwickelt, sorgt oft für gegenläufige oder fehlerhafte Interpretationsansätze (Fischer 2012, S. 214). Nicht zuletzt deswegen dürfte er für seine Auseinandersetzungen mit dem Wesen der Technik als Technikfeind
schlechthin bezeichnet worden sein. Eine Einschätzung, die allerdings unter Interpreten seines philosophischen Werks angezweifelt wird (Trawny 2003, S. 150; Luckner 2012, S. 54-55).
4.2.2.1. Heidegger und die Frage nach der Technik
In den Jahren nach dem zweiten Weltkrieg beschäftigte sich Heidegger intensiv mit der Frage nach der Technik. Im gleichnamigen Vortrag, den Heidegger am 18. November 1953 an der Technischen Hochschule München hielt, versucht er, das Wesen der Technik zu beschreiben.
Auch Heidegger sieht, ähnlich wie in der Begriffsklärung der Technikphilosophie schon erläutert, die Notwendigkeit, Technik an sich und das Wesen der Technik zu unterscheiden. Solange nur das Technische betrachtet wird, meint Heidegger, bleibt die Beziehung der Menschen zum Wesen der Technik verborgen. Hier mahnt er eindringlich, die Technik nicht als etwas Neutrales zu betrachten. Denn das würde uns vollends blind gegen das Wesen der Technik machen (Heidegger 2009, S. 9).
Besonders wichtig ist Heidegger zudem die Unterscheidung von der vormaligen und der modernen Technik. Denn nur innerhalb der modernen Technik kann es zu den Gefahrensituationen kommen, vor denen Heidegger nachdrücklich warnen will. Bevor aber von dieser Gefahr die Rede sein kann, soll zunächst der Unterschied von vormaliger und moderner Technik, wie Heidegger ihn sieht, geschildert werden. Beide Formen der Technik sind demnach zunächst einmal Vorgänge des Hervorbringens, des Herstellens. Das Her-vor-bringen, wie Heidegger mit schriftlichen Mitteln zu verdeutlichen sucht, sei der Prozess, etwas Verborgenes ins Unverborgene kommen zu lassen (Heidegger 2009, S. 15). Heidegger nennt diesen Prozess Entbergen und charakterisiert damit die Technik als Weise des Entbergens, des Aufdeckens der Wahrheit (Heidegger 2009, S. 16). Moderne und vormalige Technik teilen sich die Eigenschaft des Entbergens. Während die vormalige sich mit dem Hervorbringen „begnügt“, ist das Entbergen der modernen Technik durch ein Herausfordern/ ein Stellen (der Natur) bestimmt. „Ackerbau ist jetzt motorisierte Ernährungsindustrie. Die Luft wird auf die Abgabe von Stickstoff hin gestellt, der Boden auf Erze, das Erz z.B. auf Uran, dieses auf Atomenergie, die zur Zerstörung oder friedlichem Nutzen entbunden werden kann“ (Heidegger 2009, S. 18).
Für Heidegger zielt dieses Herausfordern auf das Herausfördern von Ressourcen aus der Erde ab, um diese (Ressourcen) für die Energiegewinnung bereitzustellen. Sie werden zum Bestand. Als Bestand bezeichnet Heidegger alles, was vom herausfordernden Entbergen betroffen wird (Heidegger 2009, S. 20). Der Mensch sorgt zwar durch das Entbergen für den Bestand, die Wahrheit aber, die im Unverborgenen liegt, kann er nicht beeinflussen. Heideggers Folgerung: „Nur insofern der Mensch seinerseits schon herausgefordert ist, die Naturenergien herauszufördern, kann dieses bestellende Entbergen geschehen“ (Heidegger 2009, S. 21). Damit wird der Mensch selbst zum Bestellten, da er eigentlich nur herstellt/entbirgt, um das Verlangen der Technik nach Rohstoffen zu befriedigen (Heidegger 2009, S. 21-22). Aus diesem Wechselspiel von „stellen“ und „bestellt sein“ entwickelt Heidegger den zentralen Begriff des Ge-stells, mit dem er „die moderne Technik, aber auch die Verfangenheit der Menschen in ihrem seinsvergessenen Wesensbereich bezeichnet“ (Nordmann 2008, S. 49). Der Mensch ist also im Ge-stell enthalten und somit auch in allem, was je technisch erschaffen wurde. Behauptungen, der Mensch würde somit nur noch sich selbst begegnen, erteilt Heidegger eine Absage: „Indessen begegnet der Mensch heute in Wahrheit gerade nirgends mehr sich selber, d.h. seinem Wesen“ (Heidegger 2009, S. 31). Alfred Nordmann fasst Heideggers Überlegungen treffend zusammen, wenn er resümiert, dass ein Mensch, der sich tatsächlich überall selbst begegnen würde, auch kein Mensch im ursprünglichen Sinne mehr wäre, sondern sich selbst schon zum Teil seiner Dingwelt gemacht hätte. Er sei ebenso von sich wie von der Natur entfremdet (Nordmann 2008, S. 45).
Zusammenfassend attestiert Heidegger der modernen Technik eine Verirrung. Von der vormaligen Technik, die durch Entbergen Sein hervorgebracht hat, ist eine Technik übrig geblieben, die den Menschen in ein Ge-stell einspannt und droht, die Überhand über ihn zu übernehmen. Der Mensch läuft Gefahr, sich im stetigen Prozess der Herausforderung durch die Technik von sich selbst zu entfremden. In Wahrheit jedoch, so Heidegger, gehe die Gefahr nicht von der Technik selbst, von „tödlich wirkenden Maschinen und Apparaturen“ aus, sondern vom Ge-stell, das dem Menschen ein ursprüngliches Entbergen verwehrt, durch das sie eine „anfänglichere Wahrheit“ erfahren könnten (Heidegger 2009, S. 32).
Andreas Luckner, der Heidegger nicht als „Dämonisierer der Technikentwicklung“ (Luckner 2012, S. 54) sieht, greift diesen Gedanken auf. Er deutet Heidegger dahingehend, dass das Ge-stell uns dazu herausfordert, die Natur als reines Rohstoffbecken zu sehen, aus dem wiederum herausgefordert werden soll (ebd. S. 54). Allerdings sei das Ge-stell eben nur ein Anspruch. „Es liegt daher immer noch an uns, diesem Anspruch zu entsprechen oder nicht“ (Luckner 2012, S. 55). Der schicksalhaft verhängnisvolle Eindruck, den Technisierungsprozesse bei den Menschen hinterlassen, resultiere demnach nur aus einem „nicht über sich selbst aufgeklärten Blickwinkel“ (Luckner 2012, S. 54). Heidegger versuche nur, auf diesen Missstand und die dadurch drohende Gefahr des Seinsverlustes hinzuweisen (Luckner 2012, S. 55)
4.2.2.2. Heidegger und die Fernbedienung
Heidegger liefert, ganz im Gegensatz zu Anders, keinen direkten Bezugspunkt zwischen seiner Technikkritik und der Fernbedienung. Allerdings leisten hier einige grundsätzliche Gemeinsamkeiten im Denken der beiden Philosophen Hilfestellung. In diesem Abschnitt wird wegen der direkten Bezugnahme auf die zuvor beschriebenen Erkenntnisse eine erneute Quellenangabe nicht stattfinden.
Wenn Heidegger resümiert, Technik (oder zumindest das Ge-stell) wäre ein Mittel zur Entfremdung des Menschen von sich selbst, kommt das der Produktion des Massenmenschen, wie sie Anders beschreibt, schon sehr nahe. Dann wird die Fernbedienung insofern zum Mittel der Entfremdung, als dass sie dem Menschen das Konsumieren der virtuellen Welt soviel einfacher und durch das große Programmangebot schmackhafter macht, als hinauszugehen und sich in der realen Welt selbst zu erfahren. Bleibt der Mensch vor dem Fernseher sitzen, ist die „anfänglichere Wahrheit“ (s.o.) schlichtweg unerreichbar für ihn.
Auch der Anfangsgedanke Heideggers, dass Technik „Entbergen“ bedeute, lässt sich in gewisser Weise auf die Fernbedienung anwenden. Demnach würde sich mit der Benutzung der Fernbedienung die (wenn auch nur virtuelle) Welt entbergen. Nimmt man Heidegger allerdings wörtlich, so bezieht sich der Begriff des Entbergens auf das Herstellen, was nur insofern den Rückschluss zulassen würde, dass durch die Fernbedienung das umfangreiche Programmangebot des Fernsehens, das ohne sie im Verborgenen lag, nun unverborgen ist.
Genauso ließe sich die Fernbedienung in das Wechselspiel von „bestellen“ und „bestellt sein“ einordnen. Zwar geht es bei der Herstellung der Fernbedienung auch um ein „Herausfordern der Natur“, allerdings in verschwindend geringem Maße gegenüber dem des Kohleabbaus oder der Förderung seltener Erden. Dennoch lohnt es sich, diesen Gedanken zu verfolgen. Ist die Fernbedienung erst einmal hergestellt, steht sie als Bestand bereit. Nun kann sie vom Fernseher zu dessen Bedienung bestellt werden. Sie bestellt aber gleichzeitig auch, allein aus ihrer Existenz heraus, ein ausreichendes Programmangebot. In direkter Folge wird jetzt der Mensch zum Bestand, wenn er bereitstehen muss, um dieses Programmangebot zu liefern. Er verliert sich dann in der Befriedigung der „Bedürfnisse“ der Fernbedienung, weil er in unreflektierter Weise den Anspruch des Ge-stells nicht als bloßen Anspruch erkennt (siehe Luckner 2012). Damit wäre, wenn auch über Umwege, der Kreis zur Entfremdung und dem Seinsverlust des Menschen wieder geschlossen.
Diese Versuche, die Fernbedienung zumindest formal in das Gedankengerüst Heideggers zu integrieren, mögen sehr brachial oder behelfsmäßig wirken. Wenn aber Heideggers Technikkritik für die gesamte moderne Technik gelten soll, so müssen diese Versuche gestattet sein. Und wenn sie auch im ersten Moment den Kriterien Heideggers nicht genügen, dann doch, sobald das Fernsehen mit in Betracht gezogen wird.
4.3. Ernst Cassirer: die Fernbedienung als menschliche Kulturleistung
Wenn wir von der Fernbedienung als menschliche Kulturleistung sprechen, erhält der Technikbegriff automatisch eine positive Besetzung. Für die Fernbedienung,
wie in den letzten Kapiteln herausgearbeitet, würde das bedeuten, dass sich die gestiegene Programmvielfalt mit all ihren Folgen positiv auf den Menschen und sein Verhältnis zur Welt auswirkt. Die Fernbedienung würde so den Weg zu umfassender Information frei machen, die der Mensch wiederum dafür benutzt, sich selbst in die Welt einzuordnen und sich seinen eigenen Kulturraum zu bilden.
Diese Aspekte greifen bereits der Argumentation eines der bedeutendsten Verfechter dieser Theorie vor. Ernst Cassirer setzte sich bereits 1930 in Form und Technik mit der Frage nach einer passenden Einordnung der Technik in unserer Lebenswelt auseinander. Auch heute erfahren seine Ansätze noch eine erstaunliche große Anwendbarkeit. Deswegen soll hier detailliert auf seine Arbeit eingegangen werden. Inwiefern die Fernbedienung in die Zusammenhänge seiner Theorien eingeordnet werden kann, soll dann im Nachgang wieder aufgegriffen werden.
Ernst Cassirer (1874-1945) konnte am Ende seiner philosophischen Laufbahn auf ein breit gefächertes Gesamtwerk zurückblicken. Dieses resultiert vor allem aus der Vielfältigkeit der philosophischen Disziplinen, die der in Breslau geborene Cassirer im Laufe der Jahre durchlief. Der Kulturphilosoph Heinz Paetzold hat, ausgehend von Cassirers Vita, seinen Weg ausgehend von der Erkenntnistheorie hin zur Kulturphilosophie, von dort aus weiter zur Anthropologie bis hin zur Sozialphilosophie gezeichnet (Paetzold 2002, S. 11). Zudem liefert Cassirer immer wieder Denkanstöße für heutige Medienphilosophen (Brauns 2008, S. 41).
Damit bringt er, ruft man sich die einleitend erklärten Methoden der Technikphilosophie ins Bewusstsein, die besten Voraussetzungen mit, die Technik mit all ihren Einflussbereichen zu erfassen. Weil ein Großteil seiner Betrachtungen der Technik auf seiner kulturphilosophischen Vorarbeit beruht, soll zunächst - wenn auch in knapper Form - der Begriff der symbolischen Form, wie Cassirer ihn geprägt hat, erläutert werden.
4.3.1. Die Symbolische Form nach Cassirer
Mit dem Konzept der symbolischen Form will Cassirer den Weg zu einem Weltverständnis ebnen, und zwar indem er ein Deutungsschema für die Erlebnisse des Menschen bereitstellt. Heinz Paetzold charakterisiert sie zusammenfassend als „universelle, intersubjektiv gültige Formen oder Grundformen des Verstehens der Welt“ (Paetzold 2002, S. 42) und beschreibt sie weiter als Möglichkeit für den Menschen, sich eine kulturell sinnhafte Lebenswelt zu schaffen (Paetzold 2002, S. 43).
Als solche symbolischen Formen können beispielsweise Mythos, Sprache, Kunst und auch die Technik verstanden werden. Der Mythos erfährt hierbei eine besondere Stellung, da er in der Entwicklung des Menschen die erste Form des Begreifens der Welt war. Alle anderen symbolischen Formen gehen demnach aus dem Mythos hervor (Paetzold 2002, S. 43). Sprache und Technik allerdings nehmen hier eine Sonderposition ein, die in Punkt 4.3.2. genauer erläutert werden wird.
Die einzelnen symbolischen Formen sind in sich zwar als autonom anzusehen - sie ermöglichen für ihren Bereich ein hinreichendes Erfassen von Sinnzusammenhängen -, was aber auf der anderen Seite nicht bedeutet, dass die symbolischen Formen untereinander sich nicht wechselseitig beeinflussen. Diese Wechselbeziehungen zu untersuchen, ist der wesentliche Bestandteil der Kulturphilosophie Cassirers (Paetzold 2002, S. 45)
4.3.2. Cassirer und die Technik
Ernst Cassirer nähert sich in seinem Aufsatz Form und Technik (1930) dem Wesen der Technik, indem er zu ihrem ursprünglichsten Ursprung zurückgeht. Er macht diesen am Übergang des Menschen vom homo divinans zum homo faber fest, also dem Übergang vom Naturvolk hin zum Kulturvolk. Die Naturvölker begreifen ihre Welt weitestgehend über die Magie. Der Mensch der Magiewelt hat das Wechselspiel von Ursache und Wirkung erfahren und versucht, mit Riten und Beschwörungszeremonien die Natur zu beeinflussen (Cassirer 1995, S. 53-57).
„Der magische Mensch, der »homo divinans«, glaubt im gewissen Sinne an die Allmacht des Ich: aber diese Allmacht stellt sich ihm lediglich in der Kraft des Wunsches dar“ (Cassirer 1995, S. 57). Der homo faber dagegen kann den Willen anführen, um sein Ziel zu erreichen. Dabei definiert Cassirer den technischen Willen als einen, der kontrolliert und reflektiert eine Distanz zwischen Willen und Ziel schafft. Erst in dieser Distanzierung sieht Cassirer den Grund, der „eine »objektive« Anschauung, eine Anschauung der Welt als einer Welt von »Gegenständen« ermöglicht“ (Cassirer 1995, S. 59). Hier wird übrigens schon die Technik als symbolische Form angedeutet. Denn dieser Umstand zieht ein völlig neues Begreifen der Welt nach sich. Durch den Gebrauch eines Werkzeugs, und sei es noch so primitiv, schafft der Mensch diese Distanzierung, und hebt sich dadurch vom bloßen Wissen durch das Wissen um die Wirkung ab (Cassirer 1995, S. 61-62). Mit dem Werkzeug, so Cassirer weiter, besitzt der Mensch nie da gewesene Möglichkeiten, seine Welt zu formen und steht nun vor einem „großen Wendepunkt seines Schicksals“ (Cassirer 1995, S. 66)
Damit ist der entscheidende Punkt in Cassirers Ansicht der Technik bereits erreicht. Wir hatten gesehen, dass Sprache und Technik eine Sonderstellung im System der symbolischen Formen einnehmen, da sie beide direkt aus dem Mythos entstanden zu sein scheinen. Cassirer stellt nun eine Analogie zwischen Sprache und Technik heraus, die der Technik den Charakter der bedrohlichen, den Menschen einvernehmenden Macht absprechen soll. Genauso wie die Technik sich von ihrem Ziel entfernt, um aus der Distanz die Gesetzmäßigkeiten der Natur zu begreifen, hat sich auch die Sprache vom direkten dinglichen Beschreiben der Natur entfernt, um sie dann in ihrer Gesamtheit begreifen zu können. So wird sie „zum reinen Symbol“ (Cassirer 1995, S. 74). Cassirer folgert daraus, dass „der Gang der Technik einer allgemeineren Norm, die die Gesamtheit der Kulturentwicklung beherrscht“ (Cassirer 1995, S. 74) unterliegt. Zwar spricht Cassirer dem Prozess der Anpassung an diese Norm ein großes Konfliktpotential - wir erleben es in jeder aktuellen Diskussion über neue Technologien - nicht ab, stellt aber gleichzeitig heraus, dass dieser Widerstreit unvermeidbar ist, wenn die Technik es der Sprache gleichtun und „die in ihr schlummernde Leistung zum wahrhaften Durchbruch“ (Cassirer 1995, S. 74) bringen soll. Hier wird bereits deutlich, dass Cassirer sich weigert, die Technik an sich als gut oder böse anzusehen und ihr vielmehr zuspricht, dem Menschen ein Mittel zur Selbstorientierung und Selbstverwirklichung zu sein. In dem, was der Mensch mithilfe der Technik erschafft, habe er keine bloße Sache vor sich, sondern in ihm schaue er zugleich sich selbst und sein eigenstes persönliches Tun an (Cassirer 1995, S. 76).
Nun ist es nicht mehr weit, bis die Fernbedienung in das Gedankengerüst Cassirers eingeordnet werden kann. Ausgehend vom Ursprung der Technik, sind wir nun bei der modernen Technik angelangt. Hier, wo der Diskurs über Für und Wider der Technik am heftigsten ausgefochten wird, nimmt Cassirer eine fast schon beschwichtigende Rolle ein. Er erkennt an, dass das kulturelle Schaffen des Menschen, und damit explizit auch die Technik, Sachordnungen geschaffen hat, „die drohen, die Überhand über das Ich des Menschen zu nehmen“ (Cassirer 1995, S. 76). Allerdings weist er Vorwürfe, die sich an die Technik als Unheilbringer richten zurück und macht deutlich, dass man, wenn überhaupt, der gesamten geistigen Kultur dieses Unheilzeugnis ausstellen müsste. „Die Technik hat diesen Tatbestand nicht geschaffen, sondern sie stellt ihn nur an einem besonders markanten Beispiel eindringlich vor uns hin; sie ist, sofern man hier von Leiden und Krankheit spricht, nicht der Grund des Leidens, sondern nur eine Erscheinung, ein Symptom desselben“ (Cassirer 1995, S. 77). Die Technik müsse nicht nach Nutzen und Nachteil gemessen werden, sondern am Maße des Geistes, an Freiheit und Unfreiheit (ebd.). Denn mit der Technik verschafft sich der Mensch gestalterische Freiheit. Und diese Freiheit gegen eine Welt ohne Technik in maximaler Unfreiheit aufzuwiegen, scheint in der Tat unsinnig.
Das düstere und bedrohliche Bild, das die Technik zu Zeiten Cassirers wohl schon hatte und heute immer noch hat, versucht Cassirer aufzuhellen, indem er auf einen weiteren Umstand hinweist, für den die Technik nichts kann, aber mit ihm in engem Zusammenhang steht. Cassirer bedient sich bei Walther Rathenau (Rathenau 1917), wenn er die Wirtschaft als Faktor für die zunehmende Verschlechterung des Technikbildes heranzieht (Cassirer 1995, S. 87-88). Das Wecken von Bedürfnissen, von denen der Mensch nicht wusste, dass er sie überhaupt in sich trägt. Das ständige Hin und Her zwischen Befriedigung und Reizansprache. Um dieses am Menschen leisten zu können, braucht die Wirtschaft die Technik. Sei es im Hintergrund, in den Fabriken oder an vorderster Front als verkaufte technische Geräte. Jedoch hat die Technik selbst diesen Vorgang nicht angestoßen, sondern ist vielmehr zu ihm genötigt worden. Cassirer kommt daher zu dem Schluss, dass die die Technik immer nur Dienerin, nicht Führerin des menschlichen Willen sein könne (Cassirer 1995, S. 88). Vor diesem Hintergrund der Abhängigkeit der Technik vom menschlichen Willen sieht er die größte Herausforderung der Kultur in einer „Ethisierung der Technik“ (Cassirer 1995, S. 89), einem reflektierten Umgang mit der Technik.
Zusammenfassend kann man also sagen, dass die Technik dem Menschen dient. Sei es bei der Schaffung einer geistigen Kultur, der Willensbildung unter Anerkennung der Naturgesetze oder aber der Selbsterkenntnis des Menschen. Außerdem greift eine unüberlegte Kritik der Technik schnell an der falschen Stelle, wodurch dem Wesen der Technik oft Unrecht geschieht.
4.3.3. Cassirer und die Fernbedienung
Auch wenn Cassirers Aufsatz zur Technik aus dem Jahr 1930 stammt, so erfährt seine grundsätzliche Auseinandersetzung mit der Technik heute immer noch eine große Gültigkeit. Für die Fernbedienung, die nach heutigem Entwicklungsstand ein eher simples „Werkzeug“ ist, bietet sie jedenfalls genügend Berührungspunkte, die es zu betrachten lohnt. Alle Schlussfolgerungen beziehen sich hier wieder auf die im Abschnitt zuvor gewonnenen Erkenntnisse. Auf erneute Quellenbelege wird daher verzichtet.
Cassirer nennt die Distanzschaffung als entscheidenden Punkt, um seine Umwelt zu begreifen. Damit beschreibt er schon fast den Phänotyp der Fernbedienung. Auch wenn die Fernbedienung nicht ohne den Fernseher auskommt, so ermöglicht sie fast maximale Distanz zum betrachteten Objekt. Vor dem Fernseher und mit der Fernbedienung in der Hand begreift und erfährt der Mensch seine Umwelt. Je öfter er bereit ist, die Programmtaste zu bedienen, umso facettenreicher und damit umfassender zeigt sich ihm die Welt. Mit jedem Umschalten schafft er Distanz zum vorherigen Programm und so weiter. Die mannigfaltigen Eindrücke die ihm die Fernbedienung ermöglicht, nutzt er, um sich zu orientieren. Er errichtet sich - zumindest zu einem Teil - am Fernsehprogramm seine eigene Kultur, durch das Annehmen gezeigter Wertvorstellungen oder einfach nur durch die Teilhabe an Erlebnissen Anderer.
Glaubt man Cassirer, so ist es nicht die Fernbedienung, der der Stempel des Unheilbringers aufgedrückt werden darf. Der Fehler ist vielmehr in der gesamten Kultur zu suchen. Demzufolge ist das, was wir im Fernsehen zu sehen bekommen, nicht an den technischen Mitteln festzumachen, sondern an den allgemeinen kulturellen Werten, die in unserer Gesellschaft bereits Einzug gehalten haben. Grundsätzlich weist Cassirer der Wirtschaft einen Gutteil an Einfluss auf diese Entwicklung zu. Demnach wäre die Fernbedienung nur ein Instrument der Wirtschaft, dazu eingesetzt, den Menschen vor dem Fernseher zu halten, um den Absatz von Werbeeinnahmen zu steigern.
Will man die Fernbedienung mit der Technik als Mittel zur Selbstentfaltung und Förderung der Freiheit des Menschen zusammenbringen, dann gelingt dieser Versuch wohl nur, wenn man sich auf eine eingeschränktere Bedeutungsebene begibt, als diese von Cassirer ursprünglich angelegt wurde. Dann bedeutet die Fernbedienung, die Programmwahl betreffend, maximale Freiheit. Und durch den bereits angesprochenen Fundus an kulturellen Teilhabemöglichkeiten wäre der Grundstein für die Selbstentfaltung des Menschen in der ihn umgebenden Kultur gelegt.
5. Fazit
Nach dieser ausführlichen Darstellung dreier verschiedener technikphilosophischer Betrachtungsweisen gilt es nun, die Ausgangsfrage abschließend zu beantworten. Kann die Fernbedienung als Unheilbringer angesehen werden? Und welche Herausforderungen für einen Umgang mit Technik ergeben sich aus der Beantwortung dieser Frage?
Es sei hier nochmals die Ausgangslage erklärt. Betrachtet wird die Fernbedienung in ihrer Rolle als Förderer der Programmvielfalt. Damit ist das Wechselspiel von Fernbedienung und Fernsehen in allen Schlussfolgerungen bereits inbegriffen. Eine vollkommen isolierte Betrachtung der Fernbedienung wäre gegenstandslos.
Ganz grundsätzlich kann also festgestellt werden, dass der Fernbedienung drei verschiedene Zeugnisse ausgestellt werden. Bei Anders zeichnet sich in der Tat ein Bild des Unheilbringers Fernbedienung. Sie verstärkt den Effekt des Identitätsverlusts des Menschen, der durch das Fernsehen ohnehin schon eingetreten ist. Außerdem fördert sie eine verzerrte Wirklichkeitswahrnehmung, was mithilfe der Erkenntnisse aus Hartmut Winklers Switching, Zapping gezeigt und anhand der Scripted-Reality-Formate verdeutlicht wurde. Damit spielt sie eine entscheidende Rolle in Bezug auf die wirklichkeitsverändernden Eigenschaften, die Anders dem Rundfunk und Fernsehen anlastet.
Während Anders die Alleinschuld bei der Technik findet, kommt Heidegger zu dem Schluss, dass es nicht die Technik an sich ist, die für die Entfremdung des Menschen von sich selbst sorgt. Damit entfernt er sich ein Stück von der Position des Technikpessimisten, auf der er bei Anlage dieser Arbeit verortet wurde. Dennoch bleibt die Entfremdungsgefahr bei Heidegger bestehen. Für die Fernbedienung würde das bedeuten, dass sie als Teil des Ge-stells den Menschen zur ständigen Erweiterung des Programmangebots „nötigt“ und er sich in diesem Überangebot verliert.
Bei Cassirer hellt sich das Bild der unheilvollen Technik schließlich ein Stück weit auf. Hier wird die Fernbedienung zum Orientierungsinstrument, mit der sich der Mensch einerseits seine eigene Kultur schafft, sich aber auch in ihr zurechtzufinden versucht. Mit der Fernbedienung kann die Distanz geschaffen werden, die zum Erkennen von Sinnzusammenhängen notwendig ist. Durch den Zugriff auf das ausdifferenzierte Programmangebot, erfährt der Mensch Freiheit. Cassirer hebt sich damit von Anders und Heidegger ab, dass Technik und damit auch die Fernbedienung keine Entfremdung bedeuten, sondern vielmehr Selbsterkenntnis. Außerdem spricht Cassirer die Fernbedienung vom Vorwurf des Unheilbringers dahingehend frei, dass sie zu einem bestimmenden Teil durch wirtschaftliche Interessen instrumentalisiert wird, den Zuschauer vor dem Fernseher zu halten. Was wir im Fernsehen zu sehen bekommen, hänge trotz allem mehr mit grundsätzlichen kulturellen Werten zusammen, als mit den technischen Möglichkeiten.
So verschieden die Ansätze von Anders, Heidegger und Cassirer auch sein mögen, so können trotzdem an verschiedenen Punkten Gemeinsamkeiten ausgemacht werden. Was alle drei vereint, ist die Kritik an der Verdinglichung der Welt und deren Einfluss auf den Menschen. Anders beschreibt, wie sich der Mensch aus der prometheischen Scham heraus mit der Dingwelt der Technik gleichschaltet. Bei Heidegger ist der Mensch als Teil der Dingwelt der Inbegriff der Entfremdung. Und bei Cassirer sind es die selbst geschaffenen Sachordnungen, „die drohen, die Überhand über das Ich des Menschen zu nehmen“ (Cassirer 1995, S. 76).
Das vermeintliche Diktat der Technik, das Anders mit der Hörigkeit gegenüber dem Fernsehen, Heidegger mit dem Ge-stell und Cassirer mit einer höheren Norm, die allerdings jeglicher Kulturentwicklung innewohnt, beschreiben, liefert jetzt auch eine Antwort auf die noch offene Frage, warum die Fernbedienung existierte, bevor überhaupt eine entsprechende Menge an Programmen vorhanden war. Mit Heideggers Ge-stell lässt sich vielleicht am besten erklären, dass im Wesen der Technik eine herausfordernde Kraft enthalten ist, die einen Anspruch an den Menschen stellt. Damit würde die Fernbedienung, gemeinsam allerdings mit sendetechnischen Weiterentwicklungen, den Anspruch auf Bereitstellung einer Vielzahl an Programmen erheben. Und eben nicht die Programme einen Anspruch auf ihre technische Machbarkeit.
Diesem Anspruch hat die Menschheit, nach Meinung der drei hier behandelten Philosophen, oft allzu unreflektiert Folge geleistet. Deswegen fordern alle einen bewussteren Umgang mit dem Wesen der Technik, um ihre Folgen im Rahmen zu halten. Anders in einer Abwandlung von Kants kategorischem Imperativ: „Habe nur solche Dinge, deren Handlungsmaximen auch Maximen deines eigenen Handelns werden könnten" (Anders 1961, S. 294), Heidegger in der Herausstellung des Anspruch-Charakters des Ge-stells (Heidegger 2009, S. 23), und Cassirer mit der Forderung nach einer „Ethisierung der Technik“ (Cassirer 1995, S. 89).
Es bleibt also festzuhalten, dass die Fernbedienung das Potential eines Unheilbringers durchaus in sich trägt. Der weitestgehend unreflektierte Umgang mit diesem technischen Apparat (und dem Fernsehen) hat die Fernbedienung in die Lage versetzt, seinen Benutzer durch eine Bilderflut verschiedenster Kontexte zu manipulieren. Was dort an Bildern allerdings zu sehen ist - und hier stimme ich mit den Ansichten Cassirers überein -, ist eben nicht der Fernbedienung anzulasten, sondern vielmehr dem Kulturraum, in dem wir uns bewegen.
Abschließend gilt: Die bewusste Anerkennung der Technik und ihrer hier vorgestellten Wesensarten lässt die letzte Entscheidung über Heil oder Unheil noch immer beim Menschen. Bevor also der Fernbedienung die Schuld am Überfluss von realitätsverzerrenden und selbstentfremdenden Inhalten im Fernsehen gegeben wird, muss zuallererst der Frage nachgegangen werden, ob nicht unsere kulturellen Werte und Vorstellungen, das blinde Verfolgen gesellschaftlicher Trends, der Technik erst erlaubt haben, einen negativen Einfluss auf die Entwicklung unserer Gesellschaft zu nehmen.
6. Einordnung innovativer Fernbedienungssysteme
Ungeachtet der Ergebnisse, zu denen diese drei Philosophen vor mehr als 50 Jahren kamen, hält der technische Fortschritt in allen Bereichen des Lebens nicht inne. Auch die klassische Fernbedienung läuft Gefahr, durch verschiedenartige Nachfolger ersetzt zu werden. Im Vorhinein sind hier zwei grundsätzliche Ansätze zu beobachten. Von design-technischen Veränderungen einmal abgesehen, ist für eine weitere Einordnung der Trend hin zur Sprach- und Gestensteuerung von Bedeutung (INFOSAT Verlag 2013).
6.1. Sprachsteuerung
Sprachsteuerungskonzepte funktionieren insgesamt nach dem Prinzip, gesprochene Sprache in Rechtschrift-Text umzuwandeln. Dabei besteht die Schwierigkeit darin, ähnlich klingende Worte genau zu unterscheiden und benutzertypische Betonungsarten richtig einzuordnen. Dabei behelfen sich moderne Spracherkennungssysteme statistischer Methoden. Aus umfangreichen Datenbanken werden mithilfe effizienter Algorithmen die Spracheingaben auf phonetische Ähnlichkeit mit den Datenbankeinträgen verglichen. Die gewonnenen Ergebnisse werden dann anhand eines Lexikons und statistischer Grammatik auf Plausibilität geprüft und dann weiter verarbeitet (Möller 2001, S. 5-7). Neben
Anwendungen zur direkten Wort-In-Schrift-Übertragung (Diktierprogramme), können die gewonnen Rechtschrifteingaben auch als Steuerbefehle für technische Geräte verwendet werden.
Auf dem Markt erhältlich ist beispielsweise die optionale Sprachsteuerung, die die Deutsche Telekom im Zuge ihres Entertain-Fernsehangebots anbietet (Deutsche Telekom 2013). Aber auch Samsung hat die integrierte Sprachsteuerung für neuere Fernseher bereits implementiert (Samsung 2013).
6.2. Gestensteuerung
Innerhalb der Gestensteuerung sind zwei Typen zu unterscheiden. Einerseits kann die Gesteneingabe direkt an einem Interface erfolgen. Dann werden meist Fingergesten verwendet, das Funktionsprinzip entspricht dem eines Touchpad oder auch eines Handys mit Touchscreen. Vordefinierte Gesten, wie das Zeichnen eines Kreises auf dem Eingabefeld, können dann mit Funktionen wie der Lautstärkeregelung verknüpft werden. Die zweite Variante nennt sich Motion Capture und beschreibt die Erfassung von Bewegungen, um sie in der Folge für den Computer auswertbar zu machen. Motion Capture kann optisch erfolgen, also durch die Aufzeichnung von Körperbewegungen mittels Kamera. Oder es kommen nicht optische Verfahren zum Einsatz, bei denen Beschleunigungssensoren die Bewegung eines Handgeräts erfassen und sie an die Recheneinheit übermitteln.
Als Zusatzgerät für die Fingergesten-Eingabe wird beispielsweise die Gesture Remote angeboten, die in ihrem Aussehen einer Computermaus ohne Tasten ähnelt. Hier können dreidimensionale Fingerbewegungen benutzt werden, um durch die Funktionsmenüs des Fernsehers zu navigieren (Gesture Remote 2012). Neue Fernseher beinhalten meist schon eine integrierte optische Gestenerkennung und/oder ein zusätzliches Handgerät für die Gestensteuerung (Computerbild 2012).
6.3. Einordnung
Sowohl die Sprach- als auch die Gestensteuerung verfolgen primär das Ziel, das Tastendrücken überflüssig zu machen und so den Bediencomfort zu steigern. Das eigentliche Funktionsprinzip, nämlich den Programmwechsel durch einen menschlichen Impuls, verändern sie allerdings nicht. Damit ist das Prinzip der Fernbedienung nicht neu erfunden worden, weshalb auch kein weiterer Anstieg der Programmvielfalt durch die neuen Fernbedienungen zu erwarten ist. Damit ändert sich zwangsläufig die Fragestellung, mit der wir versucht haben, die klassische Fernbedienung einzuordnen. Nun stellt eher die Frage, warum sich diese technischen Weiterentwicklungen der Fernbedienung trotz gleichen Funktionsprinzips derart auf dem Vormarsch befinden.
Ein Mehrwert beider Systeme ist sicherlich die Möglichkeit, sich schneller durch umfangreiche Einstellungsmenüs des Fernsehers bewegen zu können. Auf den Fernsehkonsum selbst wirkt sich dieser Vorteil allerdings nicht aus. Betrachtet man die Konzepte der neuen Fernbedienungen genau, so wird man feststellen, dass die ursprünglichen technischen Funktionsweisen zuerst in anderen Bereichen erfolgreich angewandt wurden, bevor sie für die Bedienung von Fernsehern modifiziert wurden. Sei es die Spracherkennung zu Diktierzwecken, die in der Sprach-Bedienung des Iphones mittels Siri mündete. Oder sei es Motion Capture, das seinen Siegeszug bei der Produktion von animierten Filmen begann und ihn mit Spiele-Konsolen wie der Nintendo Wii oder der Xbox Kinect weiterführte.
Am Fortschreiten dieser Entwicklungen lassen sich nun aber eindeutige Trends ablesen. Das Beispiel der Spiele-Konsolen zeigt exemplarisch das Verlangen des Benutzers, direkt am Spielgeschehen teilzuhaben, und zwar ohne ein Gamepad, also ohne einen Mittler, der zwischen ihm und der virtuellen Welt steht. Dieses Trend, „mittendrin statt nur dabei“1 zu sein, egal ob er von Medienschaffenden aufoktruyiert wurde oder nicht, prägt die heutigen Bedürfnisse der Konsumenten. Die Fernsehindustrie springt mit ihren neuen Fernbedienungen auf diesen Trend auf und versucht die Barriere zwischen real und virtuell einzureißen. Ohne sich von der Bedienung einer Fernbedienung ausbremsen zu lassen, bewegt man sich nun per „Handstreich“ oder „Machtwort“ durch die virtuelle Welt.
Jetzt erhalten die Thesen von Anders und Heidegger plötzlich wieder Gewicht. Die neuen Fernbedienungen würden demnach in besonderem Maße die Gleichschaltung des Menschen mit der Dingwelt und damit die Entfremdung vorantreiben. Und doch wird hier, noch deutlicher als bei der klassischen Fernbedienung, klar, dass die Technik zwar die Möglichkeiten bereitstellt, aber die bestimmende Kraft von unserer kulturellen Grundentwicklung ausgeht. Es bleibt somit dabei: Die Fernbedienung ist „nicht der Grund des Leidens, sondern nur eine Erscheinung, ein Symptom desselben“ (Cassirer 1995, S. 77).
7. Kritik
Anhand der Fernbedienung und ihrer potentiellen Nachfolger wurde in dieser Arbeit ein Bild gezeichnet, das die Gesellschaft - trotz technikphilosophischer Warnungen - in einem unreflektierten Umgang mit der Technik zeigt. Würde die Betrachtung hier enden, wäre dieser Gesellschaft allerdings Unrecht angetan.
Denn der Mangel an reflexiver Aufarbeitung, der dem Entwicklungsprozess neuer Fernbedienungsformen angelastet werden kann, ist für viele andere TechnologieEntwicklungen unserer Zeit längst nicht mehr symptomatisch.
Bereits in den späten 1980er Jahren wurde mit Initiativen wie dem SCOT- Programm (Social Construction of Technology) versucht, negative Entwicklungen „bereits an der Wurzel zu verhindern“, indem die Arbeit in Labors und Unternehmen durch Rücksprachen mit Nutzern und Betroffenen begleitet wurde (Grunwald 2010, S. 5). Spätestens der Atomausstieg und der vorläufige Stopp für Fracking in Deutschland haben gezeigt, dass dem „Anspruch des Ge-stells “ (Heidegger) nicht alternativlos Folge geleistet werden muss. Auch die „Ethisierung der Technik“, wie sie Cassirer fordert, hat mit der Einberufung von Gremien wie dem Deutschen Ethikrat, der sich mit ethischen Fragestellungen z.B. auf dem Gebiet der Gentechnik oder Biotechnologie beschäftigt, Einzug in der Gesellschaft gehalten. Und selbst die Befürchtungen Günther Anders´, dass die
Folgen technischer Entwicklungen durch menschliche Vorstellungskraft längst nicht mehr abschätzbar sind (Anders 1961, S. 17), werden mittlerweile ernst genommen. Der Ungewissheit, die beispielsweise die Nanotechnologie mit sich bringt, versucht man heute mit neuartigen Regulierungsmodellen zu begegnen, die explizit Wissensgrenzen anerkennen und einen verantwortungsvolleren Umgang mit den Risikopotenzialen neuer Technologien einfordern (Boeing 2006; Lösch et al. 2009). Nicht zuletzt spiegelt der immer wichtiger werdende Aspekt der Nachhaltigkeit inklusive der gesellschaftlichen Forderung nach energieeffizienten und sicheren Produkten (Nordmann 2008, S.161-163) das Entstehen kultureller Werte wider, die die Technik von düsteren Unheilszenarien zurück ins Licht einer menschlichen Kulturleistung rücken.
In erster Konsequenz hat die Methode, sich ausgehend von der Fernbedienung in einem reflexiven Prozess einem Sinnbild für Technik zu nähern (siehe 4.1.), also kein allgemeingültiges Ergebnis geliefert. Jedoch sollte im Laufe meiner Ausarbeitungen und abschließend mit dieser Kritik klar geworden sein, dass Technik niemals ein Opfer undifferenzierter und leichtfertiger Urteile werden darf.
Literaturverzeichnis
Aeschylus (1819): Der gefesselte Prometheus. Tübingen: Heinrich Laupp. [Übersetztung von Karl Philipp Conz]
Altendorfer, Otto (2001): Das Mediensystem der Bundesrepublik Deutschland.
1. Aufl. Wiesbaden: Westdt. Verl.
Anders, Günther (1961): Die Antiquiertheit des Menschen. Über die Seele im Zeitalter der zweiten industriellen Revolution. München: Beck.
Arbeitsgemeinschaft Dokumentarfilm (2010): AG DOK veröffentlicht internes NDR-Papier. Scripted Reality - eine Chance für den NDR? Online verfügbar unter http://www.agdok.de/de_DE/politics/127389/hpg_detail, zuletzt geprüft am 03.09.2013.
ARD (2013): Chronik der ARD | »ARD Digital« auf Sendung. Online verfügbar unter http://web.ard.de/ard- chronik/index/7864?year=1997&month=8&lra=18&lra=27&lra=35&lra=41&lra= 44&lra=45&lra=46&lra=47&lra=48&lra=49&lra=50&lra=51&lra=52&lra=53& mediatype=1&mediatype=2&mediatype=3&rubric=4&rubric=5&rubric=6&rubri c=7&rubric=8&rubric=9&rubric=10&rubric=11&rubric=12&rubric=13&rubric= 14&rubric=15&rubric=16&rubric=17&rubric=61, zuletzt geprüft am 20.11.2013.
Boeing, Niels (2006): Die Notwendigkeit einer offenen Nanotechnik. In: Alfred Nordmann, Schummer Joachim und Schwarz Astrid (Hg.): Nanotechnologien im Kontext. Berlin: AKA, S. 277-291.
Brandes, Michael (2013): ZDF beendet Nachmittagstalk mit Inka Bause - "Topfgeldjäger" übernehmen "inka!"-Sendeplatz / wunschliste.de. Online verfügbar unter http://www.wunschliste.de/tvnews/m/zdf-beendet- nachmittagstalk-mit-inka-bause, zuletzt geprüft am 16.11.2013.
Brauns, Jörg (2008): Ernst Cassirer als Medienphilosoph. Das Denken der Mannigfaltigkeit. In: Alexander Roesler und Bernd Stiegler (Hg.): Philosophie in der Medientheorie. Von Adorno bis Žižek. München: Wilhelm Fink, S. 41-55.
Bundeszentrale für politische Bildung (2012a): Aufbau von Kabelnetzen und Einführung des Kabelfernsehens | bpb. Online verfügbar unter http://www.bpb.de/gesellschaft/medien/deutsche-fernsehgeschichte-in-ost-und- west/143473/einfuehrung-des-kabelfernsehens, zuletzt geprüft am 09.11.2013.
Bundeszentrale für politische Bildung (2012b): Von der terrestrischen Kommunikation zur Satellitenkommunikation | bpb. Online verfügbar unter http://www.bpb.de/gesellschaft/medien/deutsche-fernsehgeschichte-in-ost-und- west/143474/satellitenkommunikation, zuletzt geprüft am 09.11.2013.
Cassirer, Ernst (1995): Forum und Technik. In: Ernst Cassirer: Symbol, Technik, Sprache. Aufsätze aus den Jahren 1927-1933. 2. Aufl. Hg. v. Ernst Wolfgang Orth. Hamburg: Meiner (Philosophische Bibliothek Hamburg, 372), S. 39-90.
Computerbild (2012): Fernseher mit Sprach- und Gestensteuerung von Samsung und LG - AUDIO VIDEO FOTO BILD. Online verfügbar unter http://www.computerbild.de/artikel/avf-Aktuell-TV-Gestensteuerung- Sprachsteuerung-Samsung-LG-7455775.html, zuletzt aktualisiert am 22.11.2013, zuletzt geprüft am 22.11.2013.
Deutsche Telekom (2013): Entertain Remote Control App. Online verfügbar unter http://www.laboratories.telekom.com/public/Deutsch/Innovation/apps/Pages/Ente rtain-Remote-Control-App.aspx, zuletzt aktualisiert am 22.11.2013, zuletzt geprüft am 22.11.2013.
die medienanstalten (Hg.) (2013): Programmbericht 2012. Fernsehen in Deutschland. Programmforschung und Programmdiskurs. Berlin: Vistas.
Engell, Lorenz (2003): Tasten, Wählen, Denken. Genese und Funktion einer philosophischen Apparatur. In: Roesler Sandbothe Münker (Hg.):
Medienphilosophie. Beiträge zur Klärung eines Begriffs. Frankfurt/M.: Fischer, S. 53-77.
Engell, Lorenz (2012): Fernsehtheorie zur Einführung. Hamburg: Junius (Schriften des Internationalen Kollegs für Kulturtechnikforschung und Medienphilosophie, 10). Online verfügbar unter http://www.gbv.de/dms/faz- rez/FD1201208043579004.pdf.
Fischer, Peter (2012): Herstellen und Herausfordern. Zur Leitdifferenz der Technikphilosophie Martin Heideggers. In: Peter Fischer, Andreas Luckner und Ulrike Ramming (Hg.): Die Reflexion des Möglichen. Zur Dialektik von Handeln, Erkennen und Werten. Berlin, Münster: Lit (Technikphilosophie, 23), S. 213-224.
Gesture Remote (2012): Gesture Remote. Online verfügbar unter
http://www.gesture-remote.com/, zuletzt aktualisiert am 11.11.2012, zuletzt geprüft am 22.11.2013.
Grisko, Michael (Hg.) (2009): Texte zur Theorie und Geschichte des Fernsehens. Stuttgart: Reclam (Reclams Universal-Bibliothek, 18674).
Grunwald, Armin (2010): Technikgestaltung für eine nachhaltige Entwicklung.
20 Jahre sozial- und umweltverträgliche Technikgestaltung. In: Soziale Technik 20 (4), S. 4-7.
Heidegger, Martin (2009): Vorträge und Aufsätze. 11. Aufl. Stuttgart: Klett- Cotta.
INFOSAT Verlag (2013): 2012 wird Jahr der innovativen Bedienkonzepte - BITKOM - INFOSAT - Nachrichten - Info-Digital. Online verfügbar unter http://www.infosat.de/Meldungen/?msgID=66132, zuletzt aktualisiert am 20.11.2013, zuletzt geprüft am 20.11.2013.
Kapp, Ernst (1978): Grundlinien einer Philosophie der Technik. Photomechan. Neudr. d. 1. Aufl., Braunschweig 1877 / mit e. Einl. von Hans-Martin Sass. Düsseldorf: Stern-Verlag Janssen.
Lösch, Andreas; Gammel, Stefan; Nordmann, Alfred (2009): Observieren - Sondieren - Regulieren. Zur gesellschaftlichen Einbettung nanotechnologischer Entwicklungsprozesse (Bestandsaufnahmen und Modellentwurf). In: Stefan Gammel (Hg.): Jenseits von Regulierung: zum politischen Umgang mit der Nanotechnologie. Heidelberg: AKA, S. 16-93.
Luckner, Andreas (2012): Gestellte Möglichkeiten. Heidegger über die technische Seinsweise. In: Peter Fischer, Andreas Luckner und Ulrike Ramming (Hg.): Die Reflexion des Möglichen. Zur Dialektik von Handeln, Erkennen und Werten. Berlin, Münster: Lit (Technikphilosophie, 23), S. 51-64.
Luhmann, Niklas (1998): Die Gesellschaft der Gesellschaft. Frankfurt am Main: Suhrkamp (Suhrkamp-Taschenbuch Wissenschaft, 1360).
Messner, Holger (2013): Pay-tv in deutschland. [S.l.]: Springer Vs. Möller, Sebastian (2001): Sprachtechnologie - Stand der Forschung und Einsatzmöglichkeiten in der Medizin. Online verfügbar unter
http://www.shameacademy.de/chapters/mmi/moeller2001.pdf, zuletzt aktualisiert am 03.12.2007, zuletzt geprüft am 22.11.2013.
Nordmann, Alfred (2008): Technikphilosophie zur Einführung. Hamburg: Junius (Zur Einführung, 357).
Paetzold, Heinz (2002): Ernst Cassirer zur Einführung. 2. Aufl. Hamburg: Junius (Zur Einführung, 271).
ProSiebenSat.1 Media AG (2013): Goldene Zeiten im TV: SAT.1 Gold startet am Donnerstag, 17. Januar 2013 um 20.13 Uhr-30694 - ProSiebenSat1.de. Online verfügbar unter http://www.prosiebensat1.com/de/presse/pressemeldungen/presse- lounge/sat1gold/2013/1/goldene-zeiten-im-tv-sat1-gold-startet-am-donnerstag,- 17-januar-2013-um-2013-uhr-30694, zuletzt geprüft am 10.11.2013.
Rathenau, Walther (1917): Von kommenden Dingen. Pp. 344. Berlin. RStV (01.06.2009): Staatsvertrag für Rundfunk und Telemedien. Rundfunkstaatsvertrag - RStV.
Samsung (2013): Smart TV Sprach- und Gestensteuerung - Gesichtserkennung und Touch Fernbedienung | Samsung Television Article. Online verfügbar unter http://www.samsung.com/de/article/smart-tv-facial-and-gesture-recognition, zuletzt aktualisiert am 17.07.2013, zuletzt geprüft am 22.11.2013.
Schröder, Jens (2012): Meedia: Gerichtsshows: das sterbende Genre. Online verfügbar unter http://meedia.de/fernsehen/gerichtsshows-das-sterbende- genre/2012/04/13.html, zuletzt geprüft am 20.11.2013.
Strohmeier, Gerd (2006): Warum wir Rundfunkgebühren zahlen | bpb. Online verfügbar unter http://www.bpb.de/apuz/29533/warum-wir-rundfunkgebuehren- zahlen, zuletzt geprüft am 09.11.2013.
Trawny, Peter (2003): Martin Heidegger. Frankfurt am Main, New York: Campus (Campus Einführungen).
Weiß, Hans-Jürgen; Ahrens, Annabelle (2012): Scripted Reality. Fiktionale und andere Formen der neuen Realitätsunterhaltung. In: Arbeitsgemeinschaft der Landesmedienanstalten in der Bundesrepublik Deutschland (Hg.): Programmbericht 2011. Fernsehen in Deutschland. Programmforschung und Programmdiskurs. Berlin: Vistas, S. 59-93.
Weiß, Hans-Jürgen; Schwotzer, Bertil (2012): Die Programmentwicklung deutscher Fernsehvollprogramme. Neue Daten der ALM-Studie. In: Arbeitsgemeinschaft der Landesmedienanstalten in der Bundesrepublik Deutschland (Hg.): Programmbericht 2011. Fernsehen in Deutschland. Programmforschung und Programmdiskurs. Berlin: Vistas, S. 23-58.
Winkler, Hartmut (1991): Switching, Zapping. Ein Text zum Thema und ein parallellaufendes Unterhaltungsprogramm. 1. Aufl. Darmstadt: J. Häusser.
Woelke, Jens (2013): Fernsehen nach der Einführung der dualen Rundfunkordnung. Programmsparten- und Formatentwicklungen privater Fernsehvollprogramme in Österreich und Deutschland im Vergleich. In: die medienanstalten - ALM GbR (Hg.): Programmbericht 2012. Fernsehen in Deutschland. Programmforschung und Programmdiskurs. Berlin: Vistas, S. 163- 180.
[...]
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Inhalt des Inhaltsverzeichnisses?
Das Inhaltsverzeichnis listet die Kapitel der Arbeit auf, darunter eine Einleitung, die Fernbedienung als philosophische Apparatur nach Lorenz Engell, konzeptionelle Folgen (für die Entwicklung der Fernsehlandschaft und den Fernsehkonsum), eine technikphilosophische Betrachtung (mit den Perspektiven von Günther Anders, Martin Heidegger und Ernst Cassirer), ein Fazit, eine Einordnung innovativer Fernbedienungssysteme (Sprach- und Gestensteuerung), Kritik sowie das Literaturverzeichnis.
Was ist das Hauptthema der Einleitung?
Die Einleitung befasst sich mit der anhaltenden Debatte über das Fernsehen, insbesondere im Zusammenhang mit neuen Fernsehformaten. Sie diskutiert Vorwürfe wie "Volksverdummung" und "Qualitätsverlust" und betont die Notwendigkeit, das Fernsehen und sein Zubehör, wie die Fernbedienung, aus einer technikphilosophischen Perspektive zu betrachten.
Was ist Lorenz Engells Theorie zur Fernbedienung?
Lorenz Engell betrachtet die Fernbedienung als eine "philosophische Apparatur" und eine "Selektionsmaschine". Er argumentiert, dass die Fernbedienung die explosionsartige Vermehrung des Programmangebots ermöglicht hat, da sie die Selektion von Inhalten durch den Zuschauer erleichtert.
Welche konzeptionellen Folgen hat die Fernbedienung laut dem Text?
Die Fernbedienung führt zu einer verschärften Konkurrenzsituation zwischen den Fernsehsendern, was zu einer konstanten Reizansprache beim Zuschauer und einer Ausdifferenzierung des Programmangebots durch Spartensender führt. Dies beeinflusst auch die Formate der öffentlich-rechtlichen Sender.
Welche technikphilosophischen Perspektiven werden in der Arbeit untersucht?
Die Arbeit untersucht die Perspektiven von Günther Anders, Martin Heidegger und Ernst Cassirer auf die Technik. Anders sieht die Technik als Ursache für Entfremdung und "prometheische Scham". Heidegger betrachtet die Technik als "Ge-stell", das den Menschen einspannt. Cassirer hingegen sieht die Technik als menschliche Kulturleistung und Mittel zur Selbstorientierung.
Wie wird die Fernbedienung aus der Sicht von Günther Anders bewertet?
Günther Anders sieht die Fernbedienung als einen Unheilbringer, der den Identitätsverlust des Menschen verstärkt und eine verzerrte Wirklichkeitswahrnehmung fördert. Sie trägt zu den wirklichkeitsverändernden Eigenschaften des Fernsehens bei.
Wie wird die Fernbedienung aus der Sicht von Martin Heidegger bewertet?
Martin Heidegger sieht die Fernbedienung als Teil des "Ge-stells", das den Menschen zur ständigen Erweiterung des Programmangebots "nötigt" und ihn in diesem Überangebot verliert. Sie ist ein Mittel zur Entfremdung des Menschen von sich selbst.
Wie wird die Fernbedienung aus der Sicht von Ernst Cassirer bewertet?
Ernst Cassirer sieht die Fernbedienung als Orientierungsinstrument, mit dem sich der Mensch seine eigene Kultur schafft und sich in ihr zurechtzufinden versucht. Sie ermöglicht Freiheit und Selbsterkenntnis. Er weist den Vorwurf des Unheilbringers zurück und betont den Einfluss wirtschaftlicher Interessen.
Welche innovativen Fernbedienungssysteme werden in der Arbeit erwähnt?
Die Arbeit erwähnt innovative Fernbedienungssysteme wie Sprachsteuerung und Gestensteuerung, die darauf abzielen, den Bedienkomfort zu steigern und das Tastendrücken überflüssig zu machen.
Wie werden Sprach- und Gestensteuerungssysteme eingeordnet?
Sprach- und Gestensteuerung werden als Weiterentwicklungen betrachtet, die den Trend zur direkten Teilhabe an der virtuellen Welt widerspiegeln. Sie verstärken möglicherweise die Gleichschaltung des Menschen mit der Dingwelt und die Entfremdung, aber die bestimmende Kraft geht von der kulturellen Grundentwicklung aus.
Welche Kritik wird am Ende der Arbeit geübt?
Die Arbeit kritisiert, dass die unreflektierte Betrachtung der Fernbedienung als Unheilbringer zu kurz greift. Viele Technologieentwicklungen werden heute reflexiver aufgearbeitet. Es wird betont, dass Technik nicht unreflektiert verurteilt werden darf und die bewusste Anerkennung ihrer Wesensarten die letzte Entscheidung über Heil oder Unheil beim Menschen lässt.
Details
- Titel
- Die Fernbedienung als Unheilbringer? Versuch einer technikphilosophischen Einordnung der Fernseh-Fernbedienung nach Lorenz Engell
- Hochschule
- Georg-Simon-Ohm-Hochschule Nürnberg
- Note
- 1,0
- Autor
- Benedikt Stahl (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2013
- Seiten
- 48
- Katalognummer
- V314174
- ISBN (eBook)
- 9783668129160
- ISBN (Buch)
- 9783668129177
- Dateigröße
- 572 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- fernbedienung unheilbringer versuch einordnung fernseh-fernbedienung lorenz engell
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 0,99
- Preis (Book)
- US$ 28,99
- Arbeit zitieren
- Benedikt Stahl (Autor:in), 2013, Die Fernbedienung als Unheilbringer? Versuch einer technikphilosophischen Einordnung der Fernseh-Fernbedienung nach Lorenz Engell, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/314174
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-