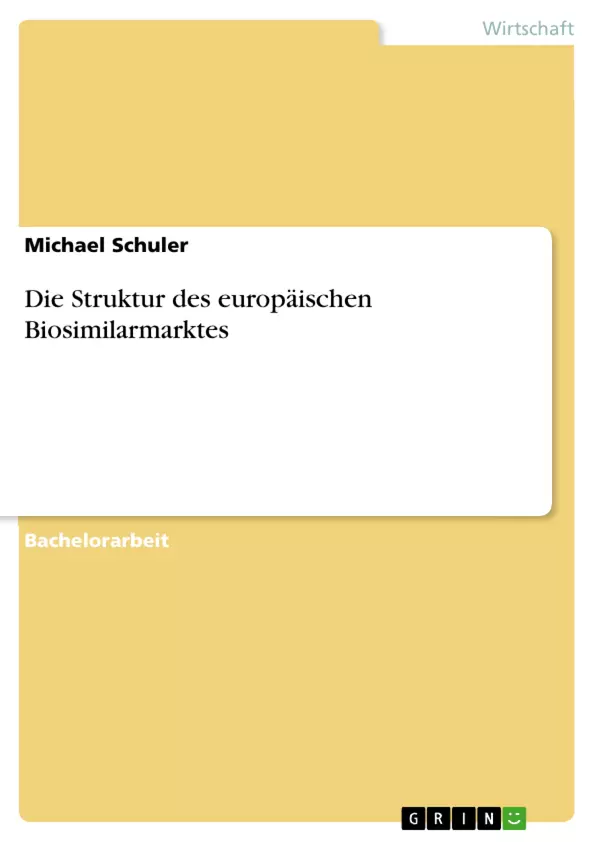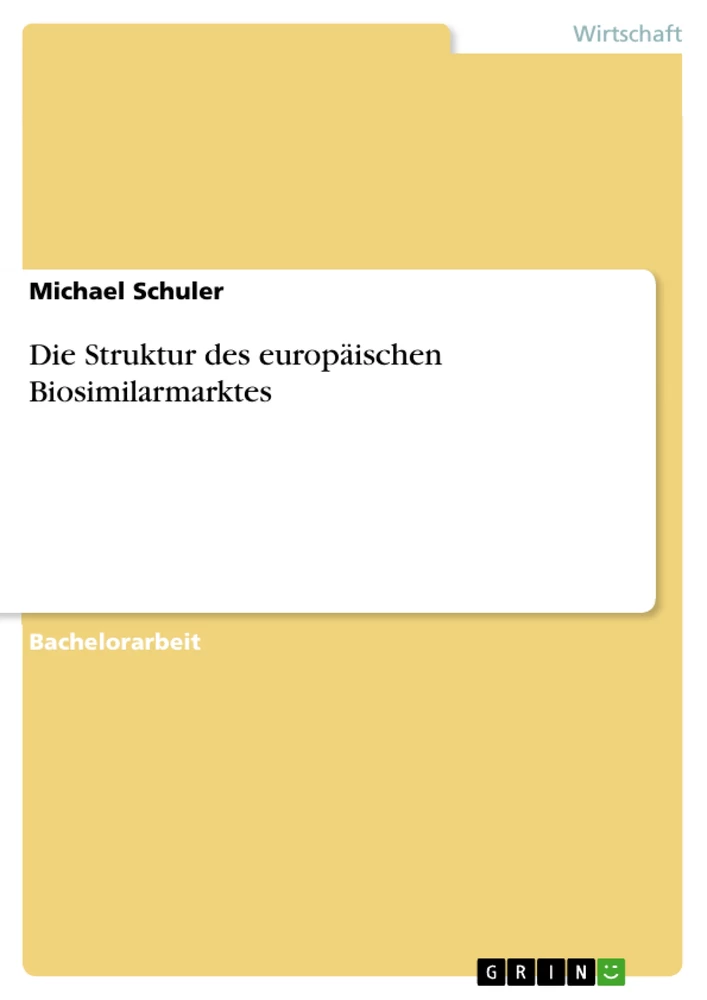
Die Struktur des europäischen Biosimilarmarktes
Bachelorarbeit, 2015
44 Seiten, Note: 1,7
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
1. Einleitung
2. Biopharmazeutische Arzneimittel
2.1 Der Weg zum Biosimilar
2.2 Die Zulassung von Biosimilars
2.3 Gesundheitliche Risiken von Biosimilars
3. Der europäische Biosimilarmarkt
3.1 Marktstrukturen, Eigenschaften und Chancen des Biosimilarmarktes
3.2 Theoretische Grundlagen von Kooperationen und strategischen Allianzen
3.3 Akteure auf dem europäischen Biosimilarmarkt
3.3.1 Kooperationen und Umgang mit Unsicherheit
3.3.2 Geschäftsmodelle
4. Fazit und Ausblick
Literaturverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Wirkstoffe im Größenvergleich
Abbildung 2: Pipeline der Biosimilars für den europäischen Markt 2014
Abbildung 3: Projektpipeline der amp biosimilars AG 2015
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1: Umsatzstärkste Pharmaunternehmen weltweit (in Mio. USD) Stand 2013
Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
1. Einleitung
Biopharmazeutische Medikamente haben in den letzten Jahren einen enormen Boom erlebt. Die Umsätze des noch recht jungen Marktes – er existiert seit den 80er Jahren – sind 2013 allein in Deutschland um 8,5 % und damit auf mehr als 6,5 Mrd. Euro angestiegen. Innerhalb des Arzneimittel-Gesamtmarktes sind die gentechnisch hergestellten Biopharmazeutika damit zur bedeutendsten Branche geworden (vgl. Verband forschender Arzneimittelhersteller 2014, S. 1).
Es war zu erwarten, dass ein so erfolgreicher Markt ein gesteigertes Interesse für frühestmögliche Imitationen hervorruft. Nachdem seit 2001 immer mehr Patente von umsatzstarken Biopharmazeutika abgelaufen waren, stieg die Zahl der Nachahmerprodukte ab 2006 kontinuierlich an (vgl. Pro Generika 2014a, S. 6). Von der Entwicklung und vom Vertrieb dieser Nachahmerprodukte versprechen sich die Imitatoren, sich durch das günstigere Anbieten der Nachahmerprodukte Marktanteile und damit Gewinne anzueignen. Gesundheitssysteme erhoffen sich von den Nachahmerprodukten finanzielle Entlastungen.
Um dies genauer zu erklären, wird in der folgenden Arbeit „die Struktur des europäischen Biosimilarmarktes“ betrachtet und analysiert. Biosimilars sind die „Generika“ – also die Nachahmerprodukte – der Biopharmabranche. Da sie im Gegensatz zu den chemisch hergestellten Generika der traditionellen „Pillen“ jedoch keine exakten Kopien ihrer Vorgänger sind, werden sie als „Biosimilars“ bezeichnet – sie sind ihren Referenzprodukten lediglich ähnlich. Bei den chemisch hergestellten Generika ist eine exakte Kopie möglich. Biopharmazeutika können aufgrund ihrer hochkomplexen Struktur jedoch nicht genau nachgebildet werden; es wird aber eine signifikante Vergleichbarkeit erreicht (vgl. Pro Generika 2014a, S. 24). Dies ist auch der Grund dafür, dass mit Biosimilars verhältnismäßig nicht ganz so viel eingespart werden kann wie mit den Generika (vgl. Smolka 2015, S. 26). Die Wirkung dagegen muss laut den Gesundheitsbehörden – obwohl nur eine hohe strukturelle Ähnlichkeit erreicht wird – identisch zu der des Originalprodukts sein (vgl. Pro Generika 2014a, S. 27).
Aufgrund des enormen Wachstumspotenzials und der Einsparmöglichkeiten, die der noch sehr junge europäische Biosimilarmarkt bietet, ist es wichtig, seine Strukturen und Eigenschaften genauer zu untersuchen und herauszuarbeiten. Besonders spannend wird die Untersuchung des jungen Biosimilarmarktes dadurch, dass darüber nicht bereits unzählige Bücher und Zeitschriftenartikel existieren. Der Markt ist noch kaum erforscht, aber gerade wegen seines Wachstumspotenzials ist dies äußerst wichtig. Das Ziel ist es herauszufinden, welche Chancen der Markt für die verschiedenen Beteiligten bietet und ob sich ein Einstieg lohnt. Ersten Schätzungen zufolge soll der Biosimilarmarkt von aktuell mehr als 1 Mrd. USD bis zum Jahr 2020 ein Volumen von bis zu 20 oder gar 30 Mrd. USD erreichen (vgl. Smolka 2015, S. 26).
Des Weiteren soll der Frage nachgegangen werden, wie die Marktakteure mit der natürlichen Unsicherheit eines jungen Marktes umgehen. Hierbei wird untersucht, ob sie Kooperationen eingehen oder ob sie sich zum Teil auch komplett aus dem Markt heraushalten. Die Bedeutung der Biosimilars für die europäischen Gesundheitssysteme und Patienten begründet sich in den möglichen Einsparungen und der daraus resultierenden erhöhten Versorgungsrate. Wenn also einem Patienten die Behandlung mit einem Biopharmazeutikum aufgrund des hohen Preises bis jetzt nicht erstattet wurde, so steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die Behandlung mit einem günstigeren Biosimilar erstattet wird.
Um auf die wesentlichen Fragestellungen zu sprechen zu kommen, beginnt die folgende Literaturanalyse nach der Einleitung zunächst mit dem Kapitel „Biopharmazeutische Arzneimittel“. Hier wird erklärt, was genau unter biopharmazeutischen Medikamenten und deren Nachfolgeprodukten verstanden wird. Außerdem sollen Biopharmazeutika und Biosimilars von den „traditionellen Pillen“ und den Generika abgegrenzt werden. Für den weiteren Verlauf der Arbeit ist es wichtig, dies zu verstehen. Der Weg zum Biosimilar und der dazugehörige aufwendige Zulassungsprozess werden danach erklärt. Auch der Zulassungsprozess ist ein sehr wichtiger Punkt, denn im Vergleich zu den klassischen Generika ist er finanziell um einiges aufwendiger. Somit ist er ein Grund, warum einige Unternehmen dem Einstieg in den Markt skeptisch gegenüberstehen.
Anschließend wird im Kapitel „Der europäische Biosimilarmarkt“ detailliert auf dessen Strukturen, Eigenschaften und Chancen eingegangen. Zunächst wird die Entwicklung des biopharmazeutischen Marktes untersucht, die aktuellen Probleme vieler Pharmakonzerne werden erklärt und danach die Entwicklung des Biosimilarmarktes beschrieben. Weiterhin wird untersucht, wie groß das Einsparpotenzial, das mit den Biosimilars einhergeht, tatsächlich ist.
Aufbauend auf den theoretischen Grundlagen von Kooperationen und strategischen Allianzen werden im Anschluss einige Akteure des europäischen Biosimilarmarktes vorgestellt. Es wird untersucht, wie sie mit den Gegebenheiten des Marktes umgehen und ob sie Kooperationen eingehen oder das Risiko alleine auf sich nehmen. Danach werden die Geschäftsmodelle des Marktes noch allgemein vorgestellt.
In der Schlussbetrachtung werden die wichtigsten Erkenntnisse dieser Arbeit noch einmal zusammengefasst und offengebliebene Fragen abschließend geklärt.
2. Biopharmazeutische Arzneimittel
Da sich diese Arbeit um den Markt von biopharmazeutischen Nachahmer-Präparaten dreht, wird zunächst erläutert, was genau unter einem Biopharmazeutikum verstanden wird und wie es wirkt.
Zunächst einmal sind biopharmazeutische Arzneimittel von den herkömmlichen, sogenannten kleinmolekularen, chemischen Arzneimitteln, zu unterscheiden. Die Bezeichnung „kleinmolekular“ kommt daher, dass sie in ihrer molekularen Größe im Vergleich zu den Biopharmazeutika um ein vielfaches kleiner sind (vgl. Pro Generika 2014a, S. 9).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 1: Wirkstoffe im Größenvergleich
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Verband forschender Arzneimittelhersteller 2010, S. 8
Wie die Abbildung verdeutlicht, ist der chemische Wirkstoff – hier ist der Wirkstoff der „Aspirin Tablette“ dargestellt – deutlich kleiner als biopharmazeutische Wirkstoffe. Außerdem sind chemische Wirkstoffe mit einem Molekulargewicht von höchstens 1 Kilodalton (kDa) selbst im Vergleich zum in der Mitte abgebildeten „kleinen“ Biopharmazeutikum, das 5 kDa wiegt, um ein Vielfaches leichter. Die größten Biopharmazeutika, die sogenannten „Monoklonalen Antikörper“, wiegen teilweise mehr als 300 kDa (vgl. Albring 2008).
Vereinfacht kann festgehalten werden, dass die kleinmolekularen Medikamente die beim Menschen auftretenden Symptome lindern, während Biopharmazeutika die Ursache bekämpfen. Wenn man dies auf ein fiktives anschauliches Beispiel beziehen würde, dann würden bei dauerhaften Kopfschmerzen mit kleinmolekularen Medikamenten die Kopfschmerzen gelindert – das Ziel von Biopharmazeutika dagegen wäre, dafür zu sorgen, dass die Kopfschmerzen erst gar nicht mehr auftreten. Außerdem besteht ein Unterschied in der Herstellung: Während herkömmliche Arzneimittel meist durch chemische Prozesse hergestellt werden, so werden Biopharmazeutika in hochkomplexen Verfahren produziert. Die meisten werden in lebenden Systemen, wie zum Beispiel Mikroorganismen oder auch tierischen Zellen, hergestellt. Sie unterliegen deshalb einer natürlichen Variabilität und sind sehr aufwendig und kostenintensiv in der Herstellung (vgl. EU Konsensinformationsblatt 2013, S. 8). Nachdem die Biopharmazeutika in lebenden Organismen gezüchtet wurden, müssen sie aus diesen herausisoliert werden und sind erst dann verwendbar. Während die kleinmolekularen Medikamente eine chemische und meist vom Menschen erfundene „Lösung“ für ein medizinisches Problem sind, entstammen die Ideen für ein Biopharmazeutikum meist der Natur. Ihre biologischen Vorbilder kommen sogar meist im Menschen selbst vor (vgl. Pro Generika 2014a, S. 10).
Diese Unterschiede in der Herstellung sind auch der Grund dafür, dass zwei Biopharmazeutika, obwohl sie die gleiche Wirkung haben, niemals vollkommen identisch sind. Aufgrund der hochkomplexen Herstellung in lebenden Systemen lassen sich leichte Unterschiede in ihren jeweiligen Eigenschaften nicht vermeiden. Der medizinische Anspruch an die Biopharmazeutika ist jedoch auch nicht deren völlige Gleichheit, sondern deren nahezu gleiche Wirkung bei einer jeweils sehr hohen Qualität (vgl. Pro Generika 2014a, S. 13). Die Gleichheit der Eigenschaften muss innerhalb eines bestimmten, vorgegebenen Korridors liegen.
Ein weiterer wichtiger Unterschied zwischen den beiden Medikamententypen „kleinmolekular“ und „biopharmazeutisch“ liegt in der Einnahme. Kleinmolekulare Medikamente werden meist als Tablette eingenommen; biopharmazeutische Medikamente, die aus Proteinen bestehen, müssen zum Großteil über eine Infusion dem menschlichen Körper zugeführt werden. Da sie aus Proteinen bestehen, würden sie nach dem Schlucken vom Verdauungssystem angegriffen und zerstört werden (vgl. EU Konsensinformationsblatt 2013, S. 8).
2.1 Der Weg zum Biosimilar
Wenn ein Pharmakonzern in einem aufwendigen Prozess ein neues Biopharmazeutikum entwickelt hat und dieses von der Europäischen Arzneimittelagentur zugelassen wurde, so meldet der Konzern im Normalfall ein Patent auf das Medikament an. Weil die Forschungsdauer in der Pharmabranche sehr lange ist, sind Patente eine erfolgversprechende Möglichkeit, sich den Umsatz des Medikamentes über einen bestimmten Zeitraum anzueignen (vgl. Pro Generika 2014a, S. 24). Ein Patent ist ein Recht, dass dem Innovator gewährt, bis zum Patentablauf als einziger einen wirtschaftlichen Nutzen aus diesem zu ziehen. Es sei denn, der Innovator vergibt eine Lizenz, dann darf auch der Lizenznehmer – nach Entrichtung einer Lizenzgebühr – die patentierte Innovation wirtschaftlich nutzen. Ist das Patent für ein Medikament einmal abgelaufen, so kann es von anderen Konzernen legal „imitiert“ werden.
Bei den klassischen, kleinmolekularen Medikamenten werden diese Nachahmungen nach Ablauf des Patentschutzes als Generika bezeichnet. Bei den Biopharmazeutika heißen die Nachahmerprodukte „Biosimilars“.
„A similar biological medicinal product, also known as ‘Biosimilar’, is a product which is similar to a biological medicine that has already been authorised, the so-called ‘reference medicinal product’“ (EMA 2015, S. 5).
Vereinfacht gesagt sind Biosimilars die Generika der biotechnologischen Branche. Als moderne Medizin sind Biopharmazeutika jedoch viel schwerer nachzuahmen als eine traditionelle Tablette (vgl. Smolka 2015, S. 26). Der Ausdruck „Biosimilars“ wird verwendet, weil es sich bei den Nachahmungen aufgrund der natürlichen Variabilität (siehe 2.1) niemals um exakte Kopien handelt, sondern um ähnliche Versionen. Die Biosimilars können geringfügig von ihrem Referenzprodukt abweichen (vgl. Pro Generika 2014a, S. 19). Es ist die Rede von Biosimilarität.
Damit ein Nachahmerprodukt als Biosimilar gilt, muss es seiner Referenzarznei jedoch – was Anwendung und Wirksamkeit angeht und trotz geringfügiger Unterschiede in den Eigenschaften – vollkommen vergleichbar sein (vgl. Pro Generika 2014a, S. 19). Diese minimalen Unterschiede in den Eigenschaften lassen sich jedoch auch zwischen verschiedenen Chargen des Originalmedikamentes nicht vermeiden. Die Struktur von Biopharmazeutika ist einfach zu komplex, um exakt kopiert werden zu können (vgl. Pro Generika 2014a, S. 22).
Ein weiterer Punkt, der Biosimilars von den klassischen Generika der kleinmolekularen Medikamente unterscheidet ist, dass die Entwicklungsdauer beziehungsweise die „Imitationsdauer“ viel länger ist. Bei Biosimilars muss zunächst die viel komplexere Molekülstruktur nachgebildet werden und anschließend noch über einen längeren Zeitraum die Vergleichbarkeit mit der Referenzarznei in Bezug auf Anwendung, Wirksamkeit und vor allem auch Sicherheit gezeigt werden. Um dies zu gewährleisten, muss ein Biosimilar für seine Zulassung ein umfangreiches klinisches Programm durchlaufen (vgl. Pro Generika 2014a, S. 25). Aufgrund der hohen Anforderungen an die Qualität, waren diese Schwierigkeiten bei der Imitation der Originalpräparate bis dato von den klassischen Generika nicht bekannt. Bei Biosimilars sind aufgrund ihrer Komplexität auch meist die Herstellungsprozesse zu denen der Referenzarznei unterschiedlich. Biosimilarität wird nicht nur durch ein bestimmtes Verfahren erreicht, sondern die Prozessschritte können durchaus von Hersteller zu Hersteller verschieden sein (vgl. Pro Generika 2014a, S. 24). Grund für die Unterschiede in den Herstellungsverfahren ist unter anderem, dass die Hersteller der Referenzarznei ihre Verfahren meist geheim halten. Ist erst einmal eine gewisse Erfahrung vorhanden, kann der aufwendige und teure Herstellungsprozess um einiges kostengünstiger gestaltet werden.
Als Folge der Komplexität der Biopharmazeutika entstehen zwischen den klassischen Generika und den Biosimilars große Preisspannen. Während sich bei den Generika im Vergleich zum Originalprodukt bis zu 80 % einsparen lassen, sind es bei den Biosimilars aktuell lediglich zwischen 8 % und maximal 32 %. Die durchschnittliche Entwicklungszeit der klassischen Generika liegt bei ungefähr zwei Jahren mit Entwicklungskosten von fünf Mio. Euro. Biosimilars liegen dagegen mit acht Jahren Entwicklungszeit im Durchschnitt und Kosten von durchschnittlich 145 Mio. Euro deutlich über denen der Generika (vgl. Zylka-Menhorn/Korzilius 2014, S. 454).
2.2 Die Zulassung von Biosimilars
Gerade aufgrund der natürlich gegebenen Variabilität ihrer Eigenschaften gestaltet sich die Zulassung von Biopharmazeutika als sehr kompliziert und anspruchsvoll.
Zunächst muss – wie allgemein bei Arzneimitteln üblich – eine Zulassung für das Biosimilar beantragt werden. Nachdem die „European Medicines Agency“ (EMA) die Qualität, Wirksamkeit und Sicherheit überprüft hat, erteilt am Ende die Europäische Kommission die Zulassung. Bei Biosimilars müssen die klinischen Studien nicht im kompletten Umfang wie bei einem neuen biopharmazeutischen Medikament durchgeführt werden, da die Wirkstoffe an sich bereits bekannt sind. Wurde die Zulassung einmal erteilt, so gilt diese für alle Mitgliedsstaaten der Europäischen Union (EU) (vgl. Pro Generika 2014a, S. 21).
Da es sich bei Biosimilars nicht um klassische Generika handelt, konnte der Zulassungsprozess nicht einfach übertragen werden, sondern musste an deren Komplexität angepasst werden. Die EMA entwickelte neue Richtlinien für die Zulassung von Biosimilars, welche 2005 im gesamten EU-Raum implementiert wurden (vgl. Pro Generika 2014a, S. 31). Diese Richtlinien enthalten neben „übergreifenden Richtlinien für alle Biosimilars“ auch „produktspezifische Richtlinien“. Durch diese genauen und zugleich sehr strengen Zulassungsverfahren und gesetzlichen Rahmenbedingungen hat die EU im Gebiet der Biosimilars weltweit eine führende Rolle eingenommen (vgl. Pro Generika 2014a, S. 32). Das Zulassungsverfahren wird in die folgenden Schritte gegliedert:
1. Zunächst muss die chemische und biologische Vergleichbarkeit mit dem biopharmazeutischen Referenzprodukt belegt werden. Die strukturelle Ähnlichkeit wird hier mit sämtlichen analytischen Methoden überprüft. Da eine genaue Übereinstimmung mit dem Referenzprodukt nicht möglich ist, müssen alle Abweichungen genau begründet werden (vgl. Pro Generika 2014a, S. 41).
2. Schritt zwei ist eine präklinische Studie. In einer präklinischen Studie werden Medikamente auf mögliche schädliche Wirkungen untersucht, die beim Menschen gravierende Folgen haben könnten. Biosimilar und Referenzprodukt werden hier über von der EMA in den produktspezifischen Richtlinien vorgegebenen Studien miteinander verglichen (vgl. Pro Generika 2014a, S. 41).
3. Im letzten Schritt werden die Biosimilars auf ihre Sicherheit und Verträglichkeit getestet. Da die biologische Vergleichbarkeit bereits überprüft wurde, kann auch davon ausgegangen werden, dass das Biosimilar und sein Referenzprodukt klinisch sehr ähnlich wirken. Der letzte Schritt im Zulassungsprozess ist aufgrund der möglichen Unterschiede in der Herstellung nötig: Andere Herstellungsverfahren können theoretisch dazu führen, dass das Biosimilar in der Anwendung am Patienten unverträglich ist. Über die Untersuchung von Nebenwirkungen und wie der Körper die Stoffe allgemein aufnimmt und verteilt, soll eine Verträglichkeit gewährleistet werden (vgl. Pro Generika 2014a, S. 42).
Es ist wichtig festzuhalten, dass der Prozess der Zulassung keine reine Formalie darstellt. Kommen in einem der drei Schritte Bedenken am Biosimilar auf, so wird die Zulassung verwehrt. In den letzten zehn Jahren wurden bereits mehrere Zulassungen für Biosimilars verwehrt oder vom Hersteller selbst zurückgezogen (vgl. Pro Generika 2014a, S. 21).
In den letzten Jahren sind die Anforderungen für die Zulassung von Biosimilars immer weiter gestiegen. Mittlerweile muss nicht mehr nur die Wirksamkeit, Sicherheit und Qualität gewährleistet sein, sondern Biosimilars müssen weiterhin im Vergleich zu den Medikamenten, die bereits auf dem Markt sind, entweder einen Vorteil für die Patienten oder eine finanzielle Erleichterung für die Krankenkassen bieten (vgl. Otto et al. 2010, S. 78).
2.3 Gesundheitliche Risiken von Biosimilars
Neben all den medizinischen Chancen und finanziellen Möglichkeiten zu Kosteneinsparungen, die Biosimilars bieten, bergen sie auch einige Risiken. Im Vergleich zu den traditionellen kleinmolekularen Medikamenten – die im Normalfall so klein sind, dass sie vom Immunsystem nicht erkannt werden – werden biopharmazeutische Medikamente vom Immunsystem aufgrund ihrer enormen Größe erkannt. Hierbei kann es dazu kommen, dass das menschliche Immunsystem die Stoffe als „fremd“ erkennt und es so zu einer komplizierten Immunreaktion kommt (vgl. EU Konsensinformationsblatt 2013, S. 9). Manche biopharmazeutischen Medikamente rufen gezielt eine Immunreaktion hervor, um ihre Wirkung zu entfalten. Bei anderen Biopharmazeutika ist diese Immunreaktion jedoch unerwünscht. Tritt sie trotzdem auf, kann sie in seltenen Fällen beim Patienten zu gravierenden Auswirkungen auf die Gesundheit führen (vgl. EU Konsensinformationsblatt 2013, S. 9).
Dieses seltene, jedoch nicht zu vernachlässigende Risiko der Biosimilars verdeutlicht noch einmal, wie wichtig die Überprüfung auf Qualität, Wirksamkeit und Sicherheit vor der Zulassung eines Biosimilars ist.
Zusammenfassend kann über das Kapitel „Biopharmazeutische Arzneimittel“ festgehalten werden, dass sich biopharmazeutische Medikamente über ihre Größe und ihren komplexen Aufbau von den kleinmolekularen Medikamenten – der traditionellen Tablette – unterscheiden. Kleinmolekulare Medikamente werden chemisch hergestellt, Biopharmazeutika dagegen entstehen in lebenden Organismen. Ist ein Patent für ein Biopharmazeutikum abgelaufen, kann es von anderen Unternehmen imitiert werden; dieses Nachahmerprodukt wird als Biosimilar bezeichnet und muss einen anspruchsvollen und finanziell sehr aufwendigen Zulassungsprozess durchlaufen. Der Name „Biosimilar“ kommt daher, dass Biopharmazeutika aufgrund ihrer hohen Komplexität einander niemals komplett gleich sind, sondern nur eine sehr hohe Ähnlichkeit aufweisen. Qualität, Wirksamkeit und Sicherheit müssen jedoch immer in gleicher Höhe gewährleistet sein. Lediglich beim Aufbau und der Struktur der Biosimilars wird nur eine Ähnlichkeit erreicht.
3. Der europäische Biosimilarmarkt
Im dritten Kapitel sollen die Strukturen des Marktes für Biopharmazeutika, speziell des europäischen Biosimilarmarktes, näher betrachtet werden. Nachdem die Eigenschaften und Chancen beleuchtet wurden, sollen die Marktakteure und Kooperationen zwischen ihnen untersucht und analysiert werden.
Der Markt der Biopharmazeutika ist noch sehr jung. Erst im Jahr 1973 konnte nachgewiesen werden, dass die Möglichkeit besteht, ein bestimmtes Gen aus einem lebenden Organismus heraus zu isolieren und in ein anderes lebendes System einzufügen und dort zu züchten. Mit dieser Entdeckung war die Tür zu biopharmazeutischen Medikamenten geöffnet. Der erste biologische Wirkstoff – ein Insulin – erhielt 1982 auf dem amerikanischen Markt von der „Food and Drug Administration“ (FDA – Arzneimittelzulassungsbehörde der USA) die Zulassung (vgl. Otto et al. 2010, S. 38 f.). Da der Markt zu Beginn unter anderem aufgrund der hohen klinischen Anforderungen und teuren Zulassungsprozesse sehr risikobehaftet war, stockte die Entwicklung in Europa zunächst noch ein wenig. In Europa und Deutschland steht im Vergleich zu den USA generell weniger Venture-Capital, also Risikokapital, zur Verfügung (vgl. Otto et al. 2010, S. 42). Erst ein 1996 in Deutschland von der Bundesregierung gestarteter „BioRegio-Wettbewerb“ sorgte für einen Start in der Biobranche in Deutschland. Die drei besten Regionen (München, Rheinland, Rhein-Neckar-Dreieck) wurden im Zeitraum von 1997 bis 2002 mit insgesamt 75 Mio. Euro prämiert und konnten so die Forschung und Neugründung von Unternehmen subventionieren (vgl. Otto et al. 2010, S. 43). Im europäischen Raum mussten also erst die Regierungen aktiv werden, damit ein dynamisches Wachstum der Branche zustande kam. Nachdem jedoch das Wachstum sowie die Forschung und Entwicklung angestoßen wurden, erhöhte sich die Zahl der Biotech-Unternehmen in Deutschland zwischen 1996 und 2001 von 104 auf ungefähr 400 Unternehmen (vgl. Otto et al. 2010, S. 43).
Trotz dieser späten dynamischen Entwicklung des europäischen Biotech-Marktes, hängt Europa im Vergleich zu den USA weiterhin stark zurück. Potenzielle „Blockbuster-Medikamente“ – also Medikamente, die jährlich mehr als 1 Milliarde US-Dollar (USD) Umsatz generieren – findet man in Europa nur sehr wenige. Während in den USA im Jahr 2010 fast 440 biologische Wirkstoffe in einer fortgeschrittenen klinischen Phase – das heißt Anwendung an mehreren hundert Menschen – getestet wurden, waren es in Europa lediglich 70. Der deutsche Anteil dabei lag bei 12 Wirkstoffen (vgl. Otto et al. 2010, S. 45).
Um einen Überblick über die größten Pharmaunternehmen zu erhalten, werden in der folgenden Tabelle die weltweit umsatzstärksten Pharmaunternehmen dargestellt:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tabelle 1: Umsatzstärkste Pharmaunternehmen weltweit (in Mio. USD) Stand 2013
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an PharmExec Pharma TOP50, 2014
In der Tabelle werden zu den aufgeführten Unternehmen jeweils die erzielten Umsätze und der davon investierte Teil in Forschung und Entwicklung aus dem Jahr 2013 dargestellt. Die Tabelle zeigt, dass die Hälfte der zehn umsatzstärksten Pharmaunternehmen weltweit aus den USA kommt. Europa ist zwar auch mit fünf Unternehmen vertreten, Deutschland kann jedoch kein Top10-Unternehmen stellen. Mit dem Schweizer Unternehmen Novartis wurde der amerikanische Branchenprimus Pfizer zum ersten Mal seit 2002 vom ersten Rang verdrängt. Es wird deutlich, dass Europa im Vergleich zu den USA aufholt. Einer der stärksten Erfolgsindikatoren ist laut „PharmExec“ die Führerschaft in der Biotechnologie. In der Tabelle wird ersichtlich, um was für eine umsatzstarke Branche es sich bei der Pharmabranche handelt. Um Umsatz zu generieren muss jedoch auch ein sehr gewichtiger Teil des Umsatzes in Forschung und Entwicklung investiert werden: Branchenführer Novartis, der im Jahr 2013 knapp über 46 Mrd. USD Umsatz generieren konnte, hat davon mehr als 9 Mrd. USD in die Forschung und Entwicklung reinvestiert. Dies entspricht 20,34 % des Gesamtumsatzes und beträgt somit ein Vielfaches dessen, was in anderen Branchen üblich ist. Im Maschinenbau zum Beispiel – einer Branche, die auch sehr von Innovationen abhängig ist – wurden 2009 lediglich 5 % des Umsatzes in Forschung und Entwicklung investiert (vgl. Statista 2010).
Insgesamt steht die Branche der biopharmazeutischen Arzneimittel vor einer Erfolg versprechenden Zukunft. Der anfängliche Boom ist – wie zu erwarten – zwar etwas abgeflacht, jedoch prognostizieren Experten für die Zukunft stabile Wachstumsraten von zum Teil über 8 % pro Jahr. In Deutschland lag der Marktanteil der Biopharmazeutika am gesamten Pharmamarkt bei 21,4 % mit einer steigenden Tendenz (vgl. Lücke et al. 2014, S. 9). Unterstrichen wird die steigende Bedeutung des Marktes für Biopharmazeutika von der Tatsache, dass im Jahr 2014 von 47 Neuzulassungen 14 Biopharmazeutika waren (vgl. Sucker-Sket 2015).
Nachdem im Jahr 1982 das erste Biopharmazeutikum in den USA und Deutschland seine Zulassung erhalten hatte, laufen seit 2002 immer mehr Patente ab und ein Markt für Nachahmerprodukte – der sogenannte Biosimilarmarkt – konnte entstehen (vgl. Verband forschender Arzneimittelhersteller 2010, S. 6). Wie oben bereits erwähnt, ist die Patentierung in der Pharmabranche das am meisten verbreitete Mittel, um Innovationen vor Imitationen zu schützen. Patentschutz ist notwendig, um Anreize für neue Innovationen zu geben. Er muss dem Innovator gewähren, dass dieser mindestens seine finanziellen Aufwendungen erwirtschaften kann, andernfalls gäbe es keinen Anreiz, Forschung und Entwicklung zu betreiben (vgl. Rammer 2002, S. 1). Denn während die Erstellung von „Know-how“ mit hohem Aufwand und Kosten verbunden ist, erfolgt die Verbreitung des „Know-how“, also ein technologischer Spillover, meist mit sehr geringen Kosten.
Wenn der Patentschutz nach 20 Jahren abgelaufen ist, kann jedes andere Unternehmen das Präparat imitieren, die Zulassung beantragen und – falls diese erfolgreich verlaufen ist – auf den Markt bringen. Aufgrund der hohen Anforderungen und des komplexen Prozesses der Imitation, können die Preise am Biosimilarmarkt nicht so extrem wie im traditionellen Generikamarkt gedrückt werden. Obwohl die Biosimilars immer noch sehr teuer in der Herstellung sind, bricht der Umsatz der sogenannten Referenzarznei innerhalb von zwei Jahren nach Ablauf des Patentes im Normalfall um bis zu 80 % ein (vgl. Otto et al. 2010, S. 77). Wenn der Hersteller des Originalpräparates also die Patentierung schon in einer frühen Testphase durchführen lassen hat, dann bleiben ihm so nur sehr wenige Jahre, um die hohen Kosten der Forschung und zusätzlich auch noch Gewinne zu erwirtschaften.
Wie bereits erwähnt, laufen seit dem Jahr 2002 die Patente mehrerer biopharmazeutischer Medikamente, darunter die einiger Blockbuster, ab. Das erste Biosimilar in der EU wurde 2006 zugelassen – da immer mehr Patente ablaufen, ist der Markt seitdem immer weiter gewachsen.
Ein weiterer Grund für die steigende Bedeutung des Biosimilarmarktes ist eine „Schaffenskrise“, in der sich die traditionelle Medikamentenentwicklung derzeit befindet. Aus diesem Grund wird die Entwicklung biopharmazeutischer Medikamente, insbesondere die Entwicklung von Biosimilars, ein immer wichtigerer Zweig für Unternehmen in der Medizinbranche (vgl. Böll 2009, S. 1). In der kleinmolekularen Medikamentenentwicklung wird Jahr für Jahr mehr Geld in Forschung und Entwicklung gesteckt, jedoch schaffen es immer weniger Medikamente auch auf den Markt. Man spricht davon, dass die „Pipeline“ der Branchenführer leer ist. Speziell beim drittgrößten deutschen Pharmakonzern Merck ist die traditionelle Medikamentenentwicklung in den letzten Jahren stark ins Stocken geraten (vgl. Smolka 2015, S. 26). Auch bei den kleinmolekularen Medikamenten laufen immer mehr Patente aus und wenn die Pharmaunternehmen nicht zeitnah neue Blockbuster entwickeln, werden ihnen die kostengünstigen Generika den gesamten Umsatz nehmen. Die neuen Zulassungsverfahren in der EU verlangen außerdem, dass die Preise für neue, kleinmolekulare Medikamente gesenkt werden, denn wenn sich die aktuelle Entwicklung fortsetzt, sind sämtliche Gesundheitssysteme bald bankrott. Steigende Medikamentenpreise sind eine Folge der „ausgetrockneten“ Innovationspipeline. Wenn weniger Innovationen hervorgebracht werden, müssen die Konzerne mit diesen umso mehr Geld verdienen. Steigen die Preise für neue Medikamente weiter an, werden schlicht die Zulassungen verwehrt (vgl. Böll 2009, S. 3). Wenn die großen Pharmakonzerne dann keine neuen Medikamente mehr auf den Markt bringen können, weil sie entweder keine Innovationen mehr in der Pipeline haben oder weil die Zulassung aufgrund überhöhter Preise verwehrt wurde, kommt es zu gewaltigen Umsatzeinbußen. In diesem Fall gerät die Medikamentenforschung, die Milliardenbeträge verschlingt, noch weiter ins Stocken und die Unternehmen kommen in große finanzielle Schwierigkeiten.
Pharmaunternehmen müssen ihr Konzept also von Grund auf überdenken und sich neu positionieren. Eine Möglichkeit zur Neupositionierung bietet der gerade aufkommende Biosimilarmarkt. Da dem Biosimilarmarkt für die nächsten Jahre ein großes Wachstum prognostiziert wird, könnte er unter anderem für „in Not geratene“ Pharmaunternehmen, die bisher kleinmolekulare Medikamente hergestellt haben, eine große Chance bieten.
3.1 Marktstrukturen, Eigenschaften und Chancen des Biosimilarmarktes
Im folgenden Unterkapitel sollen nun die Marktstrukturen und Eigenschaften des Biosimilarmarktes untersucht werden und außerdem die Chancen, die er bietet – welche meist finanzieller Natur sind – aufgezeigt werden.
Um mit den finanziellen Chancen zu beginnen, die Biosimilars bieten, kann eine mögliche finanzielle Entlastung der ohnehin schon strapazierten europäischen Gesundheitssysteme angeführt werden. Zwar reichen die Einsparungsmöglichkeiten bei weitem nicht an die der klassischen Generika heran, billiger als ihre Referenzprodukte sind die Biosimilars jedoch trotzdem. Im Vergleich zu den Referenzprodukten lassen sich bei den Generika bis zu 80 % einsparen, bei den Biosimilars aktuell zwischen 8 % und 32 %. Eine deutliche Erhöhung der Einsparungen durch Biosimilars ist aufgrund der hochkomplexen und teuren Herstellung aktuell noch nicht in Sicht (vgl. Zylka-Menhorn/Korzilius 2014, S. 454). Auch die lange Entwicklungszeit eines Biosimilars, die mit zwischen 7 und 8 Jahren und Kosten bis zu 250 Mio. USD deutlich über den Generika liegt, verhindert eine höhere Kosteneinsparung (vgl. Blackstone, Fuhr 2013, S. 471).
Da die europäischen Gesundheitssysteme mittlerweile finanziell sehr angeschlagen sind, ist die Kosteneinsparung von der EMA zu einem wichtigen Zulassungskriterium für ein Biosimilar ausgewählt worden. So könnte Patienten, denen vor Ablauf des Patents eine Therapie mit einem Biopharmazeutikum aufgrund des hohen Preises nicht genehmigt wurde, eine Therapie mit dem Biosimilar nun erstattet werden (vgl. Pro Generika 2014b, S. 11). Wird dieser elementare Punkt der Kosteneinsparung von einem Biosimilar nicht erfüllt, so gibt es für die EMA keinen Anreiz für eine Zulassung.
Es wird deutlich, dass mit zunehmendem Ablauf von Patenten die Anzahl an Biosimilars und damit auch das Einsparpotenzial ansteigt – seit dem Jahr 2012 wurden Biopharmazeutika mit einem weltweiten Umsatzvolumen von ca. 64 Mrd. USD patentfrei (vgl. Walter 2012, S. 485). Das Einsparpotenzial entsteht zum einen durch die günstigeren Biosimilars, zum anderen durch die damit verbundenen Preissenkungen für die Originalpräparate (vgl. Laschet 2008).
Die folgende Abbildung zeigt, wie viele Biosimilars aktuell auf den europäischen Markt drängen. Die Pipeline der Biosimilars ist voll:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 2: Pipeline der Biosimilars für den europäischen Markt 2014
Quelle: Pro Generika 2014b, S. 9
In der Abbildung wird der Stand der Biosimilar-Pipeline für den europäischen Markt im Juni 2014 für vier unterschiedliche Wirkstoffe dargestellt. Eine Farbe steht jeweils für ein Biosimilar, das gerade von verschiedenen Firmen entwickelt wird. Wie bereits erläutert, verdeutlicht die Abbildung, dass in den frühen Testphasen viele Biosimilars vertreten sind. Die endgültige Zulassung ist jedoch noch ein schwerer und finanziell aufwendiger Weg, auf dem noch einigen potenziellen Biosimilars die Zulassung verwehrt wird. Aktuell sind in der EU 19 Biosimilars zugelassen (vgl. Verband forschender Arzneimittelhersteller 2015, S. 1-6).
Wenn noch weitere Biosimilars die Zulassung für den europäischen Markt erhalten, dann können bis zum Jahr 2020 bis zu 34,4 Mrd. Euro eingespart werden. Diese Zahl wurde bei einer von der Firma Sandoz in Auftrag gegebenen Studie des „Instituts für Gesundheits- und Sozialforschung“ (IGES) mittels einer Modellrechnung ermittelt. Die 34,4 Mrd. Euro wurden als Gesamtersparnis für die EU-Staaten Deutschland, Frankreich, Italien, Polen, Großbritannien, Rumänien, Schweden und Spanien errechnet. Das Einsparpotenzial allein für Deutschland wird bis 2020 auf bis zu 11,7 Mrd. Euro geschätzt. Die größten Einsparungen nach Deutschland wird für Frankreich und Großbritannien erwartet (Haustein et al. 2012, S. 120 ff.). Ein wichtiger Punkt für die tatsächlichen finanziellen Einsparungen durch Biosimilars ist laut der IGES-Studie eine schnelle Verfügbarkeit am Markt direkt nach dem Patentablauf und außerdem das schnelle Erreichen eines gewichtigen Marktanteils. Politisch muss das Einsparpotenzial derart gefördert werden, dass Verträge zwischen Krankenkassen und Anbietern von patentgeschützten Biopharmaka über den Patentablauf hinaus verboten werden (Haustein et al. 2012, S. 124 ff.).
Nun soll über die Eigenschaften des europäischen Biosimilarmarktes gesprochen werden. Im Jahr 2011 fielen innerhalb der EU noch weniger als 1 % des Umsatzes mit biopharmazeutischen Medikamenten auf Biosimilars. Trotzdem findet in der EU ungefähr 80 % des weltweiten Biosimilarmarktes statt (vgl. Blackstone/Fuhr 2013, S. 471). Dies verdeutlicht zum einen den trotz aller Wachstumschancen immer noch recht kleinen Biosimilarmarkt, zum anderen aber auch die Vorreiterrolle, die die EU hier eingenommen hat.
Auch in Deutschland ist der Umsatz mit Biosimilars im Vergleich zu den Originalpräparaten immer noch recht gering. So entfielen 2013 auf die Gesamtausgaben der gesetzlichen Krankenversicherungen in Deutschland für Biopharmazeutika in Höhe von 5,3 Mrd. Euro lediglich 87 Mio. Euro, also 1,64 %, auf Biosimilars (vgl. Pro Generika 2014a, S. 76). Innerhalb Deutschland gibt es von Bundesland zu Bundesland erhebliche Unterschiede in der Versorgung mit Biosimilars. Während das Biosimilar des Wirkstoffes „Somatropin“ (ein Wachstumshormon) in Rheinland-Pfalz einen Anteil von 31,7 % hat, sind es in Sachsen-Anhalt lediglich 0,8 %. Ein Grund dafür ist, dass die regionalen Verbände der Krankenkassen unterschiedliche vertragliche Vereinbarung zum Einsatz von Biosimilars abschließen (vgl. Pro Generika 2014a, S. 78 f.). Mittlerweile wurde festgelegt, dass die erstmalige biopharmazeutische Behandlung eines Patienten mit einem Biosimilar erfolgen soll, sofern dieses auf dem Markt ist und es für den behandelnden Arzt keinen Grund gibt, der dagegen spricht. Das Jahr 2015 bringt für Deutschland einen Paradigmenwechsel mit sich: Zum ersten Mal wird das Umsatzvolumen von Medikamenten, deren Patente ablaufen, in der Branche der Biopharmazeutika größer sein, als das der kleinmolekularen, chemischen Medikamente. Patente für Biopharmazeutika laufen mit einem Umsatz von 1,17 Mrd. Euro ab, chemische Wirkstoffe dagegen verlieren Patente mit einem Umsatz in Höhe von 0,91 Mrd. Euro (vgl. Pro Generika 2014a, S. 79).
Neben allen Chancen, die mit den Biosimilars einhergehen, dürfen die Risiken und Marktbarrieren, auf die sich die Marktteilnehmer einlassen, nicht vernachlässigt werden. Wenn ein Biosimilar auf den Markt gebracht werden soll, wird es mit existentiellen Barrieren im Wettbewerb mit den originalen biopharmazeutischen Präparaten konfrontiert werden. Die Hürden sind hier größer als bei den traditionellen Generika. Im Speziellen müssen Biosimilars die Barrieren überwinden, die mit der Herstellung, dem Marketing, der aufwendigen kühlen Lagerung und der damit verbundenen Schwierigkeiten bei der Lieferung verbunden sind. Außerdem müssen unerwünschte Immunreaktionen bei den Patienten, zu denen es aufgrund der Struktur der Biosimilars kommen kann, als Risiko beachtet werden (vgl. Blackstone/Fuhr 2013, S. 471).
Eine der größten Markteintrittsbarrieren ist die hochkomplexe Herstellung der Biosimilars. Will ein branchenfremdes Unternehmen in den Biosimilarmarkt einsteigen, muss es sich zunächst einmal das nötige Know-how für die Herstellung aneignen. Firmen, die selbst patentierte Biopharmazeutika vertreiben und somit Erfahrung mit der Herstellung von biologischen Arzneimitteln haben, sind beim Einstieg in den Biosimilarmarkt klar im Vorteil. Das ist im Endeffekt auch der Grund für die Vermutung, dass der Biosimilarmarkt von erfahrenen Firmen dominiert werden wird (vgl. Blackstone/Fuhr 2013, S. 472). Über Kooperationen und strategische Allianzen, die verschiedene Firmen eingehen, um auf einen höheren Erfahrungsschatz zurückgreifen zu können, wird im folgenden Unterkapitel gesprochen. Die aufwendige Zulassung und der anschließende dauerhaft teure Herstellungsprozess bergen finanzielle Risiken, die für kleinere Unternehmen in dem Fall, dass die Zulassung verwehrt wird, bis zum Bankrott führen können. Andere potenzielle Marktteilnehmer betreten den Markt aufgrund dieser Risiken möglicherweise erst gar nicht. Aufgrund von „Lernkurven-Effekten“ und Möglichkeiten im Bereich der Forschung und Entwicklung haben große, erfahrene Firmen im Biosimilarmarkt einen wahrscheinlich entscheidenden Vorteil gegenüber umsatzschwachen und unerfahrenen Neueinsteigern (vgl. Blackstone/Fuhr 2013, S. 472).
Eine weitere Barriere für den Markteintritt und Erfolg von Biosimilars ist die Schwierigkeit, Patienten für die klinischen Tests zu gewinnen. Die Patienten könnten abgeneigt sein, an den Tests teilzunehmen. Speziell bei lebensbedrohlichen Krankheiten wollen die meisten Patienten lieber mit dem originalen Biopharmazeutikum behandelt werden, anstatt mit einem Biosimilar in der klinischen Testphase, das vielleicht wirkt – oder auch nicht. Ein weiterer Grund, warum es schwierig werden kann, freiwillige Patienten für die Tests zu finden ist, dass möglicherweise mehrere Firmen ein bestimmtes Biosimilar zur selben Zeit entwickeln. Dann kann es zu einer Art „Wettbewerb“ um die limitierte Anzahl der Patienten kommen. Basierend auf Gesprächen mit Pharmavertretern haben manche Hersteller von Biosimilars außerdem Schwierigkeiten darin geäußert, das Referenzprodukt in der für die Entwicklung benötigten Menge zu erhalten. Die Anbieter der Originalpräparate wollen die Entwicklung des Biosimilars so erschweren und geben die Präparate oft nur zu sehr überteuerten Preisen heraus (vgl. Blackstone/Fuhr 2013, S. 472).
Ein weiterer Faktor, der für die Unternehmen im Biosimilarmarkt ein enormes Risiko birgt, ist die Unsicherheit verbunden mit anderen potenziellen Konkurrenten. Wie eine Studie des „Biotechnology Information Institute“ zeigte, arbeiteten Firmen zum Beispiel allein für den Wirkstoff „Herceptin“ (ein Krebsmedikament) an 21 Biosimilars gleichzeitig. Wenn eines dieser Biosimilars zugelassen wird, kann es den Markt möglicherweise für eine gewisse Zeit dominieren. Im schlechtesten Fall waren aber alle finanziellen Mühen des Unternehmens umsonst, da ein anderes Biosimilar etwas günstiger angeboten werden kann und sich so große Marktanteile verschafft (vgl. Blackstone/Fuhr 2013, S. 472).
Um das Know-how über den Markt der Biosimilars, beziehungsweise allgemein über biopharmazeutische Medikamente zu erhöhen, gehen viele Unternehmen Kooperationen ein. Im folgenden Unterkapitel sollen die theoretischen Grundlagen dieser Kooperationen und strategischen Allianzen erklärt werden.
3.2 Theoretische Grundlagen von Kooperationen und strategischen Allianzen
Der europäische Biosimilarmarkt ist, wie bereits ausgeführt, ein noch sehr junger Markt. Ein junger Markt birgt immer ein gewisses Risiko und Unsicherheiten, außerdem ist er dadurch gekennzeichnet, dass an ihm viele unerfahrene Marktteilnehmer partizipieren wollen. Über die Begriffe „Kooperation“ und „Allianz“ existieren zwar Unmengen an Literatur, eine vollkommen einheitliche Definition ist allerdings nicht auszumachen. Autoren aus vielen verschiedenen Fachrichtungen haben versucht, die Entstehung einer Kooperation oder strategischen Allianz zu definieren, aus diesem Grund konnte sich keine einheitliche Definition durchsetzen.
Unter einer Allianz versteht man jedoch im Allgemeinen eine enge Verbindung zwischen zwei oder auch mehreren Unternehmen, bei der Ressourcen, Wissen und Fähigkeiten untereinander ausgetauscht oder auch gemeinsam erstellt werden. Das Ziel einer solchen Allianz, die unter Umständen auch langfristiger Natur sein kann, ist die Verbesserung der Wettbewerbsposition der einzelnen Unternehmen und die Aufteilung von möglichen Risiken (vgl. Spekman et al. 1998, S. 631).
Eine langfristige Zusammenarbeit der Partner wird im Zusammenhang der sogenannten „strategischen Allianz“ besonders betont. Hierbei steht der Ausgleich von eigenen Schwächen durch die Stärken des Partners und die Senkung von Risiken im Vordergrund, um im Markt längerfristige bedeutende Vorteile gegenüber den Konkurrenten zu erreichen (vgl. Sydow 1992, S. 63). Für den Biosimilarmarkt sind diese strategischen Allianzen besonders relevant, wenn beispielsweise ein junges Unternehmen mit einer erfolgversprechenden Zulassung für ein Biosimilar, aber wenig Erfahrung, den Markt betreten will. In diesem Fall würde sich eine strategische Allianz mit einem großen Pharmakonzern anbieten, da dieser einen großen Erfahrungsschatz und auch das nötige Kapital besitzt, das Biosimilar am Markt zu etablieren.
Der Begriff der „Kooperation“ ist dem der „strategischen Allianz“ sehr ähnlich. Er wird sogar unter anderem von Sydow (1992, S. 62) synonym zur „strategischen Allianz“ verwendet. Eine Kooperation ist – ausgehend von ihrer Übersetzung – eine Form der Zusammenarbeit oder eine gemeinschaftliche Erfüllung von Aufgaben durch zwei oder mehrere Unternehmen (vgl. u.a. Friese 1998, S. 58). Andere Herangehensweisen verstehen Kooperationen als einen Prozess (vgl. Wöhe 1996, S. 381), ein soziales System (vgl. Etter 2003, S. 45) oder als eine Form der kooperativen Strategie (vgl. Etter 2003, S. 44). In den folgenden Kapiteln dieser Arbeit werden die Begriffe „strategische Allianz“ und „Kooperation – wie bereits von Sydow –synonym verwendet.
Es gibt auch Elemente von Kooperationen, bei denen sich die Autoren im Großen und Ganzen einig sind. Dass die Kooperation auf freiwilliger Basis erfolgt und die Unternehmen weiterhin wirtschaftlich selbstständig bleiben, erwähnen beispielsweise Pausenberger (1989), Olesch (1995) und Nieschlag et al. (1997). Eine weitere Ausprägung von Kooperationen ist die Formalität der Zusammenarbeit. Kooperationen werden zum Teil durch Verträge fixiert, viele Kooperationen sind jedoch auch informeller Natur und beruhen auf gegenseitigem Vertrauen (Häussler 2004, S. 6). Für viele Autoren, wie beispielsweise Pausenberger (1989), ist eine vertragliche Fixierung für den Erfolg einer Kooperation nicht nötig.
Ein weiterer Vorteil und Grund, weshalb sich strategische Allianzen und Kooperationen auf dem Biosimilarmarkt anbieten ist, dass der Wissensentstehungsprozess kumulativer und interaktiver Natur ist. Neues Know-how baut auf bereits bestehendem Know-how auf – die Generierung von neuem Wissen ist äußerst zeitintensiv (vgl. Dosi 1982, S. 159). Des Weiteren benötigt die effektive Generierung von Know-how Feedback; eine enge Zusammenarbeit und Interaktion zwischen den Kooperationspartnern ist unabdingbar (vgl. Kaufmann/Tödtling 2001, S. 791). Dies bedeutet für die Praxis, dass Unternehmen, die beispielsweise ihr internes Wissen in jeweils gegensätzliche Richtungen vermehrt haben, sich zu einer strategischen Allianz zusammenschließen könnten. Durch die Verknüpfung des jeweils vorhandenen Wissens wäre diese strategische Allianz vielversprechend.
Trotz der vielfältigen Chancen, die strategische Allianzen und Kooperationen bieten, führen sie nicht zwangsläufig zum Erfolg. Sie bergen einige Risiken, wie zum Beispiel eine mögliche Rivalität zwischen den Firmen, die die Zusammenarbeit nachhaltig beeinträchtigt. Auch unterschiedliche Managementstrukturen, die zu einer ineffizienten Zusammenarbeit führen können, sind als mögliches Risiko nicht zu vernachlässigen. In Zahlen ausgedrückt bedeutet dies, dass mehr als die Hälfte aller strategischen Allianzen ihre gesteckten Ziele nicht erreichen und den beteiligten Unternehmen somit nicht die erhoffte wirtschaftliche Verbesserung bringen (vgl. Park/Ungson 2001, S. 37).
Somit wird deutlich, dass eine genaue Auswahl der Partner von größter Bedeutung ist. Moeller (2010) beschreibt beispielsweise den positiven Effekt einer guten Partnerwahl in Bezug auf das gegenseitige Vertrauen, die Leistungsbereitschaft und Hingabe für das gemeinsame Projekt. Weiterhin führt eine gute Partnerwahl zu einer Senkung des Risikos für opportunistisches Verhalten der Partner und somit im Endeffekt zu einer Erhöhung des Erfolges einer Kooperation (vgl. Moeller 2010, S. 32). Auch für den Know-how Zuwachs innerhalb des Unternehmens ist eine gut überlegte Partnerwahl essentiell – im schlechtesten Fall würde nur Know-how aus dem Unternehmen abfließen, aber kein neues hinzukommen. Solch ein Fall einer schlechten Kooperation wäre denkbar, wenn man das oben erwähnte Beispiel einer Kooperation zwischen einem großen, erfahrenen Pharmakonzern und einem kleinen Unternehmen mit einer Zulassung für ein Biosimilar, in eine negative Richtung fortführt. Dann könnte der große Pharmakonzern seine finanzielle Macht ausspielen und versuchen, das kleinere Unternehmen komplett zu übernehmen.
Ausgehend von diesen theoretischen Grundlagen zu „Kooperationen“ und „strategischen Allianzen“ werden in den folgenden Unterkapiteln zunächst die Akteure des europäischen Biosimilarmarktes vorgestellt. Anschließend soll untersucht werden, welche Verbindungen zwischen den Akteuren in Form von strategischen Allianzen oder Kooperationen bestehen und wie sie mit der Unsicherheit eines neuen Marktes umgehen.
3.3 Akteure auf dem europäischen Biosimilarmarkt
Der europäische Biosimilarmarkt ist gekennzeichnet durch gegensätzliche Typen von Herstellern. Zum einen gibt es viele „global Player“, die schon lange im biotechnologischen Sektor aktiv sind, zum anderen gibt es viele junge und innovative Startups, die eine rasante Entwicklung an den Tag legen. Während der Vorstellung einiger der Akteure des europäischen Biosimilarmarktes wird deutlich werden, dass zwischen den Akteuren keine Einigkeit besteht, ob sich der Einstieg in den Biosimilarmarkt lohnt oder nicht.
Beim ersten Akteur – der „Boehringer Ingelheim GmbH & Co. KG“ – handelt es sich um einen deutschen Großkonzern. Mit insgesamt 47.743 Mitarbeitern und einem Umsatz von 13,317 Mrd. Euro (2014) ist Boehringer Ingelheim eines der größten forschenden Pharmaunternehmen in Deutschland. 2014 entfielen auf den europäischen Markt 4,081 Mrd. Euro, also rund 30 % des Gesamtumsatzes, auf die Sparte der Biopharmazeutika 4 % des Gesamtumsatzes (vgl. Boehringer Ingelheim 2015, S. 2). Der Konzern wollte sich zunächst aus dem Geschäft mit den Biosimilars heraushalten, erkannte aber dann doch das Potenzial und richtete den Forschungsschwerpunkt im Geschäftsbereich der Biopharmazeutika auf Biosimilars aus. Das Unternehmen hat sich das Ziel gesetzt, mit hochwertigen Biosimilars zu einem der Marktführer zu werden (vgl. Smolka 2015, S. 26). Im September 2014 erhielt der Konzern die erste Zulassung für ein Biosimilar – einen Insulinstoff (vgl. Pro Generika 2014a, S. 2). Boehringer Ingelheim hat weitere Biosimilars in der Pipeline, die 2015 in die Phase-III-Studien des Zulassungsverfahrens – also klinische Tests an Patienten – gelangen sollen (vgl. Boehringer Ingelheim 2015, S. 57).
Ein weiterer großer deutscher Pharmakonzern, der den Einstieg in den Biosimilarmarkt gewagt hat, ist die „Merck KGaA“ mit Sitz in Darmstadt. Es ist anzumerken, dass der Konzern völlig unabhängig vom US-amerikanischen Konzern „Merck & Co“ ist. Die „Merck KGaA“, gegründet im Jahr 1668, ist eines der ältesten pharmazeutische Unternehmen der Welt und verfügt somit über einen riesigen Erfahrungsschatz über den Pharmamarkt (vgl. Merck 2015, S. 258). Im Jahr 2014 erzielte Merck mit weltweit rund 39.000 Mitarbeitern Umsatzerlöse in Höhe von 11,291 Mrd. Euro (vgl. Merck 2015, S. 2). Merck treibt aktuell die Entwicklung von Biosimilars voran und legt den Fokus dabei auf die Entwicklung von Wirkstoffen durch eigene Forschung und Entwicklung und außerdem durch Partnerschaften mit anderen Akteuren dieser Branche. Der Konzern zielt darauf ab, seine langjährige Erfahrung im Bereich der biopharmazeutischen Medikamente derart zu nutzen, dass ein wettbewerbsfähiges Biosimilar-Portfolio erstellt werden kann (vgl. Merck 2015, S. 51). Das Management von Merck plant, mit den Phase-III-Studien für Biosimilars Ende 2015 bis Anfang 2016 zu beginnen. Obwohl Merck die Biosimilars zunächst als Bedrohung einstufte und sie den Investoren im Geschäftsbericht als Risiko für „größeren Wettbewerbsdruck“ präsentierte, hat sich der Konzern entschieden, diesen Markt nicht allein den Konkurrenten zu überlassen, sondern selbst aktiv zu werden und zu investieren. Da die traditionelle Medikamentenentwicklung von Merck etwas ins Stocken geraten ist, empfiehlt sich die Investition in Biosimilars und so sollen im Jahr 2015 bis zu 150 Mio. Euro in die Biosimilar-Forschung – insbesondere in die Bereiche „Onkologie“, also Krebsforschung und „entzündliche Erkrankungen“ – investiert werden (vgl. Smolka 2015, S. 26). Im Geschäftsbericht für das Jahr 2014 weist Merck die Biosimilars nicht mehr als Risiken aus, sondern als Chancen (vgl. Merck 2015, S. 125).
Um zu verdeutlichen, dass längst nicht alle Pharmakonzerne den Biosimilarmarkt positiv und als Chance betrachten, wird auch die „Bayer AG“ kurz vorgestellt. Anders als Boehringer Ingelheim und Merck lehnt der deutsche Branchenführer des Pharmamarktes den Einstieg in den Biosimilarmarkt aktuell noch ab. Weil der Aufwand für die klinischen Studien des Zulassungsprozesses sehr groß ist, hat sich der Konzern gegen einen Einstieg in den Biosimilarmarkt entschieden und will sich stattdessen lieber mit innovativen Originalpräparaten von den Konkurrenz abheben (vgl. Smolka 2015, S. 26).
Ähnlich wie in Deutschland, herrscht auch in der Schweiz zwischen den Großkonzernen Uneinigkeit darüber, ob sich der Einstieg in den Biosimilarmarkt lohnt oder nicht. Der Konzern Novartis will über seine Tochterfirma Sandoz eine führende Rolle auf dem Biosimilarmarkt einnehmen. Die „Novartis AG“ hat im Jahr 2014 mit einem Nettoumsatz von fast 58 Mrd. USD mehr als 1,2 Mrd. Patienten versorgt – es handelt sich also um einen absoluten Pharmariesen (vgl. Novartis 2015, S. 6 f.). Die auf Generika, insbesondere Biosimilars, spezialisierte Tochterfirma Sandoz erzielte 2014 allein mit Biosimilars einen Umsatz in Höhe von 514 Mio. USD und konnte so ihre globale Führungsposition weiter festigen (vgl. Novartis 2015, S. 34). Im Rahmen des neuen Zulassungsverfahrens in den USA von 2009 war Sandoz im Mai 2014 das erste Unternehmen, das eine Biosimilar-Zulassung für den US-amerikanischen Markt beantragte – Berater der FDA haben bereits die Zulassung empfohlen. Anfang 2015 wurde diese dann auch erteilt (vgl. Blasius 2015). Schon auf dem europäischen Markt war Sandoz das Unternehmen, das 2006 als erstes eine Zulassung für ein Biosimilar erhalten hatte. Mit aktuell drei zugelassenen Biosimilars und insgesamt sechs Biosimilars in der Zulassungsphase wird nochmals die führende Rolle von Sandoz in dieser Branche unterstrichen (vgl. Sandoz 2014, S. 7). Die bereits zugelassenen Biosimilars von Sandoz nehmen in ihren Kategorien den jeweils größten Marktanteil ein und konnten von 2013 auf 2014 ihren Umsatz um 23 % steigern (vgl. Pröbstl 2014). Für die beiden Standorte von Sandoz in Kundl und Schaftenau in Österreich, ist der Wachstumsmarkt der Biosimilars ein wichtiges Standbein. 2009 wurde am Standort Kundl eine Produktionsanlage für Biosimilars in Betrieb genommen, die einen Investitionsaufwand in Höhe von 23 Mio. Euro benötigte (vgl. Sandoz 2013, S. 3).
Die schweizer „Roche AG“ dagegen lehnt wie die deutsche „Bayer AG“ den Einstieg in den Biosimilarmarkt ab. Roche unterstützt zwar die Entwicklung von Rahmenbedingungen innerhalb der EU, die die Sicherheit von Biosimilars gewährleisten, vertritt jedoch gleichzeitig die Ansicht, dass diese Rahmenbedingungen die Entwicklung von neuen Biopharmazeutika nicht behindern dürfen. Im Gegenteil sogar, die Regulierungen für Biosimilars sollen Anreize geben, innovative Forschung nach neuen Medikamenten zu betreiben (vgl. Roche 2014, S. 2). Im Geschäftsbericht für das Jahr 2014 warnt Roche vor einer weiteren Gruppe neben den Biosimilars, den sogenannten „nicht vergleichbaren Biopharmazeutika“. Hierbei handelt es sich um Nachahmungen, die die angeforderten Sicherheitsstandards im Vergleich mit den Originalpräparaten nicht erreichen und somit ein Risiko für die Patienten darstellen. Insgesamt steht der Konzern den Biosimilars eher skeptisch gegenüber und will den Zulassungsprozess noch weiter verschärfen. Roche hält demnach an seiner bewährten Strategie fest, durch Innovationen den Wettbewerbern immer einen Schritt voraus zu sein und diese Innovationen auch dementsprechend zu schützen (vgl. Roche 2015, S. 103).
Neben den großen Firmen existieren auf dem europäischen Biosimilarmarkt jedoch auch einige kleine und junge Unternehmen. Eines davon ist die im Jahr 2008 gegründete „amp biosimilars AG“ mit Sitz in Hamburg. Mit ihren 10 Mitarbeitern und aktuell noch keinen Umsatzerlösen ist die „amp biosimilars AG“ ein vollkommener Gegensatz zu den zuvor vorgestellten Akteuren – die ersten Gewinne werden erst 2019 erwartet (vgl. GBC Investment Research 2015, S. 1). Das Unternehmen legt seinen Fokus komplett auf die Entwicklung und Herstellung von qualitativ hochwertigen Biosimilars. Erst 2014 wurde nach der endgültigen Schwerpunktlegung auf den Bereich der Biosimilars das operative Geschäft aufgenommen; im April 2015 erfolgte die Notierung an der Münchener Börse zur Kapitalbeschaffung (vgl. GBC Investment Research 2015, S. 4). Um die Produktpipeline zu finanzieren, steht die „amp biosimilars AG“ in Verhandlungen mit vorwiegend chinesischen Kooperationspartnern – zurzeit befinden sich vier Biosimilar-Entwicklungsprojekte in der Pipeline. Abbildung 3 zeigt den Entwicklungsfortschritt dieser vier Biosimilars.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 3: Projektpipeline der amp biosimilars AG 2015
Quelle: GBC Investment Research 2015, S. 10
Die Abbildung soll veranschaulichen, wie die Pipeline eines Biosimilar Unternehmens (hier am Beispiel der „amp biosimilars AG“) aussehen kann. Alle vier aktuellen Projekte der „amp biosimilars AG“ befinden sich in der präklinischen Phase und genau das ist auch die Unternehmensstrategie: Bis zu den frühen und vergleichsweise günstigen präklinischen Studien werden die Biosimilar-Projekte im Unternehmen durchgeführt und anschließend auslizenziert – um Kosten zu sparen und später Lizenzeinnahmen verbuchen zu können (vgl. GBC Investment Research 2015, S. 9).
Ein weiteres kleineres Unternehmen aus dem Bereich der Biosimilars ist die „Formycon AG“ mit Hauptsitz in Martinsried bei München. Das im Jahr 1999 als „Scil Technology GmbH“ gegründete Unternehmen ließ sich 2010 als „Formycon AG“ an der Börse notieren und strebt mit einer vergleichbaren Strategie wie die „amp biosimilars AG“ die Qualitätsführerschaft im Bereich der Biosimilars an. In der internen Projektpipeline befinden sich drei Biosimilars in der Entwicklung, wobei zwei davon bereits erfolgreich an die „Santo Holding GmbH“ der Gebrüder Strüngmann auslizenziert wurden. Dass die Gründer des deutschen Pharmakonzerns „Hexal“ – der in der Biosimilarbranche auch selbst sehr aktiv ist – Thomas und Andreas Strüngmann die Biosimilarentwicklung von Formycon durch den Erwerb einer Lizenz finanziell unterstützen, brachte Formycon innerhalb der Branche ein nochmals gesteigertes Interesse und Ansehen (vgl. Formycon 2015a, S. 5 f.). Anders als amp biosimilars entwickelt Formycon Biosimilars nicht nur bis zu den frühen Phasen im Zulassungsprozess, sondern deckt von den Anfängen der Forschung bis hin zu den fortgeschrittenen klinischen Endphasen alles ab. Die Idee dahinter ist, so zu schnelleren Ergebnissen zu kommen und folglich einen schnelleren Markteintritt eines Biosimilars herbeizuführen. Als Beleg für eine erfolgreiche Arbeit konnte Formycon 2014 erstmals Gewinn erzielen (vgl. Formycon 2015a, S. 5 f.). Den Start der Vermarktung der Biosimilars plant Formycon für das Jahr 2020.
Neben den vorgestellten Marktakteuren haben folgende Konzerne bereits eine Zulassung für ein Biosimilar auf dem europäischen Markt erhalten: Hexal (Deutschland), Medice (Deutschland), Hospira (USA), STADA (Deutschland), CT Arzneimittel (Deutschland), ratiopharm (Deutschland), Teva Generics (USA), Accord Healthcare (Deutschland), Celltrion (Korea), Finox (Schweiz) (vgl. Pro Generika 2014a, S. 2). Es ist zu erkennen, dass gerade deutsche und schweizerische Unternehmen auf dem europäischen Biosimilarmarkt sehr dominant sind – aber auch US-amerikanische Unternehmen sind vertreten.
Es wurden nun einige Akteure des europäischen Biosimilarmarktes genauer vorgestellt und die Uneinigkeit über den Sinn eines Einstiegs in den Biosimilarmarkt verdeutlicht. Im nächsten Kapitel werden die bestehenden Kooperationen und strategischen Allianzen zwischen den Unternehmen analysiert. Die zum Teil bereits kurz erwähnten Partnerschaften und Auslizenzierungen von Biosimilars in der Entwicklung, werden im folgenden Teil detailliert herausgearbeitet.
3.3.1 Kooperationen und Umgang mit Unsicherheit
Die Intention des Unternehmens Boehringer Ingelheim ist, die eigenen Produktportfolios auch zukünftig über Kooperationen mit externen Partnern weiterzuentwickeln. Um dies zu gewährleisten, werden von Boehringer Ingelheim neben mehreren Forschungs- und Entwicklungszentren in Deutschland auch die Standorte Ridgefield und St. Joseph in den USA sowie Wien in Österreich betrieben und außerdem die beiden kleineren Standorte Kobe in Japan und Mailand in Italien. Neben Kooperationen mit externen Unternehmen strebt Boehringer Ingelheim jedoch auch eine intensive Zusammenarbeit mit öffentlichen Forschungseinrichtungen an (vgl. Boehringer Ingelheim 2015, S. 53).
Im Forschungsbereich der Biopharmazeutika, speziell im Bereich der Diabetes-Biosimilars, besteht seit 2011 eine langfristige strategische Allianz zwischen Boehringer Ingelheim und dem US-amerikanischen Pharmakonzern „Eli Lilly and Company“. Der Spezialist für Insuline – Eli Lilly – verfügt über einen ähnlichen Erfahrungsschatz in der Biopharmazeutika-Forschung wie Boehringer Ingelheim und so wurde die erfolgreiche Zusammenarbeit durch die Zulassung des Insulin-Biosimilars „Glargin“ in der EU belohnt. Das Insulin „Glargin“ zur Behandlung von Typ-1- und Typ-2-Diabetes war Ende 2014 das erste Insulin-Biosimilar überhaupt, das in der EU zugelassen wurde und soll zeitnah auf den Markt kommen. In den USA wurde das Biosimilar vorläufig zugelassen (vgl. Boehringer Ingelheim 2015, S. 19). Die langfristig geplante Zusammenarbeit zur Entwicklung und auch Vermarktung von Diabetes-Biosimilars umfasst neben dem bereits zugelassenen Wirkstoff noch Weitere (vgl. Boehringer Ingelheim 2015, S. 71). Von der strategischen Allianz dieser beiden Pharmariesen versprechen sich die Partner also Synergieeffekte aus der jeweiligen Expertise, die die beiden Unternehmen mit in die Allianz einbringen. Außerdem soll die Marktabdeckung des europäischen und amerikanischen Biosimilarmarktes vereinfacht werden. Die erfolgreiche Zulassung des Insulin-Biosimilars bestätigt diesen Synergieeffekt und spricht für eine weitere Zusammenarbeit. Unsicherheiten und Risiken auf dem Biosimilarmarkt wurden hier auf zwei umsatzstarke Konzerne aufgeteilt.
Auch die „Merck KGaA“ setzt neben internem Wissen über Biosimilars aus Forschung und Entwicklung auf externe Partner. Mit dem indischen Arzneimittelhersteller „Dr. Reddy’s Laboratories Ltd.“, der sich auf Generika spezialisiert hat, wurde eine strategische Allianz zur kooperativen Entwicklung eines Portfolios und dessen Vermarktung im Bereich der Krebsforschung abgeschlossen (vgl. Merck 2015, S. 52 f.). Eine weitere strategische Allianz wurde Anfang 2014 mit dem brasilianischen Konzern „Bionovis SA“ zur Versorgung des brasilianischen Marktes mit Biosimilars vereinbart. Gerade auf dem lateinamerikanischen Markt verspricht sich Merck von der Zusammenarbeit mit Bionovis große Chancen. Neben diesen beiden Allianzen plant Merck noch die Einlizenzierung eines Biosimilars in einer fortgeschrittenen Phase der Entwicklung. Diese Einlizenzierung unterliegt aktuell jedoch noch der Geheimhaltung (vgl. Merck 2015, S. 125). Unter einer Einlizenzierung versteht man die Übernahme eines bereits patentierten Entwicklungsprojektes gegen Zahlung einer umsatzabhängigen Lizenzgebühr.
Im Gegensatz zu Boehringer Ingelheim arbeitet Merck bei der Entwicklung und dem Vertrieb von Biosimilars nicht mit anderen Branchenriesen zusammen, sondern mit den mittelgroßen Unternehmen „Dr. Reddy’s“ und „Bionovis“. Signifikante Effekte auf den Umsatz von Merck werden erst mittel- bis langfristig erwartet – klares Ziel der strategischen Allianzen ist jedoch neben einer dominanten Rolle auf dem europäischen und US-amerikanischen Biosimilarmarkt die Eroberung weiterer Absatzmärkte wie beispielsweise Lateinamerika (Brasilien) oder Indien (vgl. Merck 2015, S. 125).
Sandoz, die Tochter der „Novartis AG“, setzt bei der Entwicklung und Herstellung von Biosimilars nicht auf Kooperationen mit externen Unternehmen, sondern voll auf seine beiden Produktionsstandorte Kundl und Schaftenau in Österreich. Aufgrund der langjährigen Erfahrung im Bereich der Biopharmazeutika vertraut Sandoz auf interne Lösungen. Die beiden Standorte zur Entwicklung und Herstellung gelten innerhalb des Novartis Konzern als vielversprechende Kompetenzzentren. Um die Kompetenz auf einem sehr hohen Niveau zu halten und um die Entwicklung der Biosimilars weiter voranzutreiben, investiert Sandoz regelmäßig beträchtliche Summen in beide Standorte (vgl. Sandoz 2014, S. 7).
Das junge deutsche Unternehmen „amp biosimilars“ setzt auf Kooperationen mit chinesischen Partnern. Im Gegensatz zum Großkonzern „Merck“, der Entwicklungsprojekte für Biosimilars einlizenziert, betreibt amp biosimilars eine Auslizenzierung von Projekten. Hierbei werden Biosimilars bis zu einer frühen Phase im Zulassungsprozess intern entwickelt (vgl. Abbildung 3) und dann vorwiegend an mittelständische chinesische Partner zur weiteren Entwicklung abgegeben, da dort die Herstellung und Entwicklung deutlich günstiger ist. Amp biosimilars begleitet die Entwicklung ab hier lediglich. Die Lizenz erlaubt den strategischen Partnern die Vermarktung des jeweiligen Biosimilars in China. Das Ziel dahinter ist, eine führende Position auf dem noch kaum erschlossenen chinesischen Markt zu erreichen und dementsprechend hohe, erlösabhängige Lizenzeinnahmen – sogenannte Royalties – einzunehmen (vgl. amp biosimilars 2015, S. 1). Die erlösabhängigen Royalties sind Teil des Lizenzvertrages. Amp biosimilars rechnet hier mit Einnahmen im dreistelligen Millionen-Bereich in Euro (vgl. amp biosimilars 2015, S. 2). Während also die chinesischen Partner die Finanzierung der weiteren Entwicklung sowie die Zulassung für den chinesischen Markt übernehmen, bringt amp biosimilars Know-how, Koordination und die Schutzrechte mit in die Partnerschaft ein (vgl. GBC Investment Research 2015, S. 8). China gilt als zukünftig größter Biosimilarmarkt, deshalb werden Kooperationsparter von amp biosimilars zurzeit vorwiegend dort gesucht. Die weltweiten Produktrechte außerhalb Chinas bleiben zunächst bei amp biosimilars – das Unternehmen kann so noch andere Pharmakonzerne als Partner gewinnen und so zusätzliche Lizenzeinnahmen generieren (vgl. amp biosimilars 2015, S. 1). Ein großer Vorteil der Strategie, die Entwicklung der Biosimilars nur bis zu sehr frühen Phasen intern zu betreiben ist, neben der Beteiligung an den möglichen Erlösen, eine Senkung der finanziellen Risiken. In den frühen Entwicklungsphasen besteht noch ein vergleichsweise geringer Finanzierungsbedarf für die klassischen Forschungskosten und Personalaufwendungen und so werden die Risiken gut kalkulierbar (vgl. GBC Investment Research 2015, S. 8). Eine Verringerung der finanziellen Risiken stabilisiert ein junges und kleines Unternehmen und macht es für Investoren deutlich attraktiver.
Die „Formycon AG“ verfolgt als kleineres Unternehmen ebenfalls die Strategie der Auslizenzierung von Biosimilars in der Entwicklung. Als Partner für zwei von aktuell drei Projekten konnte Formycon die „Santo Holding GmbH“ gewinnen und damit die Finanzierung der Projekte bis zur Markteinführung sicherstellen (vgl. Formycon 2015a, S. 35 f.). Auch als Partner für das dritte Projekt laufen bereits vielversprechende Gespräche mit der Santo Holding. Inhalt der Auslizenzierung ist, dass Santo Holding die Finanzierung und Verantwortung für die gesamte Weiterentwicklung, Herstellung und auch Vermarktung für das Biosimilar von Formycon übernimmt. Dadurch sichert sich die Santo Holding die exklusiven Vermarktungsrechte für den globalen Markt und kann sich beispielsweise für den Vertrieb in bestimmten Regionen noch weitere Partner suchen. Formycon dagegen übernimmt die weitere Entwicklung des Biosimilars und erhält neben einer sofortigen Zahlung und einer laufenden Entwicklungsvergütung eine Umsatzbeteiligung ab der Vermarktung. Im Idealfall rechnet Formycon mit einem Profit aus der Partnerschaft, der im dreistelligen Millionen-Euro-Bereich liegt (vgl. Formycon 2015b).
Kooperationen und strategische Allianzen zwischen großen Unternehmen basieren also meist auf einer gemeinsamen Entwicklung und Vermarktung zur Minderung von Risiken und zur größeren Marktabdeckung. Kleine Unternehmen dagegen entwickeln Biosimilars bis zu den vergleichsweise günstigen frühen Phasen der Zulassung intern und streben dann eine Auslizenzierung an einen finanzstarken Konzern an. Somit sind sie für die riskanten und aufwendigen späteren Phasen abgesichert und haben ab der Vermarktung durch den Partner einen Anspruch auf Umsatzbeteiligungen.
Als kurze Zusammenfassung und zum besseren Überblick werden im nächsten Kapitel die gängigen Geschäftsmodelle des Biosimilarmarktes wie Lizenzierungen, Kooperationen oder Übernahmen noch einmal unabhängig von Unternehmen herausgearbeitet.
3.3.2 Geschäftsmodelle
Wie bereits an Unternehmensbeispielen verdeutlicht, ist eines der Geschäftsmodelle auf dem europäischen Biosimilarmarkt die Lizenzierung der Produkte. In diesem äußerst zeitintensiven Prozess werden vor der Übergabe von ersten sensiblen Daten Geheimhaltungsvereinbarungen getroffen, um das betroffene Know-how zu schützen. Wenn der Lizenznehmer nach einer ersten Prüfung des Projekts noch immer daran interessiert ist, kommt es zu einer Prüfung, die sämtliche relevanten Details beinhaltet. Hierbei werden unter anderem chemische Strukturen, Schutzrechte oder auch mögliche Risiken im Zulassungsprozess analysiert (vgl. Otto et al. 2010, S. 86). Damit das Risiko für den Lizenzgeber kalkulierbar bleibt, verlangt er von seinem potenziellen Partner meist ein vorläufiges, jedoch nicht bindendes Angebot für den Erwerb der Lizenz. Sind sich die Partner einig, so werden Vertragsverhandlungen aufgenommen: Je nachdem in welcher Phase sich das Biosimilar befindet, lässt sich der Lizenzgeber seine bisherigen Aufwendungen entsprechend höher vergüten. Bei Phase-I-Biosimilars sind Lizenzgebühren von ungefähr 10 % der späteren Einnahmen üblich, bei Phase-III-Biosimilars dagegen können diese bei bis zu 30 % liegen (vgl. Otto et al. 2010, S. 87). Hier spiegelt sich die Verteilung der zu tragenden Entwicklungsrisiken wider. Ob die Vermarktungsrechte für den Lizenznehmer global oder lediglich regional sind, ist Teil der Verhandlungen und spielt natürlich in die Höhe der Lizenzgebühren mit hinein.
Ein weiteres Geschäftsmodell ist die Kooperation zwischen Unternehmen, wie beispielsweise die zwischen „Boehringer Ingelheim“ und „Eli Lilly“. Hier entschließen sich zwei Unternehmen zur gemeinsamen Entwicklung eines Biosimilars und teilen sich die anschließende Vermarktung auf. Im Vordergrund dieser Kooperationen stehen die Aufteilung von Risiken und die besseren Entwicklungsmöglichkeiten und Synergieeffekte, die sich aus der Verknüpfung von Know-how ergeben. Außerdem können dadurch, dass unter anderem Marketing und Vertrieb gemeinsam erfolgen, Kosten eingespart werden (vgl. Otto et al. 2010, S. 90).
Die angesprochenen Kooperationen und Allianzen können zu einer Übernahme des einen Partners durch den anderen führen. Dies stellt zugleich das nächste Geschäftsmodell dar. Unternehmen wollen so die Effekte einer Kooperation noch weiter verstärken. Durch eine Übernahme wird die Projekt-Pipeline des Unternehmens vergrößert und somit das wirtschaftliche Risiko gesenkt. Wenn mehr Biosimilars in der Pipeline sind ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass wenigstens ein paar davon gewinnbringend vertrieben werden können. Des Weiteren wird das gesamte Know-how des übernommenen Unternehmens – inklusive Personal, Ressourcen und Schutzrechte – internalisiert und kann für die Entwicklung neuer Biosimilars genutzt werden (vgl. Otto et al. 2010, S. 92).
Nachdem nun die theoretischen Grundlagen von Kooperationen und strategischen Allianzen und aufbauend darauf die Akteure des europäischen Biosimilarmarktes näher betrachtet wurden, fasst der folgende abschließende Teil der Arbeit die wichtigsten Punkte der Arbeit noch einmal zusammen. Des Weiteren wird ein kurzer Ausblick gegeben.
4. Fazit und Ausblick
Im Rahmen dieser Arbeit wurde die Struktur des europäischen Biosimilarmarktes untersucht. Biosimilars, die Nachfolgeprodukte von biopharmazeutischen Medikamenten, deren Patente abgelaufen sind, sind ein wichtiger Markt innerhalb der Pharmabranche. Dieser Markt hat ein gewaltiges Wachstumspotenzial für die Zukunft. Dadurch, dass sie bei gleicher Wirkung, Qualität und Sicherheit günstiger als die Originalpräparate angeboten werden, tragen sie zu einer notwendigen Entlastung der europäischen Gesundheitssysteme bei. Ein besonders wichtiger Schritt war die Regulierung des europäischen Biosimilarmarktes durch die EMA, als die ersten Patente der Originalpräparate abgelaufen waren. So waren die Rahmenbedingen gleich weitestgehend abgesteckt. Die interessierten Unternehmen konnten mit der Forschung beginnen und die Patienten konnten sich der Sicherheit und gleichen Wirkung der neuen Präparate gewiss sein. Außerdem wurde der Markt durch die Regulierung der EMA vor billigen und qualitativ fragwürdigen Biosimilars geschützt. Die Anbieter der hochwertigen Biosimilars mussten so keine Dumpingpreise fürchten.
Es wurde ersichtlich, dass zwischen den Unternehmen keine Einigkeit besteht, ob sie den Biosimilarmarkt betreten sollen oder nicht. Manche Unternehmen stellen sich den Unsicherheiten und Risiken des noch jungen europäischen Biosimilarmarktes und begeben sich zum Teil auf die Suche nach einem passenden Partner für eine strategische Allianz. Diese strategischen Allianzen dienen der Aufteilung und Senkung von beispielsweise finanziellen Risiken, der schnelleren Marktabdeckung und der effektiveren Forschung und Entwicklung. Es gibt jedoch keine Garantie, dass die gesteckten Ziele mit einer strategischen Allianz auch erreicht werden. Andere Unternehmen dagegen lehnen den Einstieg in den Biosimilarmarkt ab. Sie scheuen die Risiken und konzentrieren sich weiterhin auf ihre Kernkompetenzen, um sich mit Innovationen zu profilieren.
Bei einigen großen und erfahrenen Konzernen aus der Pharmabranche ist eine Art „Schaffenskrise“ mit ein Grund dafür, weshalb sie sich auf den Biosimilarmarkt wagen. Viele Konzerne sind nicht mehr so innovativ wie noch vor ein paar Jahren – ihre Innovationspipeline ist erschöpft. In diesem Fall ist es durchaus sinnvoll, den Biosimilarmarkt zu betreten, denn das prognostizierte Wachstum des Marktes ist beeindruckend. Da auch immer mehr Patente von sogenannten Blockbuster-Medikamenten ablaufen, gibt es auch immer mehr potenzielle Präparate, die imitiert und als Biosimilar vertrieben werden können.
Falls ein Konzern sich jedoch sicher ist, dass seine Pipeline voller potenzieller Verkaufsschlager ist, die einen zufriedenstellenden Gewinn in den kommenden Jahren sicherstellen, dann ist ein Einstieg in den Biosimilarmarkt nicht zwingend notwendig. Diese Unternehmen konzentrieren sich auf ihre Kernkompetenz – die Forschung und Entwicklung neuer Medikamente gegen Krankheiten, die bis jetzt noch nicht zu bekämpfen sind. Somit will man sich als Innovator profilieren und das eigene Image stärken. Ein weiteres, gewichtiges Argument dieser Konzerne sind die enormen Kosten, die mit der Zulassung eines Biosimilars verbunden sind. Da im Gegensatz zu den Generika der traditionellen Pillen mehrere klinische Studien durchgeführt werden müssen, liegen die Kosten für die Zulassung im dreistelligen Millionen-Euro-Bereich. Sollte die Zulassung für das Biosimilar am Ende von der EMA verwehrt werden, hätte das Unternehmen viel Geld verloren. Ein weiterer Grund, der gegen einen Einstieg spricht, ist die große Konkurrenz. Wenn ein Patent für ein Biopharmazeutikum abgelaufen ist, darf jedes Unternehmen an einem potenziellen Biosimilar dafür forschen und dies ist auch der Fall. Ist ein Unternehmen mit der Fertigstellung eines Biosimilars also etwas zu spät, so kann es sein, dass die Marktanteile schon vergeben sind. Da der Markt der Biopharmazeutika insgesamt vor einer erfolgreichen Zukunft steht, ist es also auch möglich, gute Gewinne zu erzielen, ohne in den Biosimilarmarkt einzusteigen. Vorausgesetzt das Unternehmen besitzt Patente für innovative Medikamente, die im Endeffekt auch von der EMA zugelassen werden.
In den nächsten Jahren wird deutlich werden, ob die Strategie des Einstiegs auf den Biosimilarmarkt oder die des Nicht-Einstiegs für erfahrene Konzerne der Pharmabranche die erfolgreichere war. Die prognostizierten Wachstumszahlen und die Menge an Originalpräparaten, die ihre Patente bis 2020 verlieren werden, lassen – aktuell jedenfalls – vermuten, dass die Strategie des Einstiegs in den Biosimilarmarkt die vielversprechendere ist.
Neben den Großkonzernen, die insgesamt geteilter Meinung über die Lukrativität eines Einstiegs in den europäischen Biosimilarmarkt sind, gibt es viele kleine und junge Unternehmen, die am Markt partizipieren wollen. Diese Unternehmen verfolgen zum Teil eine äußerst vielversprechende Strategie, die gleichzeitig das Risiko begrenzt. Hierbei führen sie die Entwicklung eines neuen Biosimilars bis zu einer sehr frühen Phase intern durch. Die finanziellen Aufwendungen sind hier vergleichsweise noch niedrig und dementsprechend ist das eingegangene Risiko auch kalkulierbar. Bevor dann die finanziellen Aufwendungen im Entwicklungsprozess stark ansteigen, lizenzieren die Unternehmen das jeweilige Projekt an einen Kooperationspartner aus. Dieser entschädigt die Unternehmen dann für ihre bisherigen Aufwendungen, sichert die Finanzierung der weiteren Entwicklung und zahlt später Royalties – also eine Beteiligung an den Erlösen, sobald das Biosimilar auf dem Markt ist.
Diese Arbeit hatte das Ziel, die Strukturen des europäischen Biosimilarmarktes zu untersuchen. Hierfür wurden einige Akteure des Marktes und deren Verhalten und Umgang mit Unsicherheit und Risiken untersucht. Im Rahmen dieser Arbeit konnten jedoch bei weitem nicht alle Akteure des Marktes untersucht werden. Die anderen Akteure und deren jeweilige Strategien müssen also noch untersucht werden.
Außerdem müssen neben dem europäischen Biosimilarmarkt auch noch weitere potenzielle Märkte untersucht werden. Der europäische Markt wurde bereits von der EMA reguliert, der US-amerikanische Markt wird derzeit von der FDA reguliert. Spannend und wichtig ist die Frage, ob und wie beispielsweise der lateinamerikanische oder der asiatische Biosimilarmarkt reguliert werden. Auch in Afrika besteht ein immenser Bedarf an vergleichsweise günstigen biopharmazeutischen Arzneimitteln. Vor diesem Hintergrund besteht also noch ein weiterer Forschungsbedarf für die Entwicklungen auf den weltweiten Biosimilarmärkten und eine Analyse der jeweiligen Wachstumschancen.
Literaturverzeichnis
Albring, M (2008). Biosimilars – das Leben lässt sich nicht kopieren, Ärzte Zeitung online, Neu-Isenburg. http://www.aerztezeitung.de/politik_gesellschaft/arzneimittelpolitik/ article/526892/biosimilars-leben-laesst-nicht-kopieren.html (29.07.2015).
Amp biosimilars AG (2015). Zweites Biosimilar-Produkt erfolgreich auslizenziert, amp biosimilars AG, Hamburg.
Blackstone, A. und Fuhr, J. (2013). The Economics of Biosimilars, American Health & Drug Benefits, Vol. 6(8), S. 469-477.
Blasius, H. (2015). Erste Biosimilar-Zulassung erteilt, Deutsche Apotheker Zeitung, Stuttgart. http://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/pharmazie/news/2015/03/10/erste-biosimilar-zulassung-erteilt/15255.html (16.08.2015).
Boehringer Ingelheim GmbH (2015). Unterschiede leben – Unternehmensbericht 2014, Boehringer Ingelheim GmbH, Ingelheim.
Böll, S. (2009). Pharmaindustrie: In Auflösung, manager magazin new media GmbH, Hamburg. http://www.manager-magazin.de/magazin/artikel/a-644133.html (11.08.2015).
Dosi, G. (1982). Technological paradigms and technological trajectories: a suggested interpretation of the determinants and directions of technical change, Research Policy, Vol. 11(3), S. 147-162.
Etter, C. (2003). Nachgründungsdynamik neugegründeter Unternehmen in Berlin im interregionalen Vergleich. Dissertation, Freie Universität Berlin.
Europäische Kommission (2013). Was Sie über Biosimilar-Arzneimittel wissen sollten – Konsensinformationsblatt, Europäische Kommission, Brüssel.
European Medicines Agency (2015). EMA Procedural advice for users of the Centralised Procedure for Similar Biological Medicinal Products applications, European Medicines Agency, London.
Formycon AG (2015a). Geschäftsbericht 2014, Formycon AG, Martinsried.
Formycon AG (2015b). Formycon AG unterzeichnet Lizenzvereinbarung für das Biosimilar FYB203, Formycon AG, Martinsried. http://www.formycon.com/presse-news/pressemitteilungen/pressemitteilung/?tx_ttnews[tt_news]=91&cHash=7fe7d334a86187c07fd0ef4a09fff244 (18.08.2015).
Friese, M. (1998). Kooperation als Wettbewerbsstrategie für Dienstleistungsunternehmen, Wiesbaden: Deutscher Universitätsverlag.
GBC Investment Research AG (2015). Researchstudie amp biosimilars ag, GBC Investment Research AG, Augsburg.
Häussler, C. (2004). Kooperationen bei deutschen Biotechnologieunternehmen. Projektbericht Oktober 2004. Institut für Innovationsforschung, Technologiemanagement und Entrepreneurship und ODEON Center for Entrepreneurship, Ludwig-Maximilians-Universität München.
Haustein, R./de Millas, C./Höer, A./Häussler, B. (2012). Saving money in the European healthcare systems with biosimilars, Generics and Biosimilars Initiative Journal, Vol. 1(3-4), S. 120-126.
Kaufmann, A. und Tödtling, F. (2001). Science – industry interaction in the process of innovation: the importance of boundary-crossing between systems, Research Policy, Vol. 30(5), S. 791-804.
Laschet, H. (2008). Biosimilars dämpfen das Wachstum, Ärzte Zeitung online, Neu-Isenburg. http://www.aerztezeitung.de/politik_gesellschaft/arzneimittelpolitik/article/526893/biosimilars-daempfen-wachstum.html (07.08.2015).
Lücke, J./Bädeker, M./Hildinger, M. (2014). Medizinische Biotechnologie in Deutschland 2014, The Boston Consulting Group, München.
Merck KGaA (2015). Geschäftsbericht 2014 – Wachstum ermöglichen, Merck KGaA, Darmstadt.
Moeller, K. (2010). Partner selection, partner behavior, and business network performance, Journal of Accounting & Organizational Change, Vol. 6(1), S. 27-51.
Nieschlag, R./Dichtl, E./Hörschgen, H. (1997). Marketing, 18. Auflage, Berlin: Duncker & Humblot.
Novartis AG (2015). Geschäftsbericht 2014, Novartis AG, Basel.
Olesch, G. (1995). Kooperation, in: Handwörterbuch des Marketing, 2. Auflage, Stuttgart: Schäffer-Poeschel Verlag, S. 1273-1284.
Otto, R./Dreesmann, L./Mühlenbeck, F./Müller, C. (2010). Einführung in die kommerzielle Biotechnologie, 3. Auflage, Stuttgart: Steinbeis-Edition.
Park, S und Ungson, G. (2001). Interfirm Rivalry and Managerial Complexity: A Conceptual Framework of Alliance Failure, Organization Science, Vol. 12(1), S. 37-53.
Pausenberger, E. (1989). Zur Systematik von Unternehmenszusammenschlüssen, WISU – Das Wirtschaftsstudium, Vol. 18(11), S. 621-626.
Pharmaceutical Executive (2014). Pharm Exec’s Pharma Top 50 in Brief, Pharmaceutical Executive, New York. http://www.pharmexec.com/pharm-exec-s-pharma-top-50-brief (05.08.2015).
Pro Generika e.V.: Dingermann, T./Fischaleck, J./Zündorf, I. (2014a). Biosimilars – Ein Handbuch, Pro Generika e.V., Berlin.
Pro Generika e.V. (2014b). Faktenbuch Biosimilars, Pro Generika e.V., Berlin.
Pröbstl, G. (2014). Biosimilars – der grosse Schub steht erst bevor, Handelszeitung, Axel Springer Schweiz AG, Zürich. http://www.handelszeitung.ch/invest/stocksDIGITAL/
biosimilars-der-grosse-schub-steht-erst-bevor-701028 (19.08.2015).
Rammer, C. (2002). Patente und Marken als Schutzmechanismen für Innovationen, Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung, Mannheim.
Roche AG (2014). Roche Position on Similar Biological Medicinal Products, Roche AG, Basel.
Roche AG (2015). Geschäftsbericht 2014, Roche AG, Basel.
Sandoz GmbH (2013). Sandoz – weltweit führend bei Biosimilars, Sandoz GmbH, Kundl.
Sandoz GmbH (2014). Nachhaltigkeitsbericht 2014 mit integrierter Umwelterklärung, Sandoz GmbH, Kundl.
Smolka, K. (2015). Biotechkopien elektrisieren die Pharmabranche, Frankfurter Allgemeine Zeitung (18.06.2015), S. 26.
Spekman, R./Kamauff, J./Myhr, N. (1998). An empirical investigation into supply chain management, International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, Vol. 28(8), S. 630-650.
Statista GmbH (2010). Anteil der Ausgaben für F&E am Umsatz in ausgewählten Branchen im Jahr 2009, Statista GmbH, Hamburg. http://de.statista.com/statistik/daten/studie/ 175464/umfrage/anteil-der-ausgaben-fuer-f-e-am-umsatz-in-ausgewaehlten-branchen/ (07.08.2015).
Sucker-Sket, K. (2015). Biopharmazeutika im Aufwind, Deutsche Apotheker Zeitung, Stuttgart. http://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/wirtschaft/news/2015/06/26/ biopharmazeutika/16120.html (10.08.2015).
Sydow, J. (1992). Strategische Netzwerke – Evolution und Organisation, Wiesbaden: Gabler Verlag.
Verband forschender Arzneimittelhersteller e.V. (2010). Biopharmazeutika – Hightech im Dienst der Patienten, Verband forschender Arzneimittelhersteller e.V., Berlin.
Verband forschender Arzneimittelhersteller e.V. (2014). Biopharmazeutika auf Wachstumskurs durch Therapieoptionen für Patienten mit Krebs und Immunkrankheiten, Verband forschender Arzneimittelhersteller e.V., Berlin.
Verband forschender Arzneimittelhersteller e.V. (2015). Originalpräparate und Biosimilars (zugelassen in der EU), Verband forschender Arzneimittelhersteller e.V., Berlin.
Walter, E. (2012). Pharmaökonomische Aspekte von Biosimilars, Pharmazie in unserer Zeit, Vol. 41(6), S. 485-491.
Wöhe, G. (1996). Einführung in die Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, München: Vahlen Verlag.
Häufig gestellte Fragen
Was sind biopharmazeutische Arzneimittel und wie unterscheiden sie sich von herkömmlichen Medikamenten?
Biopharmazeutische Arzneimittel unterscheiden sich von herkömmlichen, kleinmolekularen Medikamenten hauptsächlich in ihrer Größe und Komplexität. Sie werden in lebenden Systemen (z.B. Mikroorganismen oder tierischen Zellen) hergestellt, während herkömmliche Arzneimittel meist durch chemische Prozesse entstehen. Biopharmazeutika bekämpfen oft die Ursache von Krankheiten, während kleinmolekulare Medikamente eher Symptome lindern.
Was sind Biosimilars?
Biosimilars sind Nachahmerprodukte von Biopharmazeutika, deren Patentschutz abgelaufen ist. Im Gegensatz zu Generika von chemisch hergestellten Medikamenten sind Biosimilars keine exakten Kopien, sondern lediglich ähnlich, da ihre hochkomplexe Struktur nicht vollständig nachgebildet werden kann. Sie müssen aber in Bezug auf Anwendung, Wirksamkeit und Sicherheit mit dem Referenzprodukt vergleichbar sein.
Wie erfolgt die Zulassung von Biosimilars in Europa?
Die Zulassung von Biosimilars erfolgt durch die Europäische Arzneimittelagentur (EMA). Der Prozess umfasst den Nachweis der chemischen und biologischen Vergleichbarkeit mit dem Referenzprodukt, präklinische Studien und klinische Tests zur Sicherheit und Verträglichkeit. Die Anforderungen für die Zulassung sind streng, und es muss ein Vorteil für Patienten oder eine finanzielle Erleichterung für die Krankenkassen nachgewiesen werden.
Welche gesundheitlichen Risiken sind mit Biosimilars verbunden?
Biopharmazeutische Medikamente, einschließlich Biosimilars, können Immunreaktionen auslösen, da sie vom Immunsystem erkannt werden. Diese Reaktionen sind selten, können aber gravierende Auswirkungen haben. Daher sind umfassende Tests auf Qualität, Wirksamkeit und Sicherheit vor der Zulassung entscheidend.
Was sind die Strukturen und Eigenschaften des europäischen Biosimilarmarktes?
Der europäische Biosimilarmarkt ist noch jung, weist aber ein hohes Wachstumspotenzial auf. Er ist durch ein Zusammenspiel von etablierten Pharmaunternehmen und innovativen Start-ups gekennzeichnet. Die Einsparungsmöglichkeiten durch Biosimilars sind zwar geringer als bei Generika, tragen aber zur Entlastung der Gesundheitssysteme bei. Die EU nimmt eine Vorreiterrolle auf dem Gebiet der Biosimilars ein.
Welche Chancen bietet der europäische Biosimilarmarkt?
Der Biosimilarmarkt bietet die Chance, Kosten im Gesundheitswesen zu senken und die Versorgung von Patienten zu verbessern. Er bietet außerdem Unternehmen die Möglichkeit, sich in einem wachstumsstarken Markt zu positionieren und neue Geschäftsfelder zu erschließen. Für Pharmaunternehmen in einer Schaffenskrise kann der Biosimilarmarkt eine Chance zur Neupositionierung darstellen.
Welche Marktbarrieren gibt es für Biosimilars?
Zu den größten Markteintrittsbarrieren gehören die hochkomplexe Herstellung, die aufwendige Zulassung, Schwierigkeiten bei der Gewinnung von Patienten für klinische Tests und die Unsicherheit aufgrund des Wettbewerbs mit anderen Biosimilars. Unternehmen müssen außerdem Risiken im Zusammenhang mit unerwünschten Immunreaktionen berücksichtigen.
Welche Rolle spielen Kooperationen und strategische Allianzen im Biosimilarmarkt?
Kooperationen und strategische Allianzen sind im Biosimilarmarkt üblich, um Risiken zu teilen, Know-how zu bündeln und die Marktabdeckung zu verbessern. Kleine Unternehmen nutzen oft Auslizenzierungen, um die Finanzierung der Weiterentwicklung zu sichern und an den Umsätzen zu partizipieren.
Welche Geschäftsmodelle sind im Biosimilarmarkt verbreitet?
Zu den gängigen Geschäftsmodellen gehören die Lizenzierung von Produkten, Kooperationen zwischen Unternehmen zur gemeinsamen Entwicklung und Vermarktung sowie Übernahmen von Unternehmen, um Effekte zu verstärken und Know-how zu internalisieren.
Wie gehen die Marktakteure mit der Unsicherheit des europäischen Biosimilarmarktes um?
Einige Unternehmen gehen strategische Allianzen ein, um Risiken zu senken und Expertise zu teilen. Andere konzentrieren sich auf ihre Kernkompetenzen und meiden den Biosimilarmarkt aufgrund der hohen Risiken und Kosten. Kleine Unternehmen setzen oft auf Auslizenzierung von Projekten in frühen Phasen, um Risiken zu minimieren und von Umsatzbeteiligungen zu profitieren.
Details
- Titel
- Die Struktur des europäischen Biosimilarmarktes
- Hochschule
- Universität Hohenheim
- Note
- 1,7
- Autor
- Michael Schuler (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2015
- Seiten
- 44
- Katalognummer
- V315727
- ISBN (eBook)
- 9783668153363
- ISBN (Buch)
- 9783668153370
- Dateigröße
- 1067 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- struktur biosimilarmarktes
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 0,99
- Preis (Book)
- US$ 28,99
- Arbeit zitieren
- Michael Schuler (Autor:in), 2015, Die Struktur des europäischen Biosimilarmarktes, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/315727
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-