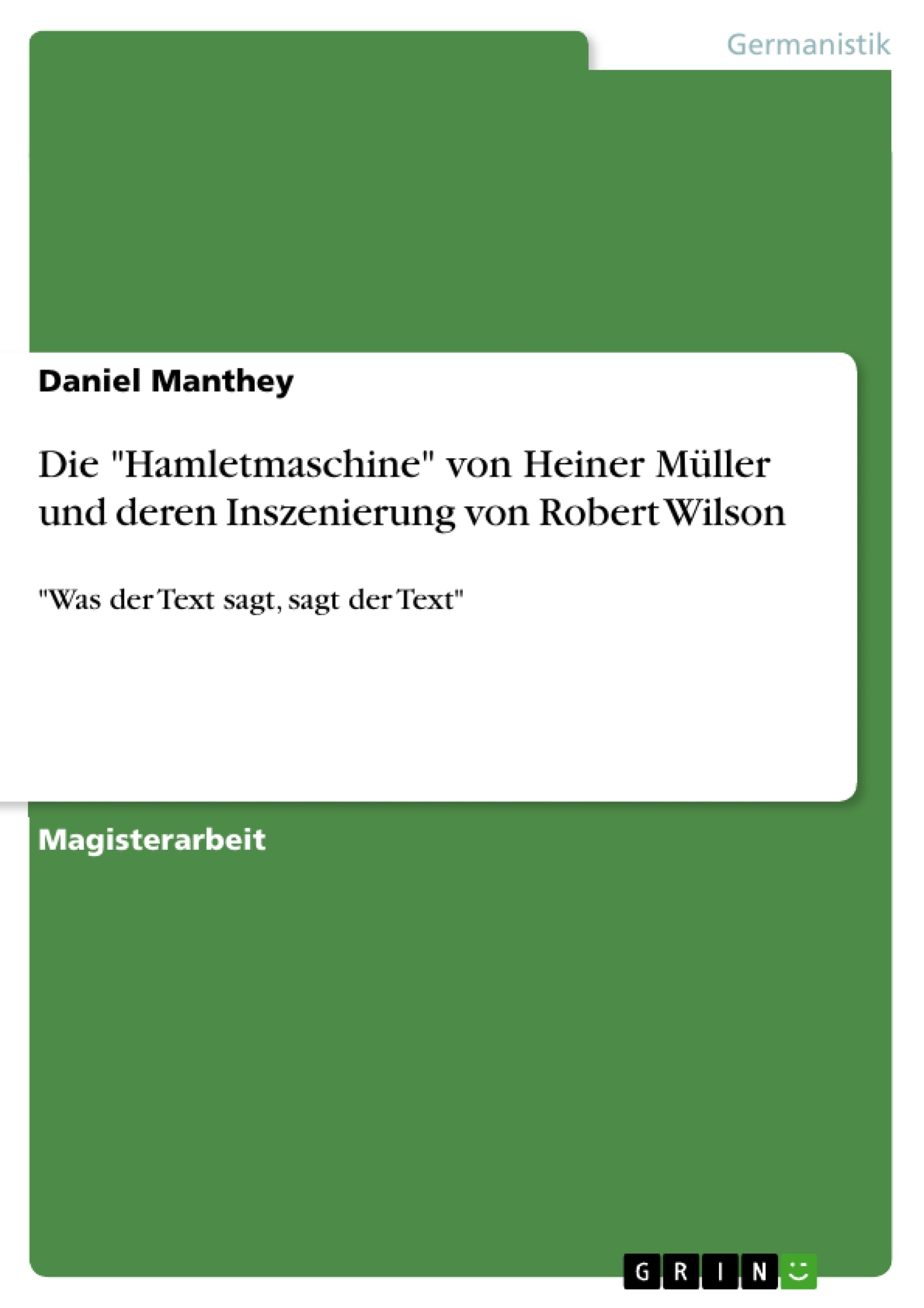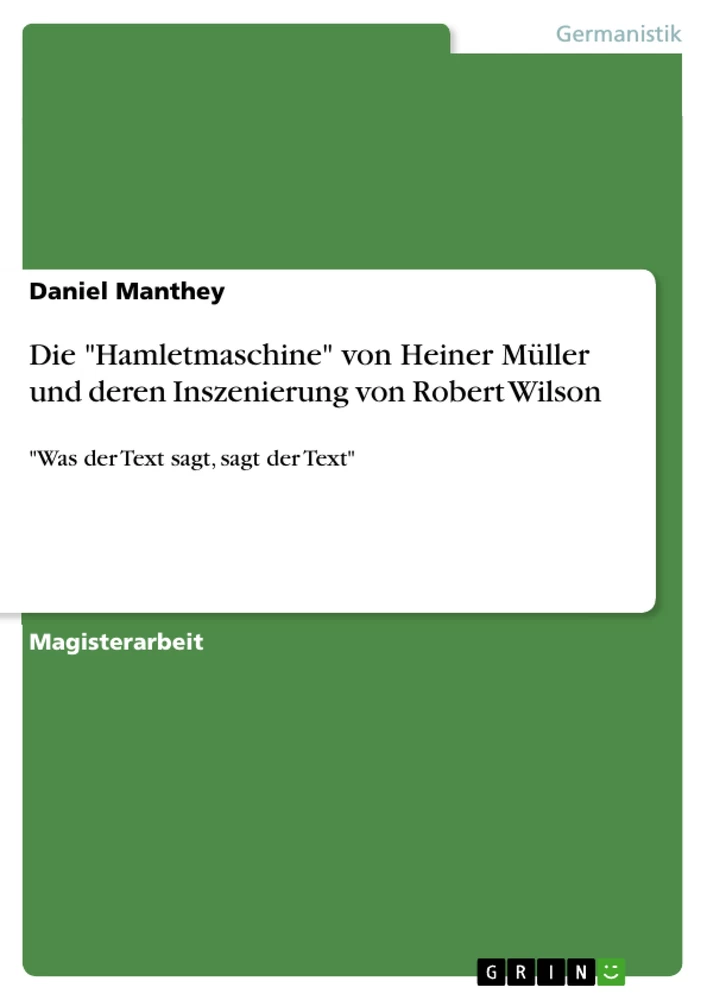
Die "Hamletmaschine" von Heiner Müller und deren Inszenierung von Robert Wilson
Magisterarbeit, 1999
166 Seiten, Note: 1,0
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Der Text
- II.1 Vorbemerkungen zu Heiner Müllers Theaterkonzeption
- II.1.1 Interpretierbarkeit der HAMLETMASCHINE
- II.1.2 „Emanzipieren vom diktierten Ergötzen“
- II.1.3 „Vom Welterretter zum Apokalyptiker“: Heiner Müllers Reaktion auf die Stagnation der DDR-Politik
- II.2 Interpretation
- II.2.1 „Hamlet“: Müllers Zerstörung eines Klassikers
- II.2.2 Fragmentarische Form, Monologe und Metaphern
- II.2.3 Szene 1: „FAMILIENALBUM“
- II.2.4 Szene 2: „DAS EUROPA DER FRAU“
- II.2.5 Exkurs 1: Zur Geschlechterdifferenz bei Heiner Müller
- II.2.6 Szene 3: „SCHERZO“
- II.2.7 Exkurs 2: Anmerkungen zum Geschichtsbild Heiner Müllers
- II.2.8 Szene 4: „PEST IN BUDA SCHLACHT UM GRÖNLAND“
- II.2.9 Szene 5: „WILDHARREND/IN DER FURCHTBAREN RÜSTUNG/JAHRTAUSENDE“
- II.2.10 Exkurs 3: „DAMIT ETWAS KOMMT MUSS ETWAS GEHEN“
- II.2.11 „Das Denkmal liegt am Boden“
- II.1 Vorbemerkungen zu Heiner Müllers Theaterkonzeption
- III. Die Hamburger Inszenierung von Robert Wilson
- III.1 Weder Sozialistischer noch Psychologischer Realismus
- III.2 Exkurs: Robert Wilsons „theatre of visions“
- III.2.1 Robert Wilson und traditionelles Theater
- III.2.2 Die Bühne in Wilsons Bildertheater
- III.2.3 Wilsons Lichtgestaltung
- III.2.4 Kombination Hören und Sehen
- III.2.5 Die Zuschauer
- III.2.6 Die Schauspieler
- III.2.7 Text und Sprache, Inhalt und Illustration
- III.2.8 Die Zeit
- III.2.9 Medien und Motive
- III.2.10 Hermeneutik der Sinne
- III.3 Eine texanisch-sächsische Kollaboration
- III.4 Wilsons Arbeitsweise am Beispiel HAMLETMASCHINE
- III.5 Visuelle und sonore Parallelwelten
- III.6 „Hohle Bombastik der Metaphern“ oder „theatrical masterpiece“: Wilsons Inszenierung in der Kritik
- III.7 Mehr als nur ergänzende Teile
- IV. Fazit: „Interpretation violates art“
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Zusammenarbeit zwischen Heiner Müller und Robert Wilson bei der Inszenierung der „Hamletmaschine“. Ziel ist es, die spezifischen Herausforderungen und Erfolge dieser ungewöhnlichen Kooperation zu analysieren, indem der Text von Müllers Stück und die Inszenierung Wilsons im Kontext der jeweiligen künstlerischen Konzeptionen betrachtet werden. Die Arbeit beleuchtet auch den Einfluss des historischen und politischen Umfelds auf Müllers Werk.
- Heiner Müllers Theaterkonzeption und seine Interpretation von Hamlet
- Die spezifischen Merkmale von Müllers „Hamletmaschine“ (z.B. Fragmentarität, Monologe, Metaphern)
- Robert Wilsons „theatre of visions“ und seine Inszenierungsmethoden
- Der Kontrast zwischen Müllers historisch-politischem Kontext und Wilsons amerikanischer Perspektive
- Die Rezeption der Inszenierung in der Kritik
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Einleitung stellt die ungewöhnliche Zusammenarbeit zwischen Heiner Müller und Robert Wilson bei der Inszenierung der „Hamletmaschine“ vor und hebt die gegensätzlichen Hintergründe und künstlerischen Ansätze beider Künstler hervor. Sie deutet auf die Komplexität des Textes und die Herausforderungen seiner Interpretation hin und skizziert den methodischen Ansatz der Arbeit.
II. Der Text: Dieses Kapitel bietet eine tiefgehende Analyse des Textes der „Hamletmaschine“. Es untersucht Müllers Theaterkonzeption, die Herausforderungen der Interpretierbarkeit des Textes und den Einfluss des politischen und historischen Kontextes der DDR auf Müllers Werk. Der Hauptteil des Kapitels widmet sich einer detaillierten Interpretation der einzelnen Szenen des Stückes, wobei die fragmentarische Struktur, die Monologe und die Metaphern im Mittelpunkt stehen. Exkurse beleuchten die Geschlechterdifferenz in Müllers Werk und sein Geschichtsbild.
III. Die Hamburger Inszenierung von Robert Wilson: Dieses Kapitel analysiert Robert Wilsons Inszenierung der „Hamletmaschine“ in Hamburg. Es vergleicht Wilsons Ansatz mit dem traditionellen Theater und untersucht seine „theatre of visions“, seine Arbeitsweise und die spezifischen visuellen und auditiven Elemente seiner Inszenierung. Die Rezeption der Inszenierung durch die Kritik wird ebenfalls beleuchtet, wobei die unterschiedlichen Perspektiven und Interpretationen der Aufführung im Vordergrund stehen.
Schlüsselwörter
Heiner Müller, Robert Wilson, Hamletmaschine, Theater, Inszenierung, Interpretation, DDR, Geschichtsbild, Geschlechterdifferenz, politischer Kontext, visuelles Theater, fragmentarische Form, Monolog, Metapher.
Häufig gestellte Fragen zur Hamletmaschine von Heiner Müller und Robert Wilson
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Zusammenarbeit zwischen dem Dramatiker Heiner Müller und dem Regisseur Robert Wilson bei der Inszenierung der „Hamletmaschine“. Sie untersucht die spezifischen Herausforderungen und Erfolge dieser ungewöhnlichen Kooperation, indem der Text des Stücks und die Inszenierung im Kontext der jeweiligen künstlerischen Konzeptionen betrachtet werden. Der Einfluss des historischen und politischen Umfelds auf Müllers Werk wird ebenfalls beleuchtet.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Heiner Müllers Theaterkonzeption und seine Interpretation von Hamlet; die spezifischen Merkmale der „Hamletmaschine“ (Fragmentarität, Monologe, Metaphern); Robert Wilsons „theatre of visions“ und seine Inszenierungsmethoden; den Kontrast zwischen Müllers historisch-politischem Kontext und Wilsons amerikanischer Perspektive; und die Rezeption der Inszenierung in der Kritik.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in vier Kapitel: Eine Einleitung, die die Zusammenarbeit zwischen Müller und Wilson vorstellt und den methodischen Ansatz der Arbeit skizziert; ein Kapitel zur detaillierten Textanalyse der „Hamletmaschine“, einschließlich Interpretation der einzelnen Szenen und Exkurse zu Müllers Geschichtsbild und der Geschlechterdifferenz in seinem Werk; ein Kapitel zur Analyse von Wilsons Inszenierung in Hamburg, einschließlich einer Betrachtung seines „theatre of visions“ und der Rezeption der Inszenierung; und abschließend ein Fazit.
Welche Aspekte von Heiner Müllers „Hamletmaschine“ werden analysiert?
Die Analyse von Müllers „Hamletmaschine“ konzentriert sich auf Müllers Theaterkonzeption, die Interpretierbarkeit des Textes, den Einfluss des politischen und historischen Kontextes der DDR, die fragmentarische Struktur, die Monologe und die Metaphern des Stücks. Die einzelnen Szenen werden detailliert interpretiert.
Wie wird Robert Wilsons Inszenierung beschrieben und analysiert?
Die Arbeit analysiert Wilsons Inszenierung im Kontext seines „theatre of visions“, seiner Arbeitsweise und der spezifischen visuellen und auditiven Elemente. Es wird ein Vergleich zu traditionellen Theaterformen gezogen und die Rezeption der Inszenierung in der Kritik beleuchtet.
Welche Rolle spielt der historische und politische Kontext?
Der historische und politische Kontext, insbesondere die Situation in der DDR, spielt eine wichtige Rolle bei der Analyse von Müllers Werk und seiner „Hamletmaschine“. Der Kontrast zu Wilsons amerikanischer Perspektive wird ebenfalls thematisiert.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Heiner Müller, Robert Wilson, Hamletmaschine, Theater, Inszenierung, Interpretation, DDR, Geschichtsbild, Geschlechterdifferenz, politischer Kontext, visuelles Theater, fragmentarische Form, Monolog, Metapher.
Details
- Titel
- Die "Hamletmaschine" von Heiner Müller und deren Inszenierung von Robert Wilson
- Untertitel
- "Was der Text sagt, sagt der Text"
- Hochschule
- Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover (Seminar für deutsche Sprache und Literatur)
- Note
- 1,0
- Autor
- Daniel Manthey (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 1999
- Seiten
- 166
- Katalognummer
- V31626
- ISBN (eBook)
- 9783638325615
- ISBN (Buch)
- 9783638901857
- Dateigröße
- 978 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Text Heiner Müller Robert Wilson Text Inszenierung Hamletmaschine
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 41,99
- Preis (Book)
- US$ 54,99
- Arbeit zitieren
- Daniel Manthey (Autor:in), 1999, Die "Hamletmaschine" von Heiner Müller und deren Inszenierung von Robert Wilson, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/31626
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-