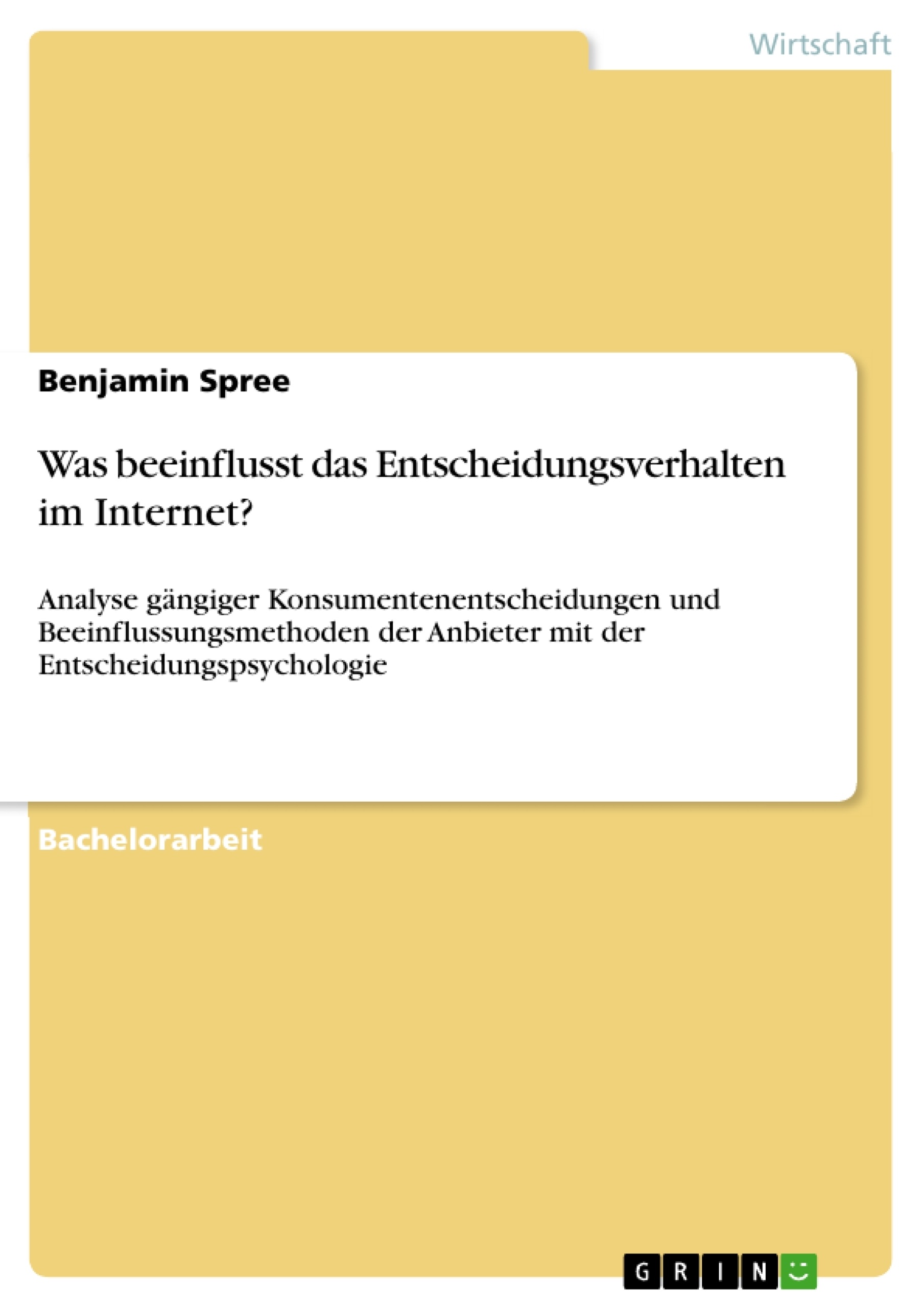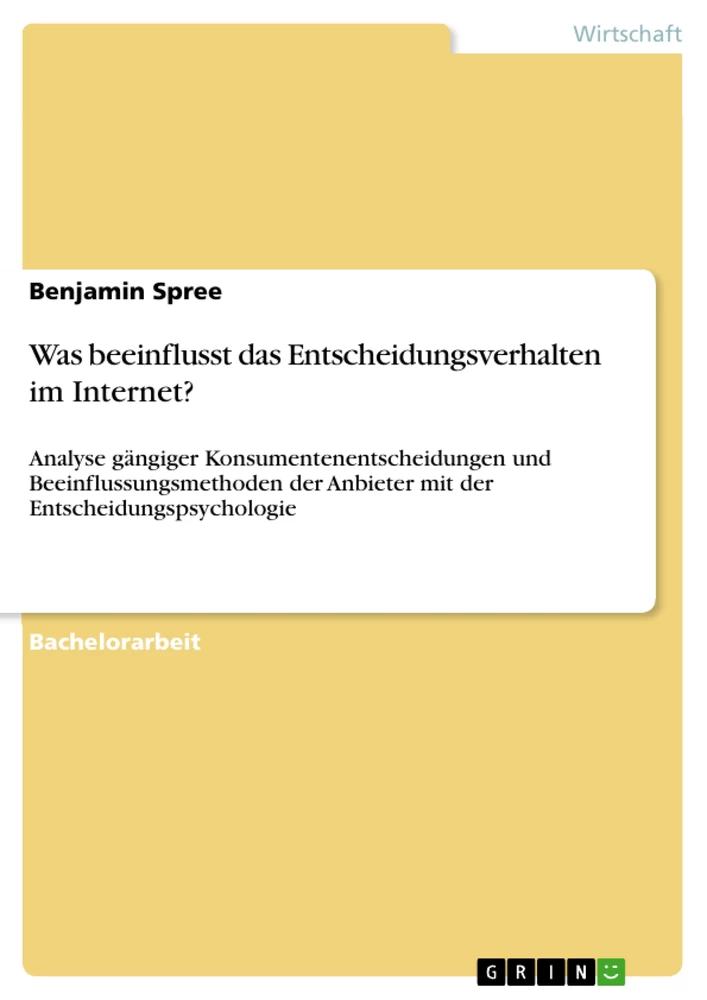
Was beeinflusst das Entscheidungsverhalten im Internet?
Bachelorarbeit, 2016
56 Seiten, Note: 1,6
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Einführung in die Entscheidungspsychologie
- Der Begriff der Entscheidung
- Struktur von Entscheidungen
- Entscheidungstypen
- Routinierte Entscheidungen
- Stereotype Entscheidungen
- Reflektierte Entscheidungen
- Konstruktive Entscheidungen
- Zwei-Systeme Theorie der Verhaltenssteuerung nach Kahneman
- Rahmenmodell für den Prozess des Entscheidens
- Die selektionale Phase: Bewertung und Entscheidung
- Die präselektionale Phase: Informationssuche als Teilprozess des Entscheidens
- Die postselektionale Phase: Effekte von Entscheidungen, Lernen und wiederholte Entscheidungen
- Einflussfaktoren auf Konsumentenentscheidungen im Internet
- Einfluss des Website-Designs
- Einfluss von Vertrauen
- Einfluss von Kundenbewertungen
- Glaubwürdigkeit
- Nützlichkeit
- Einfluss von Ankereffekten: Down-Selling, Up-selling und der Kompromisseffekt
- Dark Patterns
- Design Patterns
- Versteckte Zustimmung und Trick-Fragen
- Roach-Motel (Kakerlaken-Motel)
- Versteckte Kosten
- Bait and Switch
- Geschäftsmodelle
- Sponsored Content und getarnte Werbung
- Verschleiern der Wirklichkeit - Tokens statt Geld
- Penny-Bidding Sites
- Design Patterns
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Entscheidungsverhalten von Menschen im Internet. Ziel ist es, die wichtigsten Einflussfaktoren auf das Entscheidungsverhalten im digitalen Raum zu identifizieren und zu analysieren. Dabei wird der Fokus auf Konsumentenentscheidungen im Online-Shopping gelegt, um den Aspekt der Wirtschaftspsychologie zu beleuchten.
- Die Struktur und Prozesse des Entscheidens im Allgemeinen
- Einflussfaktoren auf Konsumentenentscheidungen im Internet
- Manipulative Techniken und Geschäftsmodelle im Internet
- Die Rolle von Design Patterns und Dark Patterns im Entscheidungsverhalten
- Die Bedeutung von Kundenbewertungen und Vertrauen im Online-Shopping
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Relevanz des Themas Entscheidungsverhalten im Internet dar und erläutert die Leitfrage der Arbeit. Sie führt den Leser in die Grundlagen der Urteils- und Entscheidungspsychologie ein, indem sie das strukturelle Konzept von Entscheidungen und ein Denkmodell zur Informationsverarbeitung bei Entscheidungen vorstellt.
Das zweite Kapitel vertieft die Einführung in die Entscheidungspsychologie und behandelt den Begriff der Entscheidung, die Struktur von Entscheidungen sowie verschiedene Entscheidungstypen. Es stellt die Zwei-Systeme Theorie der Verhaltenssteuerung nach Kahneman vor.
Das dritte Kapitel widmet sich einem Rahmenmodell für den Prozess des Entscheidens und analysiert die einzelnen Phasen: Die selektionale Phase, die präselektionale Phase und die postselektionale Phase.
Kapitel 4 untersucht verschiedene Einflussfaktoren auf Konsumentenentscheidungen im Internet, wie beispielsweise das Website-Design, Vertrauen und Kundenbewertungen. Es betrachtet die Aspekte Glaubwürdigkeit und Nützlichkeit von Kundenbewertungen sowie den Einfluss von Ankereffekten wie Down-Selling, Up-selling und dem Kompromisseffekt.
Im fünften Kapitel werden manipulative Techniken (Dark Patterns) von Anbietern im Internet vorgestellt und analysiert. Es werden Design Patterns wie versteckte Zustimmung, Roach-Motel und Bait and Switch sowie manipulative Geschäftsmodelle wie Sponsored Content, Tokens statt Geld und Penny-Bidding Sites betrachtet.
Schlüsselwörter
Entscheidungsverhalten, Internet, Konsumentenentscheidungen, Online-Shopping, Wirtschaftspsychologie, Website-Design, Vertrauen, Kundenbewertungen, Ankereffekte, Dark Patterns, Design Patterns, Manipulative Techniken, Geschäftsmodelle.
Häufig gestellte Fragen
Was sind Dark Patterns im Internet?
Dark Patterns sind manipulative Design-Techniken, die Nutzer dazu bringen sollen, Entscheidungen zu treffen, die sie eigentlich nicht beabsichtigt haben, wie etwa versteckte Kosten oder erschwerte Kündigungen.
Wie beeinflusst Website-Design das Kaufverhalten?
Das Design einer Website beeinflusst das Vertrauen und die Informationsverarbeitung. Faktoren wie Übersichtlichkeit und gezielte Reize können Konsumentenentscheidungen intuitiv steuern.
Was besagt die Zwei-Systeme-Theorie nach Kahneman?
Daniel Kahneman unterscheidet zwischen System 1 (schnell, intuitiv, emotional) und System 2 (langsam, rational, logisch). Viele Internetentscheidungen werden primär durch System 1 getroffen.
Welche Rolle spielen Kundenbewertungen beim Online-Shopping?
Kundenbewertungen dienen als soziale Bewährtheit. Ihre Glaubwürdigkeit und Nützlichkeit sind entscheidende Faktoren für den Aufbau von Vertrauen in ein Produkt oder einen Anbieter.
Was ist der Ankereffekt im E-Commerce?
Der Ankereffekt nutzt eine erste Information (z. B. einen hohen Ursprungspreis) als Bezugspunkt, um nachfolgende Preise (z. B. Rabatte) attraktiver erscheinen zu lassen.
Details
- Titel
- Was beeinflusst das Entscheidungsverhalten im Internet?
- Untertitel
- Analyse gängiger Konsumentenentscheidungen und Beeinflussungsmethoden der Anbieter mit der Entscheidungspsychologie
- Hochschule
- Hochschule Harz - Hochschule für angewandte Wissenschaften (FH)
- Note
- 1,6
- Autor
- Benjamin Spree (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2016
- Seiten
- 56
- Katalognummer
- V317388
- ISBN (eBook)
- 9783668163065
- ISBN (Buch)
- 9783668163072
- Dateigröße
- 2064 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Entscheidungspsychologie Internet Komsumentenpsychologie Kahneman Evil by Design Dark Patterns Wirtschaftspsychologie Entscheidungsprozess Kundenbewertungen Psychologie des Webdesign Vertrauen im Internet sponsored content und versteckte werbung Penny-Bidding sites zwei-systeme theorie bachelorarbeit wirtschaftspsychologie Einführung Entscheidungspsychologie Amazon psychologie Beeinflussungsmethoden
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 20,99
- Preis (Book)
- US$ 29,99
- Arbeit zitieren
- Benjamin Spree (Autor:in), 2016, Was beeinflusst das Entscheidungsverhalten im Internet?, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/317388
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-