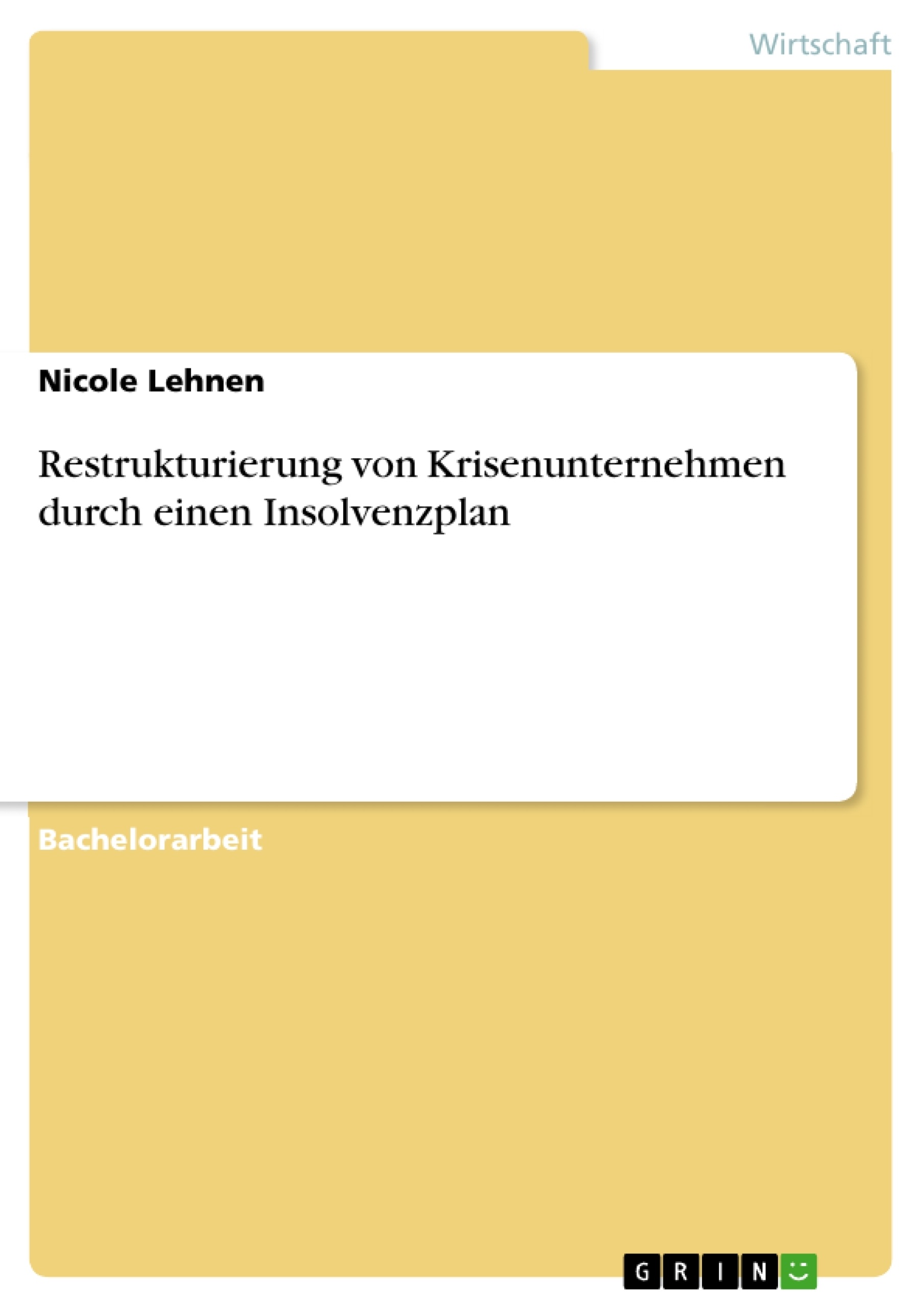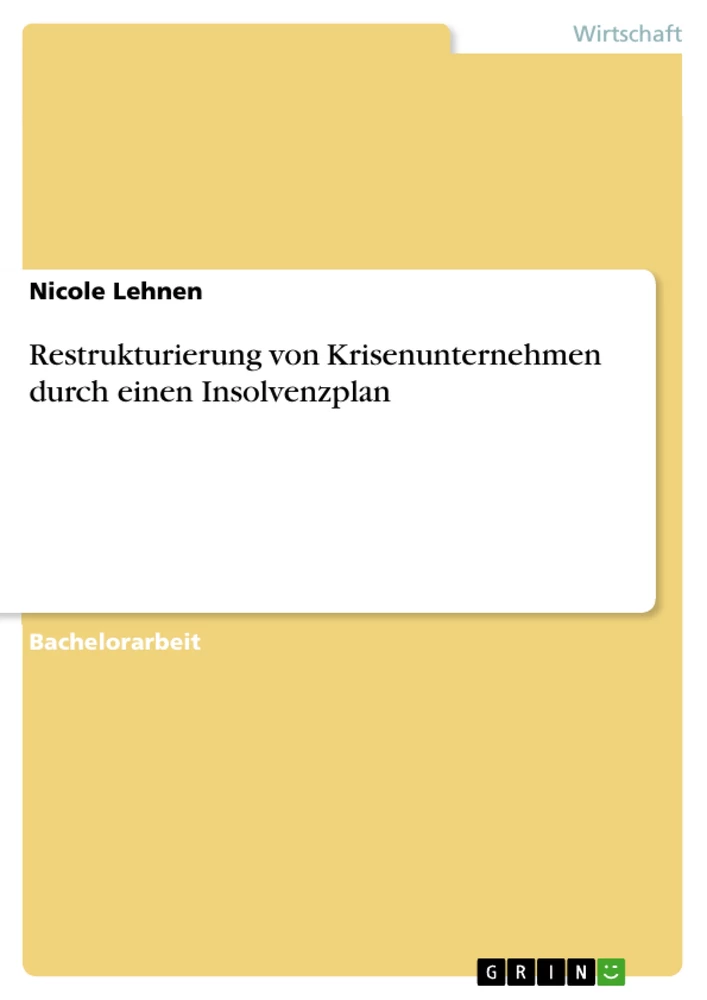
Restrukturierung von Krisenunternehmen durch einen Insolvenzplan
Bachelorarbeit, 2014
43 Seiten, Note: 1,3
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Problemstellung
- Zielsetzung
- Grundlagen
- Voraussetzungen einer Insolvenz
- Die drohende Zahlungsunfähigkeit
- Die Überschuldung
- Die Überschuldung nach Liquidationswerten
- Die Überschuldung nach Fortführungswerten
- Konsequenzen der positiven und negativen Fortführungsprognose
- Die Zahlungsunfähigkeit
- Das Regelinsolvenzverfahren als Folge der Zahlungsunfähigkeit
- Insolvenzplanverfahren und Eigenverwaltung
- Zielsetzungen des Insolvenzplanverfahrens nach dem ESUG
- Stärkung der Mitwirkungsmöglichkeiten der Gläubiger
- Debt-Equity Swap (§225a InsO)
- Die Förderung der Eigenverwaltung (§270a InsO)
- Das Schutzschirmverfahren (§270b InsO)
- Voraussetzungen
- Bedeutung und Ablauf
- Die Bescheinigung nach §270b Abs. 1 Nr.3 InsO
- Kompetenz zur Begründung von Masseverbindlichkeiten
- Beendigung/ Aufhebung des Schutzschirmverfahrens
- Fallbeispiel IVG
- Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Restrukturierung von Krisenunternehmen durch einen Insolvenzplan. Sie analysiert die rechtlichen Grundlagen der Insolvenzordnung und fokussiert auf die Möglichkeiten der Sanierung und Restrukturierung im Insolvenzverfahren. Ziel ist es, die Wirksamkeit und die Grenzen des Insolvenzplans als Instrument der Unternehmensrettung zu beleuchten.
- Voraussetzungen und Formen der Insolvenz
- Das Insolvenzplanverfahren und die Eigenverwaltung
- Die Rolle des ESUG für die Sanierung von Unternehmen
- Die Bedeutung des Debt-Equity Swap im Insolvenzplanverfahren
- Praktische Fallbeispiele und die Relevanz des Schutzschirmverfahrens
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Insolvenz von Unternehmen ein und stellt die Problematik der geringen Anzahl von Insolvenzplanverfahren in Deutschland dar. Sie beleuchtet die Ziele und den Hintergrund der Reform des Insolvenzrechts durch das ESUG.
Das Kapitel „Grundlagen“ behandelt die Voraussetzungen einer Insolvenz, die drohende Zahlungsunfähigkeit und die Überschuldung. Es werden die verschiedenen Formen der Überschuldung sowie die Konsequenzen der Fortführungsprognose erläutert.
Das Kapitel „Insolvenzplanverfahren und Eigenverwaltung“ fokussiert auf die Zielsetzungen des Insolvenzplanverfahrens nach dem ESUG. Es beschreibt die Stärkung der Mitwirkungsmöglichkeiten der Gläubiger und die Förderung der Eigenverwaltung sowie das Schutzschirmverfahren.
Schlüsselwörter
Insolvenzplanverfahren, Restrukturierung, Krisenunternehmen, Eigenverwaltung, Schutzschirmverfahren, ESUG, Zahlungsunfähigkeit, Überschuldung, Debt-Equity Swap, Sanierung, Gläubiger, Schuldner.
Häufig gestellte Fragen
Was ist ein Insolvenzplanverfahren?
Ein Insolvenzplanverfahren ist ein Instrument der Insolvenzordnung, das es ermöglicht, ein Unternehmen im Rahmen der Insolvenz zu sanieren und fortzuführen, anstatt es zu liquidieren.
Was bedeutet das Kürzel ESUG?
ESUG steht für das „Gesetz zur weiteren Erleichterung der Sanierung von Unternehmen“, das 2012 in Kraft trat, um die Rahmenbedingungen für die Rettung von Firmen in der Krise zu verbessern.
Was ist das Schutzschirmverfahren nach § 270b InsO?
Es ist eine spezielle Form der Eigenverwaltung, bei der das Management unter gerichtlicher Aufsicht drei Monate Zeit hat, einen Sanierungsplan auszuarbeiten, bevor das eigentliche Insolvenzverfahren eröffnet wird.
Was versteht man unter einem Debt-Equity Swap?
Beim Debt-Equity Swap werden Forderungen von Gläubigern in Gesellschaftsanteile (Eigenkapital) umgewandelt, um die Schuldenlast des Unternehmens zu senken und die Bilanz zu stärken.
Was sind die Voraussetzungen für eine Insolvenz?
Die drei klassischen Eröffnungsgründe sind Zahlungsunfähigkeit, drohende Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung.
Details
- Titel
- Restrukturierung von Krisenunternehmen durch einen Insolvenzplan
- Hochschule
- Technische Hochschule Köln, ehem. Fachhochschule Köln
- Note
- 1,3
- Autor
- Nicole Lehnen (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2014
- Seiten
- 43
- Katalognummer
- V321921
- ISBN (eBook)
- 9783668212077
- ISBN (Buch)
- 9783668212084
- Dateigröße
- 780 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- restrukturierung krisenunternehmen insolvenzplan
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 19,99
- Preis (Book)
- US$ 29,99
- Arbeit zitieren
- Nicole Lehnen (Autor:in), 2014, Restrukturierung von Krisenunternehmen durch einen Insolvenzplan, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/321921
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-