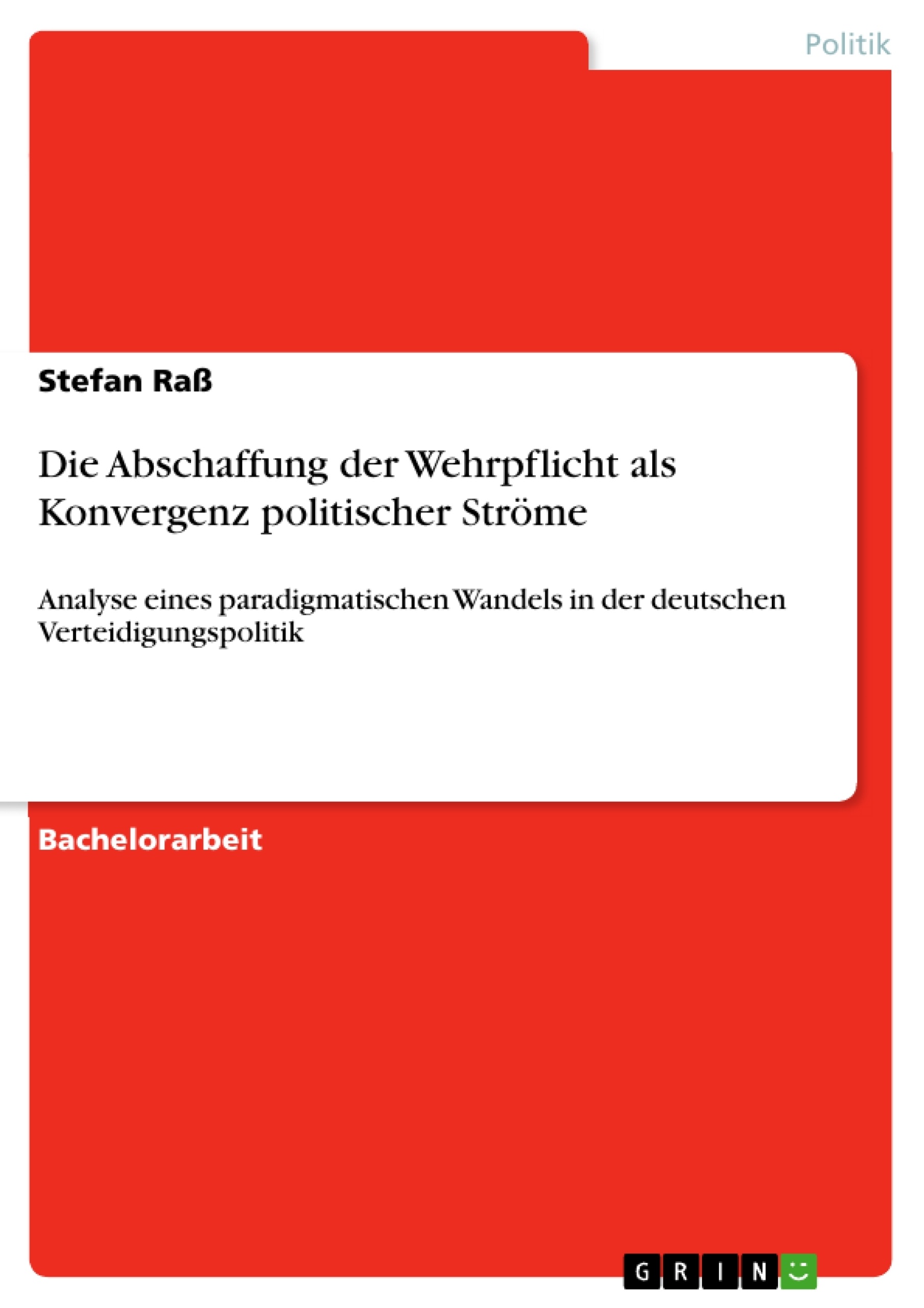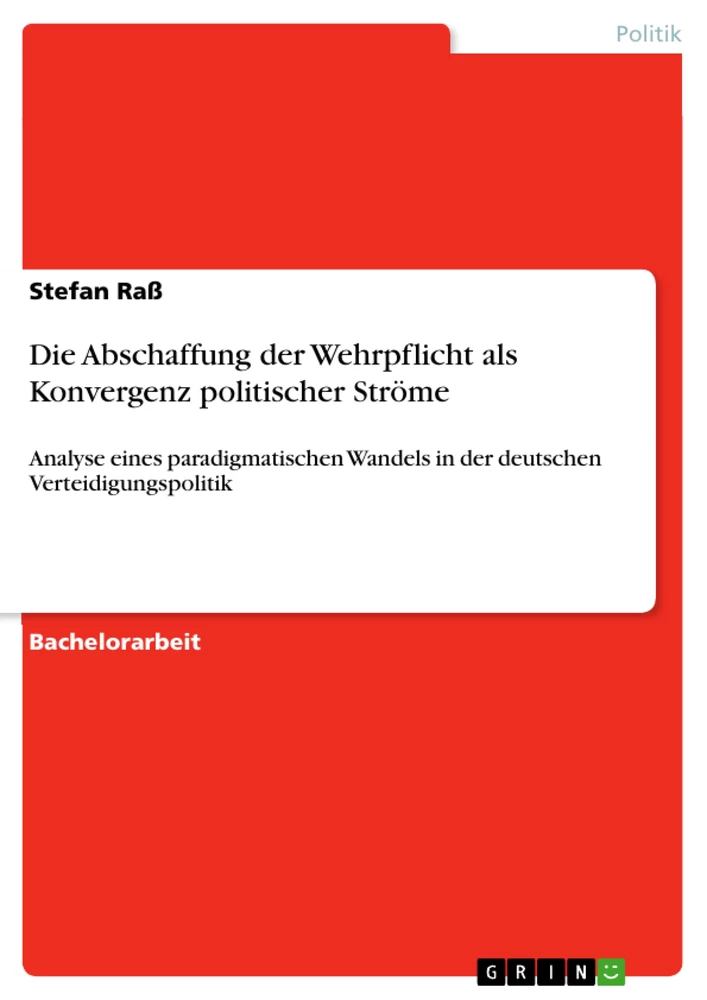
Die Abschaffung der Wehrpflicht als Konvergenz politischer Ströme
Bachelorarbeit, 2016
59 Seiten, Note: 1,0
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Eine konzeptionelle Annäherung an Multiple Streams
- Policy-Cycle und Garbage-Can als Basis des Multiple-Streams-Ansatzes
- Der Multiple-Streams-Ansatz
- Multiple Streams und der politische Wandel in der deutschen Verteidigungspolitik
- Die Wehrpflicht - Eine unendliche Geschichte
- Problemstrom - Zeichen der Zeit
- Politics-Strom - Paradigmatischer Wandel in der deutschen Verteidigungspolitik
- Policy-Strom - Ideen einer neuen Streitkraft
- Politische Akteure im Kontext der Wehrpflicht
- Vom Möglichkeitsfenster zum Politikwandel
- Die Aussetzung der Wehrpflicht in Retrospektive
- Das politische Ende der Wehrpflicht
- Deutschland ohne Grundwehrdienst - (k)eine Erfolgsgeschichte?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Abschaffung der Wehrpflicht in Deutschland im Jahr 2011 unter Verwendung des Multiple-Streams-Ansatzes. Sie zielt darauf ab, die politischen Rahmenbedingungen, Akteure und Probleme aufzuzeigen, die zu diesem paradigmatischen Wandel in der deutschen Verteidigungspolitik führten.
- Der Multiple-Streams-Ansatz als analytisches Framework zur Erklärung des Wandels in der deutschen Verteidigungspolitik
- Die Rolle des Problemstroms, Politics-Stroms und Policy-Stroms in der Aussetzung der Wehrpflicht
- Die Bedeutung politischer Akteure und deren Einfluss auf den politischen Wandel
- Die Implementierung und Evaluierung des Freiwilligen Wehrdienstes
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Abschaffung der Wehrpflicht ein und stellt die Forschungsfrage nach den Ursachen und Bedingungen für diesen Wandel in den Fokus. Kapitel 2 erläutert den Multiple-Streams-Ansatz als theoretisches Framework, das die Analyse des politischen Wandels im Kontext der Wehrpflicht ermöglicht. Kapitel 3 analysiert die einzelnen Ströme des MSA im Hinblick auf die Aussetzung der Wehrpflicht, wobei die Bedeutung der Problemwahrnehmung, der politischen Rahmenbedingungen und der Policy-Ideen hervorgehoben werden. Kapitel 4 widmet sich der Retrospektive und betrachtet die politische Implementierung des Freiwilligen Wehrdienstes sowie die Frage nach dessen Erfolgsgeschichte.
Schlüsselwörter
Wehrpflicht, Freiwilligenarmee, Multiple-Streams-Ansatz, Politikfeldanalyse, Verteidigungspolitik, Deutschland, Politikwandel, politische Akteure, Problemstrom, Politics-Strom, Policy-Strom, Policy-Cycle, politische Implementierung, Evaluierung, Erfolgsgeschichte.
Details
- Titel
- Die Abschaffung der Wehrpflicht als Konvergenz politischer Ströme
- Untertitel
- Analyse eines paradigmatischen Wandels in der deutschen Verteidigungspolitik
- Hochschule
- Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (Institut für Politikwissenschaft)
- Veranstaltung
- Bachelorarbeit
- Note
- 1,0
- Autor
- Stefan Raß (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2016
- Seiten
- 59
- Katalognummer
- V322448
- ISBN (eBook)
- 9783668217928
- ISBN (Buch)
- 9783668217935
- Dateigröße
- 1014 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- MSA Multiple Streams Framework politischer Entrepreneur Kingdon Verteidigungspolitik Bundeswehr Wehrpflicht Reform Bundeswehrreform Streitkräfte Guttenberg Freiwilligenarmee Verteidigungsminister Grundwehrdienst Freiwilliger Wehrdienst Policy-Cycle Politikzyklus Policy Ströme politische Ströme Konvergenz Abschaffung Aussetzung
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 20,99
- Preis (Book)
- US$ 29,99
- Arbeit zitieren
- Stefan Raß (Autor:in), 2016, Die Abschaffung der Wehrpflicht als Konvergenz politischer Ströme, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/322448
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-