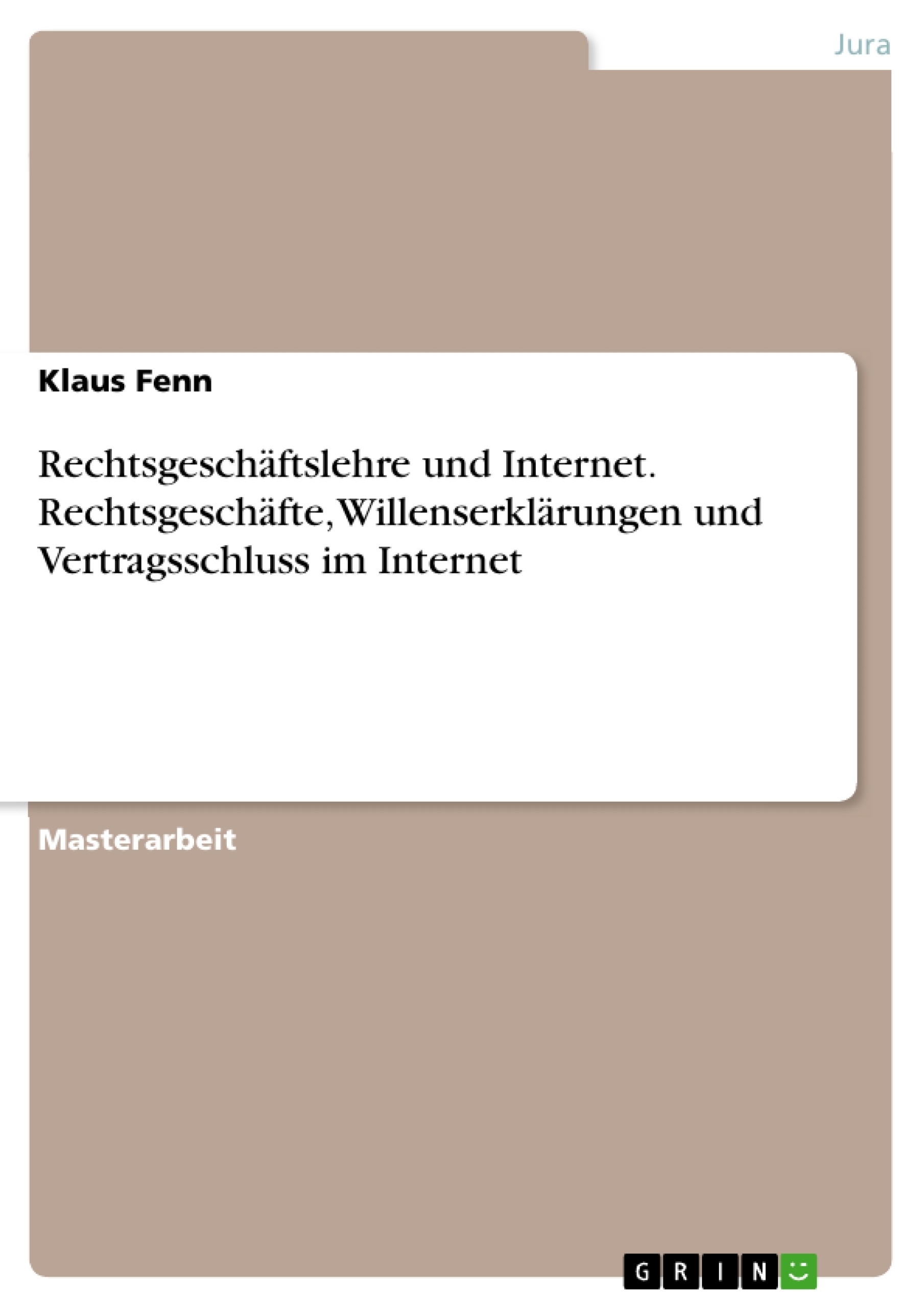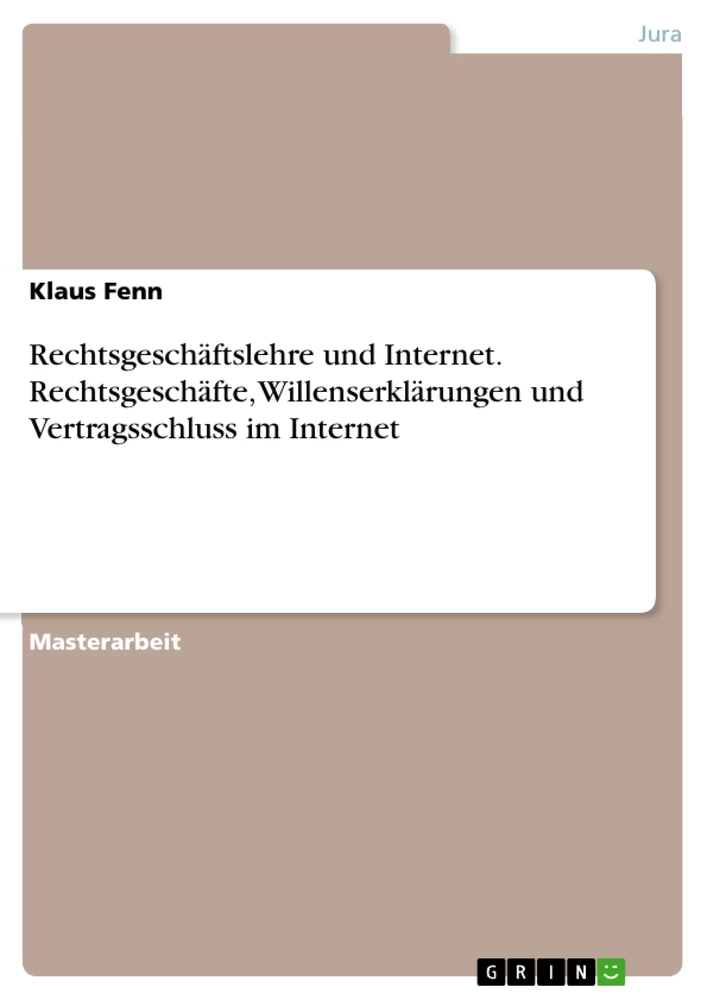
Rechtsgeschäftslehre und Internet. Rechtsgeschäfte, Willenserklärungen und Vertragsschluss im Internet
Masterarbeit, 2015
91 Seiten, Note: 3,0
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- A. Das Rechtsgeschäft
- I. Begriff und Bedeutung
- II. Ein- und mehrseitige Rechtsgeschäfte
- III. Abgrenzungen
- 1. Geschäftsähnliche Handlungen
- 2. Realakte
- 3. Gefälligkeitshandlungen
- 4. Einwilligungen
- B. Die Willenserklärung
- I. Begriff und Tatbestand
- 1. Objektiver Tatbestand
- 2. Subjektiver Tatbestand
- a) Handlungswille
- b) Erklärungsbewusstsein/Erklärungswille
- c) Geschäftswille/Rechtsfolgewille
- d) Rechtsbindungswille
- e) Irrelevanz des subjektiven Tatbestands
- II. Die Willenserklärung im Internet
- 1. Die elektronisch übermittelte Willenserklärung
- a) Objektiver Tatbestand
- b) Subjektiver Tatbestand
- 2. Die Computererklärung
- a) Objektiver Tatbestand
- b) Subjektiver Tatbestand
- 1. Die elektronisch übermittelte Willenserklärung
- III. Ergebnis
- I. Begriff und Tatbestand
- C. Die Wirksamkeit von Willenserklärungen im Internet
- I. Grundsatz
- II. Die Abgabe der Willenserklärung
- 1. Abgabe der elektronisch übermittelte Willenserklärungen
- 2. Abgabe der Computererklärung
- III. Der Zugang der Willenserklärung
- 1. Allgemeines
- 2. Zugang unter Abwesenden
- a) Elektronisch übermittelte Erklärung
- (1) Gelangen in den Machtbereich
- (2) Möglichkeit der Kenntnisnahme
- b) Computererklärung
- a) Elektronisch übermittelte Erklärung
- 3. Zugang unter Anwesenden
- 4. Zugang bei Online-Auktionen
- 5. Zugangsstörungen
- 6. Zugangsbeweis
- IV. Der Widerruf elektronischer Willenserklärungen
- V. Konkludente Willenserklärung und Schweigen
- VI. Ergebnis
- D. Die Stellvertretung
- I. Handeln in fremdem Namen
- II. Handeln unter fremdem Namen
- 1. Duldungsvollmacht
- 2. Anscheinsvollmacht
- 3. Vertrauenstatbestand
- 4. Zurechnung
- 5. Rechtsschein gem. § 172 Abs. 1 BGB analog
- 6. Eigener Rechtsscheintatbestand bei Handeln unter fremdem Namen
- III. Ergebnis
- E. Vertragsschluss im Internet
- I. Antrag
- 1. Antrag oder invitatio ad offerendum
- 2. Offline-Geschäfte
- 3. Online-Geschäfte
- 4. Zwischenergebnis
- II. Annahme
- III. Entbehrlichkeit § 151 Satz 1 BGB
- IV. Automatisierte Bestellbestätigung
- V. Vertragsschluss durch autonome elektronische Agenten
- VI. Online-Auktionen
- 1. Angebot des Verkäufers bindend oder invitatio ad offerendum
- a) Einstellen als invitatio ad offerendum
- b) Preis-Vorschlagen-Option
- c) Eigene Bestimmung des Verkäufers
- d) Annahmemodell
- e) Angebotsmodell
- f) Sofort-Kaufen-Option
- 2. Vorzeitige Beendigung einer Auktion
- 3. Widerruf § 130 Abs. 1 Satz 2 BGB
- 4. Shill Bidding
- 1. Angebot des Verkäufers bindend oder invitatio ad offerendum
- VII. Ergebnis
- I. Antrag
- F. Wirksamkeitshindernisse von Rechtsgeschäften im Internet
- I. Mängel in der Geschäftsfähigkeit
- 1. Bewirkung mit eigenen Mitteln § 110 BGB
- 2. Duldungs- und Anscheinsvollmacht
- II. Scheingeschäft § 117 BGB
- III. Nichtigkeit wegen Formmangel
- 1. Schriftform § 126 BGB
- a) Urkunde
- b) Verkörperung
- c) Wahrnehmbarkeit
- d) Eigenhändige Unterschrift
- e) Zwischenergebnis
- 2. Elektronische Form § 126 a BGB
- 3. Textform § 126 b BGB
- 4. Vereinbarte Form § 127 BGB
- 5. Die Button-Pflicht des § 312j Abs. 3, 4 BGB als Formvorschrift
- 6. Ergebnis
- 1. Schriftform § 126 BGB
- IV. Verstoß gegen gesetzliches Verbot § 134 BGB
- V. Verstoß gegen die guten Sitten § 138 BGB
- VI. Nichtigkeit wegen Anfechtung (§ 142 Abs. 1 BGB)
- 1. Vorrang der Auslegung
- 2. Anfechtung wegen Irrtum § 119 BGB
- a) Inhaltsirrtum § 119 Abs. 1 Alt. 1 BGB
- b) Erklärungsirrtum § 119 Abs. 1 Alt. 2 BGB
- (1) Eingabefehler
- (2) Datenmaterialfehler
- (3) Softwarefehler
- c) Fehlendes Erklärungsbewusstsein
- d) Eigenschaftsirrtum § 119 Abs. 2 BGB
- 3. Übermittlungsfehler § 120 BGB
- 4. Täuschung oder Drohung § 123 BGB
- 5. Anfechtungserklärung und Anfechtungsfrist
- 6. Rechtsfolgen
- VII. Der Dissens
- I. Mängel in der Geschäftsfähigkeit
- G. Einbeziehung von Allgemeinen Geschäftsbedingungen
- I. Grundlegendes
- II. Ausdrücklicher Hinweis
- III. Zumutbare Möglichkeit der Kenntnisnahme
- IV. Einverständnis der anderen Vertragspartei
- V. Einbeziehung zwischen Unternehmern
- VI. Online-Auktionen
- 1. Unmittelbare Geltung im Marktverhältnis
- 2. Vorvertragliche Rahmenvereinbarung
- 3. Vertrag zu Gunsten Dritter
- 4. Vertrag mit Schutzwirkung für Dritte
- 5. Einbeziehung der Nutzungsbedingungen in den Kaufvertrag
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Masterarbeit befasst sich mit der Rechtsgeschäftslehre im Kontext des Internets. Sie analysiert, wie sich die digitalen Kommunikationsformen auf die Entstehung und Wirksamkeit von Rechtsgeschäften auswirken. Der Fokus liegt dabei auf der Frage, wie die klassischen Rechtsgrundsätze der Willenserklärung, der Stellvertretung und des Vertragsschlusses im digitalen Raum Anwendung finden.
- Die Bedeutung von Willenserklärungen im Internet
- Die Herausforderungen der Abgabe und des Zugangs von Willenserklärungen im digitalen Raum
- Die rechtliche Regulierung von Vertragsschlüssen im Internet
- Die Einbeziehung von Allgemeinen Geschäftsbedingungen in Online-Verträgen
- Die Auswirkungen von digitalen Technologien auf die Wirksamkeit von Rechtsgeschäften
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Thematik der Masterarbeit vor und erläutert die Relevanz der Rechtsgeschäftslehre im Kontext des Internets. Kapitel A befasst sich mit dem Rechtsgeschäft im Allgemeinen und definiert dessen Begriff, Bedeutung und Abgrenzungen. Kapitel B analysiert die Willenserklärung im Internet, insbesondere die elektronisch übermittelte Willenserklärung und die Computererklärung. Kapitel C untersucht die Wirksamkeit von Willenserklärungen im Internet, wobei die Abgabe, der Zugang und der Widerruf von elektronischen Willenserklärungen im Fokus stehen. Kapitel D behandelt die Stellvertretung im Internet und beleuchtet die rechtlichen Besonderheiten des Handelns in fremdem Namen und unter fremdem Namen. Kapitel E befasst sich mit dem Vertragsschluss im Internet, wobei die Besonderheiten von Online-Auktionen und die Rolle von automatisierten Bestellbestätigungen und autonomen elektronischen Agenten beleuchtet werden. Kapitel F analysiert die Wirksamkeitshindernisse von Rechtsgeschäften im Internet, einschließlich Mängel in der Geschäftsfähigkeit, Scheingeschäfte, Formmängel, Verstöße gegen gesetzliche Verbote und gute Sitten, Anfechtung und Dissens. Kapitel G untersucht die Einbeziehung von Allgemeinen Geschäftsbedingungen in Online-Verträge, wobei die Besonderheiten von Online-Auktionen und die Einbeziehung von Nutzungsbedingungen in Kaufverträge im Fokus stehen.
Schlüsselwörter
Rechtsgeschäftslehre, Internet, Willenserklärung, Stellvertretung, Vertragsschluss, Online-Auktionen, Allgemeine Geschäftsbedingungen, digitale Technologien, Rechtswirksamkeit, elektronische Kommunikation, Datenschutz, E-Commerce.
Details
- Titel
- Rechtsgeschäftslehre und Internet. Rechtsgeschäfte, Willenserklärungen und Vertragsschluss im Internet
- Hochschule
- FernUniversität Hagen
- Note
- 3,0
- Autor
- Klaus Fenn (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2015
- Seiten
- 91
- Katalognummer
- V322510
- ISBN (eBook)
- 9783668219403
- Dateigröße
- 781 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Rechtsgeschäftslehre Willenserklärung im Internet Wirksamkeit von Willenserklärungen Stellvertretung Anscheinsvollmacht Duldungsvollmacht Rechtsschein Vertragsschluss im Internet Invitatio ad offerendum Online-Auktionen Wirksamkeitshindernisse Nichtigkeit Button-Pflicht Anfechtung Dissens Einbeziehung AGB Formmangel Shill Bidding
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 17,99
- Arbeit zitieren
- Klaus Fenn (Autor:in), 2015, Rechtsgeschäftslehre und Internet. Rechtsgeschäfte, Willenserklärungen und Vertragsschluss im Internet, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/322510
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-