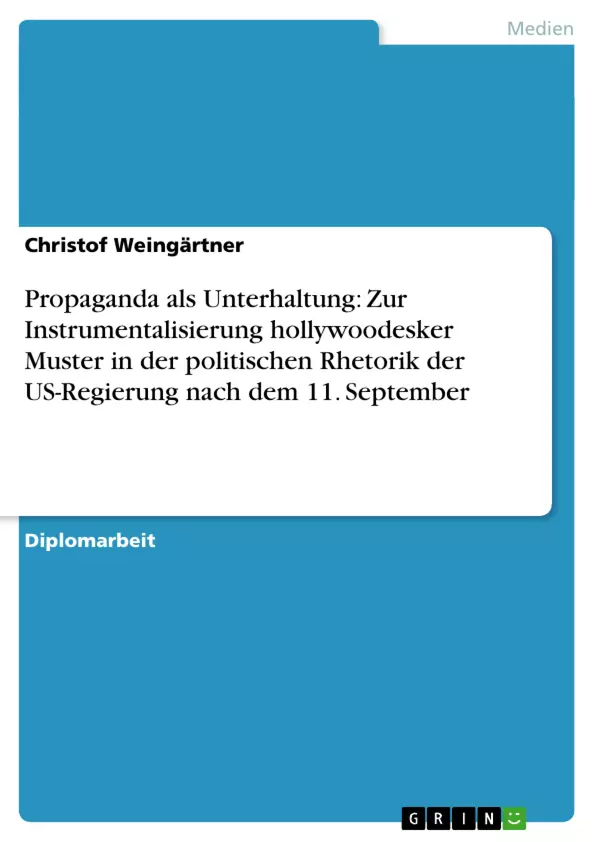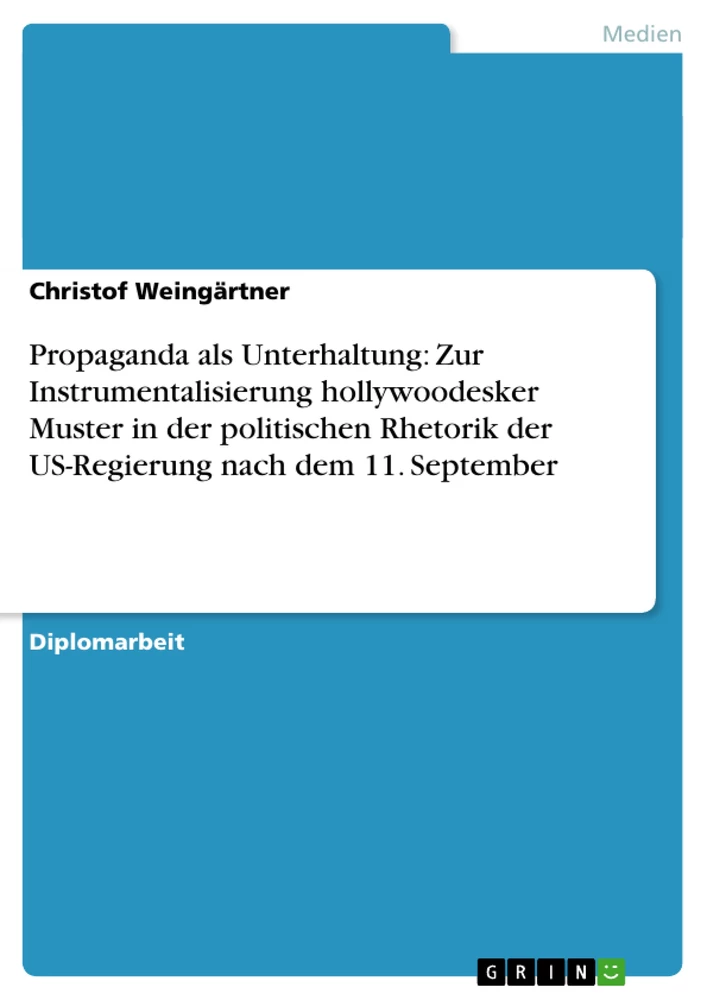
Propaganda als Unterhaltung: Zur Instrumentalisierung hollywoodesker Muster in der politischen Rhetorik der US-Regierung nach dem 11. September
Diplomarbeit, 2004
142 Seiten, Note: 1,8
Medien / Kommunikation - Medien und Politik, Pol. Kommunikation
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Hollywoodeske Muster
- Archetypische Vorboten
- Der klassische Monomythos
- Funktionen des klassischen Mythos –für das Individuum
- - für eine Gemeinschaft
- Das Ritual
- Der klassische Monomythos
- Der Amerikanische Monomythos
- Der Aufbau
- Die Darstellung des Helden
- Funktionen
- Entstehungsgeschichte
- Paradiesische Zustände
- Bedrohung des Paradieses
- Selbstjustiz
- Weitere Entwicklungen
- Moralverständnis
- Politikvermittlung im American Monomyth
- Die politischen Traditionen der USA
- Die vier Traditionslinien
- Die politischen Traditionen der USA als Bestandteil des American Monomyth
- Popfaschismus vs. Demokratieverteidigung
- Die politischen Traditionen der USA
- Zwischenresumée
- Politikvermittlung und Unterhaltung
- Unterhaltung vs. Information
- Politische Verortung
- Politische Kultur
- Politische Identität
- Politikvermittlung
- Politische Rhetorik
- Politische Inszenierung
- Theatralisierung des Politischen
- Von der Korporalität zur Personifizierung
- Performance und politische Events
- Wahrnehmung
- Die politische Rhetorik des US-amerikanischen Präsidenten
- Entertainisierung von Politik
- Visualisierung
- Komplexitätsreduzierende Politikvermittlung
- Scheinwelt/ Illusionen/ Als-ob-Welten
- Politischer Mainstream
- Politainment
- Medien-Metaphern
- Douglas Kellner
- Krieg als Massenkultur?
- Beispiele aus Hollywood
- Zwischenresumée
- Propaganda
- Begriffsbestimmung
- Massenpsychologische Verortung
- Abgrenzung zu Nachbardisziplinen
- Funktionen der Nachbardisziplinen
- Propaganda vs. politische PR
- Propaganda vs. Persuasion
- Propaganda in pluralistischen Systemen
- Die Organisation der Medien
- Merkmale effektiver Propaganda
- Informative Propaganda
- Ethnozentristische Orientierung
- Moralvermittlung
- Begriffsbestimmung Moral
- Moralisieren
- Verwendung von Dichotomien
- Verkündung „großer Werte“
- Oppositionspaar „wertvolle/ wertlose“ Opfer
- Analyse von Propaganda
- Legitimierungsstrategien für militärische Interventionen
- Chronologie der Ereignisse nach dem 11. September
- Der 11. September und Afghanistan
- Irakkonflikt
- Chronologie und hollywoodeske Muster
- Methoden/ Untersuchungsdesign
- Qualitative Inhaltsanalyse
- Untersuchungsgegenstand
- Kategoriensystem
- Verwendete qualitative Techniken
- Interpretation
- Eine paradiesische Gemeinschaft... (Darstellung der eigenen Gemeinschaft)
- Berücksichtigung konstituierender Werte der eigenen Gemeinschaft
- Deklarierung des eigenen Wertesystems zum Maßstab
- Betonung christlicher Werte
- Verwendung von Symbolen
- ...unterliegt einer Bedrohung.... (Darstellung von Bedrohungen)
- Formen der Bedrohung
- Reaktion der Gemeinschaft auf die Bedrohung
- Opferrolle
- Schwellenphase
- Indizien für Communitas
- Zusammenhalt in der Gruppe
- Konstatieren eigener moralischer Verfehlungen
- ...eines Feindes... (Darstellung der Feinde)
- Feindbestimmung
- Werte des Feindes
- ...gesellschaftliche Institutionen, die üblicherweise mit der Behebung von Unregelmäßigkeiten betraut sind... (Darstellung von Institutionen)
- ...versagen.... (Darstellung des Versagens von Institutionen)
- ...Ein selbstloser Held tritt hervor... (Darstellung von Helden)
- Bestimmung der Helden
- Präsident als rituelle Autorität
- Gemeinschaft auf einen einheitlichen Stand unterwerfen
- Mit Kraft ausstatten
- Aufruf zur Partizipation
- …..und bekämpft den Feind... (Darstellung der Feindbekämpfung)
- Drohungen und Forderungen
- Aussagen über Bekämpfung
- Zeit- und Handlungsdruck
- Legitimation von Gewaltanwendung
- Opferbeschreibung
- .Ein entscheidender Sieg wird erlangt.... (Darstellung von Siegen)
- Art des Sieges
- Wiederherstellung paradiesartiger Zustände
- ...Der Held macht aufgrund der Ereignisse eine entscheidende Entwicklung durch........
- Zur Instrumentalisierung hollywoodesker Muster
- Eine paradiesische Gemeinschaft... (Darstellung der eigenen Gemeinschaft)
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Verwendung von narrativen Mustern, die aus der amerikanischen Unterhaltungskultur stammen, in der politischen Rhetorik und Medienberichterstattung über den Irakkrieg. Die Analyse zielt darauf ab, die Rolle dieser Muster bei der Legitimierung von militärischen Interventionen in den USA zu verstehen.
- Der Einfluss von Hollywood-Filmen auf die politische Kommunikation
- Die Verwendung des "American Monomyth" als rhetorisches Mittel
- Die Analyse von Propaganda und deren Rolle bei der Legitimierung von Krieg
- Die Verknüpfung von Unterhaltungskultur und Politik in den USA
- Die Untersuchung von medialen Darstellungen des Irakkrieges
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Dieses Kapitel stellt die Forschungsfrage und den Kontext der Arbeit vor. Es beschreibt die Unverständniserregung über den Irakkrieg und stellt die These auf, dass die amerikanische Regierung auf den 11. September 2001 mit einer Reaktion nach "hollywoodesken" Mustern reagierte. Die Arbeit untersucht, inwiefern die Unterhaltungskultur und die Tendenz der Politik zur Unterhaltungsorientierung die Ereignisse beeinflusst haben.
- Hollywoodeske Muster: Dieses Kapitel untersucht den "American Monomyth" als grundlegende Struktur, die in vielen Hollywood-Filmen vorkommt. Es werden die Funktionen dieses narrativen Musters und dessen Auswirkung auf das Individuum und die Gemeinschaft analysiert.
- Politikvermittlung und Unterhaltung: Dieses Kapitel untersucht die Verbindung von Politik und Unterhaltung in den USA. Es wird die zunehmende Komplexität politischer Prozesse und die Tendenz zur Unterhaltungsorientierung beleuchtet.
- Propaganda: Dieses Kapitel definiert den Begriff "Propaganda" und grenzt ihn von Nachbardisziplinen wie politischer PR und Persuasion ab. Es werden die Funktionen von Propaganda in pluralistischen Systemen und die Merkmale effektiver Propaganda analysiert.
- Chronologie der Ereignisse nach dem 11. September: Dieses Kapitel stellt eine chronologische Zusammenfassung der Ereignisse nach dem 11. September 2001 dar, einschließlich der Intervention in Afghanistan und dem Irakkonflikt.
- Methoden/ Untersuchungsdesign: Dieses Kapitel beschreibt die angewandte Forschungsmethode, die qualitative Inhaltsanalyse. Es werden der Untersuchungsgegenstand, das Kategoriensystem und die verwendeten Techniken vorgestellt.
Schlüsselwörter
American Monomyth, Hollywood, Unterhaltungskultur, Politikvermittlung, Propaganda, Irakkrieg, 11. September, Medienberichterstattung, Rhetorik, Legitimierung, Narrative Muster, Analyse, Qualitative Inhaltsanalyse.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der „American Monomyth“?
Es ist ein narratives Muster in US-Unterhaltungsprodukten, bei dem ein selbstloser Held eine bedrohte Gemeinschaft rettet, oft durch den Einsatz von Gewalt außerhalb des Gesetzes.
Wie wurde der Irakkrieg durch Hollywood-Muster legitimiert?
Die politische Rhetorik nutzte Dichotomien von „Gut gegen Böse“ und inszenierte den Krieg als heroische Mission zur Verteidigung paradiesischer Zustände.
Was versteht man unter „Politainment“?
Politainment bezeichnet die Vermischung von Politik und Unterhaltung, bei der politische Inhalte zunehmend über emotionale Bilder und narrative Techniken der Massenkultur vermittelt werden.
Welche Rolle spielte der 11. September für die US-Propaganda?
Die Anschläge dienten als Auslöser für eine Erzählung von kollektiver Opferrolle und notwendiger heroischer Vergeltung, die massenpsychologisch tief wirkte.
Was unterscheidet Propaganda von politischer PR?
Propaganda zielt oft auf eine massenpsychologische Steuerung und emotionale Mobilisierung ab, während PR eher auf Imagepflege und Information in pluralistischen Systemen fokussiert ist.
- Archetypische Vorboten
Details
- Titel
- Propaganda als Unterhaltung: Zur Instrumentalisierung hollywoodesker Muster in der politischen Rhetorik der US-Regierung nach dem 11. September
- Hochschule
- Universität Siegen (FB 3)
- Note
- 1,8
- Autor
- Christof Weingärtner (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2004
- Seiten
- 142
- Katalognummer
- V33543
- ISBN (eBook)
- 9783638339926
- Dateigröße
- 972 KB
- Sprache
- Deutsch
- Anmerkungen
- In der Arbeit werden verblüffende Parallelen zwischen der Theorie des American Monomyth von Jewett/ Lawrence und der politischen Propaganda aufgezeigt.
- Schlagworte
- Propaganda Unterhaltung Instrumentalisierung Muster Rhetorik US-Regierung September
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 39,99
- Arbeit zitieren
- Christof Weingärtner (Autor:in), 2004, Propaganda als Unterhaltung: Zur Instrumentalisierung hollywoodesker Muster in der politischen Rhetorik der US-Regierung nach dem 11. September, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/33543
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-