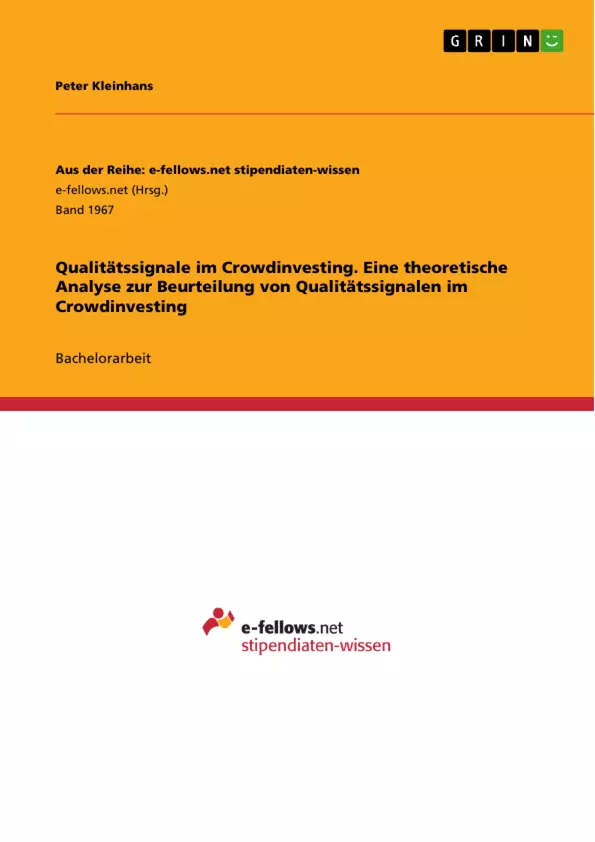Blick ins Buch
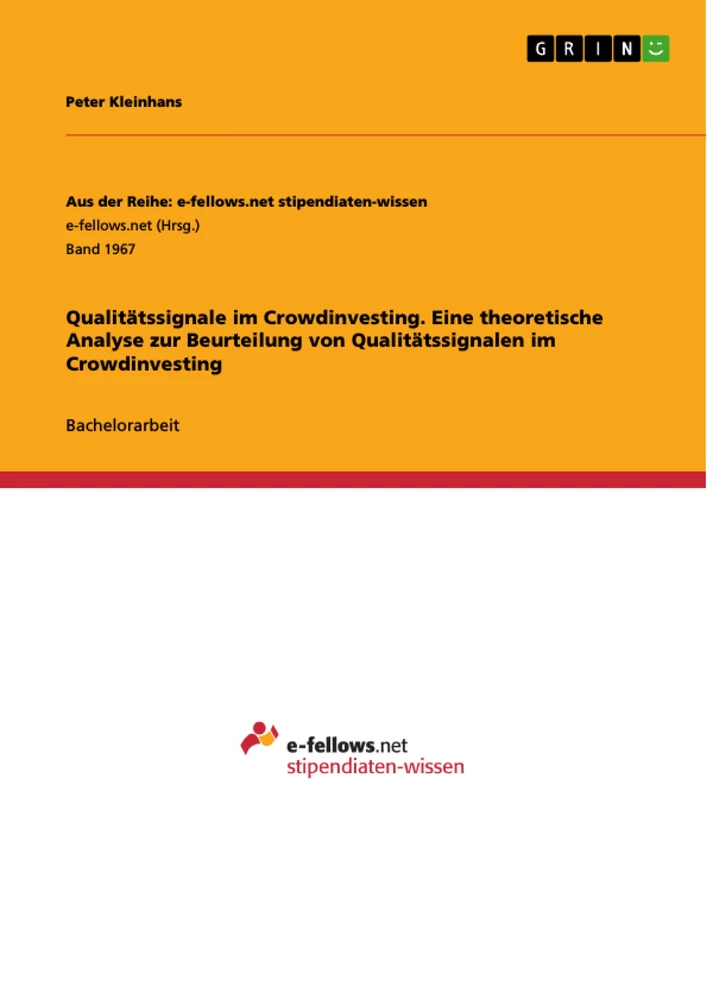
Qualitätssignale im Crowdinvesting. Eine theoretische Analyse zur Beurteilung von Qualitätssignalen im Crowdinvesting
Bachelorarbeit, 2016
63 Seiten, Note: 1,9
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Theoretische Grundlage
- 2.1 Crowdinvesting als innovative Möglichkeit der Unternehmensfinanzierung
- 2.1.1 Crowdfunding als Bestandteil von Crowdsourcing
- 2.1.2 Crowdinvesting als Unterform des Crowdfundings vor dem Hintergrund der Unternehmensfinanzierung
- 2.1.3 Akteure des Crowdinvesting
- 2.2 Prinzipal-Agent-Theorie im Crowdinvesting
- 2.2.1 Ausprägung und Problematik der Prinzipal-Agent-Beziehung
- 2.2.2 Hidden characteristics als Ursache für Informationsasymmetrien
- 2.2.3 Signaling als Lösung für Informationsasymmetrien
- 2.3 Qualität im Crowdinvesting
- 2.3.1 Einordnung des Qualitätsbegriffes
- 2.3.2 Qualitätsbeurteilung nach Nelson
- 3 Identifikation und Klassifizierung von Qualitätssignalen im Crowdinvesting
- 3.1 Qualitätssignale in der Projektgestaltung
- 3.1.1 Ausgestaltung des Finanzrahmens
- 3.1.2 Externe Zertifikate
- 3.1.3 Nichtfinanzielle Projektbeschreibung
- 3.1.4 Darstellung des Risikos
- 3.2 Qualitätssignale im Finanzierungsprozess
- 3.3 Qualitätssignale des Start-Up-Teams
- 3.1 Qualitätssignale in der Projektgestaltung
- 4 Beurteilung der identifizierten Qualitätssignale durch die Einordnung in Kategorien
- 4.1 Beurteilung der Qualitätssignale nach Ahlers et al.
- 4.1.1 Fact-based Signale
- 4.1.2 Performance-based Signale
- 4.2 Beurteilung der Qualitätssignale nach Nelson
- 4.2.1 Einordnung der Qualitätssignale in Sucheigenschaften
- 4.2.2 Einordnung der Qualitätssignale in Erfahrungseigenschaften
- 4.2.2 Einordnung der Qualitätssignale in Vertrauenseigenschaften
- 4.3 Zusammenfassung und Bewertung des Analyseschemas
- 4.1 Beurteilung der Qualitätssignale nach Ahlers et al.
- 5 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit zielt darauf ab, eine theoretische Analyse zur Beurteilung von Qualitätssignalen im Crowdinvesting vorzunehmen. Die Arbeit untersucht, welche Qualitätssignale die im Crowdinvesting auftretenden Informationsasymmetrien verringern und welche Eigenschaften ein wertvolles Qualitätssignal ausmachen.- Identifizierung von Qualitätssignalen im Crowdinvesting
- Klassifizierung von Qualitätssignalen nach verschiedenen Kriterien
- Analyse der Wirksamkeit von Qualitätssignalen auf verschiedenen Märkten
- Bewertung der Bedeutung von Qualitätssignalen für Start-Ups
- Ableitung von Empfehlungen für Start-Ups zur gezielten Verwendung von Qualitätssignalen
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung
- Einleitung in das Thema Crowdinvesting und die Relevanz von Qualitätssignalen
- Formulierung der Forschungsfrage und der Zielsetzung der Arbeit
- Gliederung der Arbeit
- Kapitel 2: Theoretische Grundlage
- Definition und Abgrenzung des Crowdinvestings
- Darstellung der Prinzipal-Agent-Theorie als Grundlage für die Analyse von Informationsasymmetrien
- Erklärung des Signaling-Konzepts als Lösungsansatz für Informationsasymmetrien
- Einordnung des Qualitätsbegriffes im Kontext von Crowdinvesting
- Kapitel 3: Identifikation und Klassifizierung von Qualitätssignalen im Crowdinvesting
- Identifizierung von Qualitätssignalen in der Projektgestaltung, im Finanzierungsprozess und beim Start-Up-Team
- Klassifizierung der identifizierten Qualitätssignale nach verschiedenen Kriterien
- Kapitel 4: Beurteilung der identifizierten Qualitätssignale durch die Einordnung in Kategorien
- Bewertung der Qualitätssignale nach den Modellen von Ahlers et al. und Nelson
- Einordnung der Qualitätssignale in Kategorien wie fact-based, performance-based, Sucheigenschaften, Erfahrungseigenschaften und Vertrauenseigenschaften
- Kapitel 5: Fazit
- Zusammenfassung der Ergebnisse der Analyse
- Bewertung der Bedeutung von Qualitätssignalen für Start-Ups
- Ableitung von Empfehlungen für Start-Ups zur gezielten Verwendung von Qualitätssignalen
Schlüsselwörter
Crowdinvesting, Qualitätssignale, Informationsasymmetrien, Prinzipal-Agent-Theorie, Signaling, Fact-based Signale, Performance-based Signale, Sucheigenschaften, Erfahrungseigenschaften, Vertrauenseigenschaften, Start-Ups, Unternehmensfinanzierung.
Ende der Leseprobe aus 63 Seiten
- nach oben
Details
- Titel
- Qualitätssignale im Crowdinvesting. Eine theoretische Analyse zur Beurteilung von Qualitätssignalen im Crowdinvesting
- Hochschule
- Leuphana Universität Lüneburg (Lehrstuhl für Gründungsmanagement)
- Note
- 1,9
- Autor
- Peter Kleinhans (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2016
- Seiten
- 63
- Katalognummer
- V336147
- ISBN (eBook)
- 9783668257634
- ISBN (Buch)
- 9783668257641
- Dateigröße
- 1570 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Crowdinvesting Gründungsfinanzierung Qualitätssignale
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 31,99
- Preis (Book)
- US$ 45,99
- Arbeit zitieren
- Peter Kleinhans (Autor:in), 2016, Qualitätssignale im Crowdinvesting. Eine theoretische Analyse zur Beurteilung von Qualitätssignalen im Crowdinvesting, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/336147
Allgemein
Autoren
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen
Premium Services
FAQ
Marketing
Dissertationen
Leser & Käufer
Zahlungsmethoden

Copyright
- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Über GRIN
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-