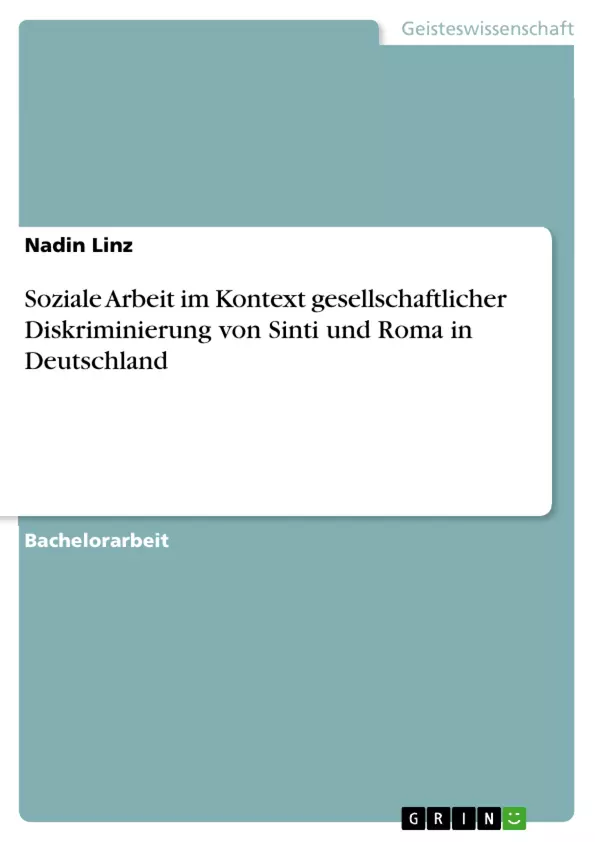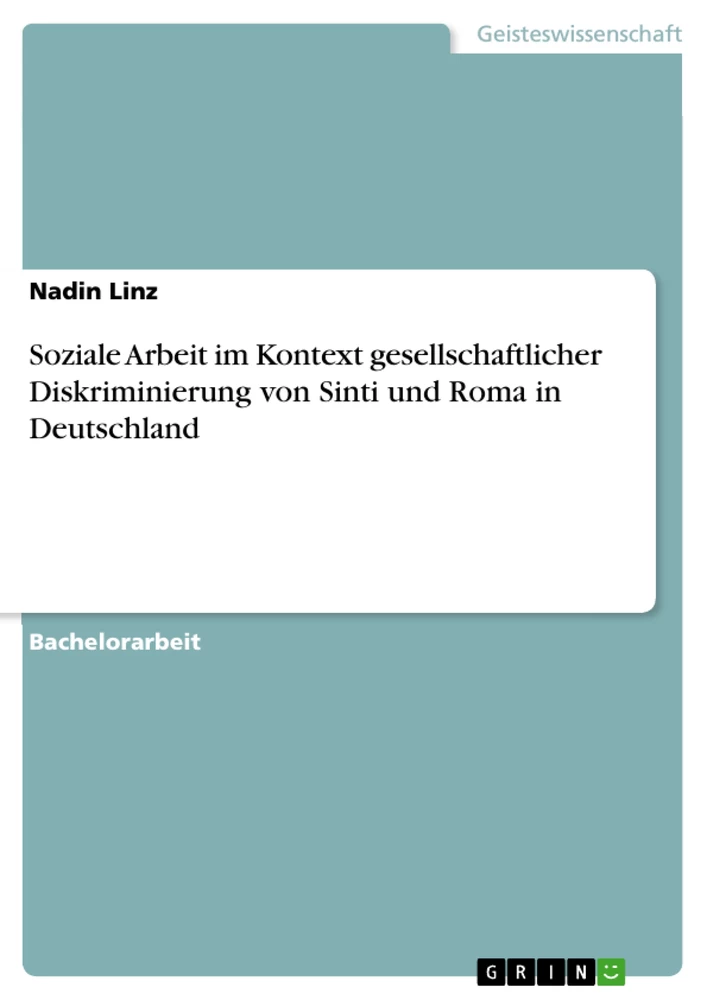
Soziale Arbeit im Kontext gesellschaftlicher Diskriminierung von Sinti und Roma in Deutschland
Bachelorarbeit, 2016
62 Seiten, Note: 1,3
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Deskriptive Einführung
- Vorbemerkungen
- Kurzcharakterisierung der Sinti und Roma
- Sinti und Roma in Deutschland: Vergangenheit und Einführung in den Status Quo
- Darstellung der Diskriminierung von Sinti und Roma in Deutschland
- Diskriminierung auf der individuellen Ebene
- Diskriminierung auf der institutionellen Ebene
- Diskriminierung auf der strukturellen Ebene
- Die Wirkungszusammenhänge der antiziganistischen Vorurteilsstruktur
- Grundmechanismen von Vorurteilen
- Vorurteile und Stereotype des Antiziganismus
- Funktionen des Antiziganismus
- Zwischenfazit
- Die Relevanz des Antiziganismus für die Soziale Arbeit
- Antiziganismus als Auftrag Sozialer Arbeit
- Gegenstand Sozialer Arbeit im Kontext des Antiziganismus
- Eine Annäherung von Sozialer Arbeit und Strategien gegen Antiziganismus
- Antiziganismus als Forschungsgegenstand Sozialer Arbeit
- Antiziganismuskritische Praxis Sozialer Arbeit
- Antiziganismus als Thema in der Qualifizierung Sozialer Arbeit
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorthesis untersucht Ausgrenzungs- und Abwertungsmechanismen gegenüber Sinti und Roma in Deutschland, deren Verankerung in der Mehrheitsgesellschaft und die Möglichkeiten der Intervention Sozialer Arbeit. Die zentrale Hypothese lautet, dass Antiziganismus einen Auftrag für Soziale Arbeit darstellt. Die Arbeit verfolgt eine deduktive Vorgehensweise und zielt auf Sensibilisierung für Diskriminierungsformen und Reflexion von Vorurteilen ab, um Sozialarbeitern eine Basis für Selbstreflexion und Handlungsorientierung zu bieten.
- Diskriminierung von Sinti und Roma auf individueller, institutioneller und struktureller Ebene
- Mechanismen und Funktionen antiziganistischer Vorurteile
- Relevanz des Antiziganismus für die Soziale Arbeit
- Handlungsmöglichkeiten und Thematisierungsschnittstellen Sozialer Arbeit im Kontext des Antiziganismus
- Formulierung eines fundierten Handlungsauftrags für Soziale Arbeit im Hinblick auf die soziale Stellung der Sinti und Roma
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der gesellschaftlichen Diskriminierung von Sinti und Roma ein und benennt gängige Vorurteile. Sie skizziert den Forschungsansatz der Arbeit, der die Ausgrenzungsmechanismen, ihre Verankerung in der Gesellschaft und die Rolle der Sozialen Arbeit beleuchtet. Die zentrale Hypothese, dass Antiziganismus einen Auftrag für Soziale Arbeit darstellt, wird formuliert. Die Arbeit gliedert sich in verschiedene Kapitel, die sukzessive einen Zugang zu diesem komplexen Thema ermöglichen.
Deskriptive Einführung: Dieses Kapitel liefert Vorbemerkungen zur Sprache und zum gesellschaftlichen Kontext. Es charakterisiert Sinti und Roma kurz und skizziert ihre historische Entwicklung bis zum aktuellen Status Quo in Deutschland. Die soziologische Definition von Diskriminierung nach Degener et al. (2008) wird als Grundlage vorgestellt, ebenso wie die Betrachtung diskriminierender Handlungen und Haltungen im Rahmen der Verhaltenskomponente von Vorurteilen nach Turner/Hewstone (2012). Es wird die Verwendung der Begriffe "Romgruppen", "Romvölker" oder "Rombevölkerung" zur Vereinfachung erläutert.
Darstellung der Diskriminierung von Sinti und Roma in Deutschland: Dieses Kapitel untersucht die Diskriminierung von Sinti und Roma auf drei Ebenen: individuell, institutionell und strukturell (Degener et al., 2008). Es analysiert konkrete Beispiele und Manifestationen der Diskriminierung auf jeder Ebene, um ein umfassendes Bild der Herausforderungen zu zeichnen, mit denen Sinti und Roma in Deutschland konfrontiert sind. Die Kapitelteile beleuchten die verschiedenen Formen der Diskriminierung und ihre Auswirkungen auf das Leben der Betroffenen.
Die Wirkungszusammenhänge der antiziganistischen Vorurteilsstruktur: Dieses Kapitel analysiert die Entstehung und die Funktionen von Vorurteilen im Kontext des Antiziganismus. Es untersucht die Mechanismen, die zu antiziganistischen Vorurteilen führen und deren Auswirkungen auf die Gesellschaft. Es beleuchtet die Rolle von Stereotypen und erklärt, wie diese Vorurteile aufrechterhalten und verstärkt werden. Ziel ist es, Sozialarbeitern eine reflexive Handlungsbasis zu ermöglichen, indem die Mechanismen antiziganistischer Diskriminierung transparent gemacht werden.
Die Relevanz des Antiziganismus für die Soziale Arbeit: Dieses Kapitel hebt die Bedeutung des Antiziganismus für die Soziale Arbeit hervor. Es argumentiert, warum die Bekämpfung von Antiziganismus ein wichtiger Bestandteil sozialarbeiterischer Tätigkeit sein muss und welche konkreten Auswirkungen die Diskriminierung auf die Lebenswirklichkeit der Betroffenen hat. Es werden die Herausforderungen und Chancen der Sozialen Arbeit in diesem Kontext beleuchtet.
Antiziganismus als Auftrag Sozialer Arbeit: Der Schwerpunkt dieses Kapitels liegt auf der Bestimmung des Auftrags für Soziale Arbeit im Kontext des Antiziganismus. Es werden konkrete Handlungsmöglichkeiten und Schnittstellen für die Soziale Arbeit auf verschiedenen Ebenen aufgezeigt. Die Kapitelteile beleuchten die Rolle der Sozialen Arbeit bei der Bekämpfung von Antiziganismus und die notwendigen Strategien und Maßnahmen.
Schlüsselwörter
Antiziganismus, Diskriminierung, Sinti und Roma, Soziale Arbeit, Vorurteile, Stereotype, institutionelle Diskriminierung, strukturelle Diskriminierung, individuelle Diskriminierung, Minderheiten, gesellschaftliche Ausgrenzung, Handlungsauftrag, Reflexion, Sensibilisierung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Bachelorarbeit: Antiziganismus und Soziale Arbeit
Was ist der Gegenstand dieser Bachelorarbeit?
Die Arbeit untersucht die Ausgrenzungs- und Abwertungsmechanismen gegenüber Sinti und Roma in Deutschland. Sie beleuchtet die Verankerung dieser Mechanismen in der Mehrheitsgesellschaft und analysiert Möglichkeiten der Intervention durch die Soziale Arbeit. Die zentrale These lautet, dass Antiziganismus einen Auftrag für die Soziale Arbeit darstellt.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit fokussiert auf die Diskriminierung von Sinti und Roma auf individueller, institutioneller und struktureller Ebene. Weitere Schwerpunkte sind die Mechanismen und Funktionen antiziganistischer Vorurteile, die Relevanz des Antiziganismus für die Soziale Arbeit sowie Handlungsmöglichkeiten und Schnittstellen der Sozialen Arbeit im Kontext des Antiziganismus. Ziel ist die Formulierung eines fundierten Handlungsauftrags für die Soziale Arbeit bezüglich der sozialen Stellung der Sinti und Roma.
Welche Methode wird angewendet?
Die Arbeit verfolgt eine deduktive Vorgehensweise. Sie zielt auf Sensibilisierung für Diskriminierungsformen und Reflexion von Vorurteilen ab, um Sozialarbeitern eine Basis für Selbstreflexion und Handlungsorientierung zu bieten.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in Kapitel, die sukzessive einen Zugang zum Thema ermöglichen: Einleitung, deskriptive Einführung (mit Vorbemerkungen, Kurzcharakterisierung von Sinti und Roma und deren Situation in Deutschland), Darstellung der Diskriminierung auf verschiedenen Ebenen, Analyse der Wirkungszusammenhänge antiziganistischer Vorurteile, Relevanz des Antiziganismus für die Soziale Arbeit und schließlich Antiziganismus als Auftrag Sozialer Arbeit mit konkreten Handlungsempfehlungen. Ein Fazit rundet die Arbeit ab.
Was wird in der deskriptiven Einführung behandelt?
Die deskriptive Einführung liefert Vorbemerkungen zum Kontext und charakterisiert Sinti und Roma kurz. Sie skizziert ihre historische Entwicklung und den aktuellen Status Quo in Deutschland. Es werden relevante soziologische Definitionen von Diskriminierung und Vorurteilen vorgestellt sowie die verwendete Terminologie erläutert.
Wie wird Diskriminierung in der Arbeit betrachtet?
Diskriminierung wird auf drei Ebenen untersucht: individuell, institutionell und strukturell. Die Arbeit analysiert konkrete Beispiele und Manifestationen auf jeder Ebene, um ein umfassendes Bild der Herausforderungen für Sinti und Roma in Deutschland zu zeichnen.
Was wird im Kapitel über die Wirkungszusammenhänge antiziganistischer Vorurteile behandelt?
Dieses Kapitel analysiert die Entstehung und Funktionen von Vorurteilen im Kontext des Antiziganismus. Es untersucht die Mechanismen, die zu antiziganistischen Vorurteilen führen, die Rolle von Stereotypen und wie diese Vorurteile aufrechterhalten und verstärkt werden. Das Ziel ist, Sozialarbeitern eine reflexive Handlungsbasis zu ermöglichen.
Welche Relevanz hat Antiziganismus für die Soziale Arbeit?
Die Arbeit argumentiert, dass die Bekämpfung von Antiziganismus ein wichtiger Bestandteil sozialarbeiterischer Tätigkeit sein muss. Sie beleuchtet die Auswirkungen der Diskriminierung auf die Lebenswirklichkeit Betroffener und die Herausforderungen und Chancen der Sozialen Arbeit in diesem Kontext.
Was sind die zentralen Handlungsempfehlungen für die Soziale Arbeit?
Das Kapitel "Antiziganismus als Auftrag Sozialer Arbeit" zeigt konkrete Handlungsmöglichkeiten und Schnittstellen für die Soziale Arbeit auf verschiedenen Ebenen auf. Es werden Strategien und Maßnahmen zur Bekämpfung von Antiziganismus im Rahmen der Sozialen Arbeit formuliert.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Schlüsselwörter sind: Antiziganismus, Diskriminierung, Sinti und Roma, Soziale Arbeit, Vorurteile, Stereotype, institutionelle Diskriminierung, strukturelle Diskriminierung, individuelle Diskriminierung, Minderheiten, gesellschaftliche Ausgrenzung, Handlungsauftrag, Reflexion, Sensibilisierung.
Details
- Titel
- Soziale Arbeit im Kontext gesellschaftlicher Diskriminierung von Sinti und Roma in Deutschland
- Hochschule
- Fachhochschule Münster
- Note
- 1,3
- Autor
- Nadin Linz (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2016
- Seiten
- 62
- Katalognummer
- V336387
- ISBN (eBook)
- 9783668261242
- ISBN (Buch)
- 9783668261259
- Dateigröße
- 1315 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Sinti Roma Diskriminierung Zigeuner Antiziganismus Funktionen Gesellschaft Kulturrassismus Ablehnung Soziale Arbeit Ethnizität Vorurteile Stigma Ressentiment Minderheit Ausgrenzung Abwertung Reflexion
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 31,99
- Preis (Book)
- US$ 44,99
- Arbeit zitieren
- Nadin Linz (Autor:in), 2016, Soziale Arbeit im Kontext gesellschaftlicher Diskriminierung von Sinti und Roma in Deutschland, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/336387
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-