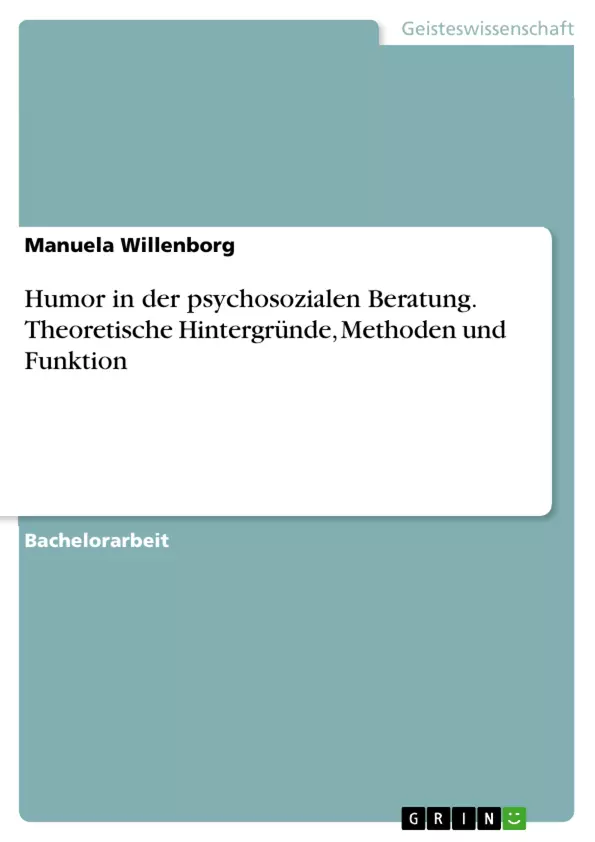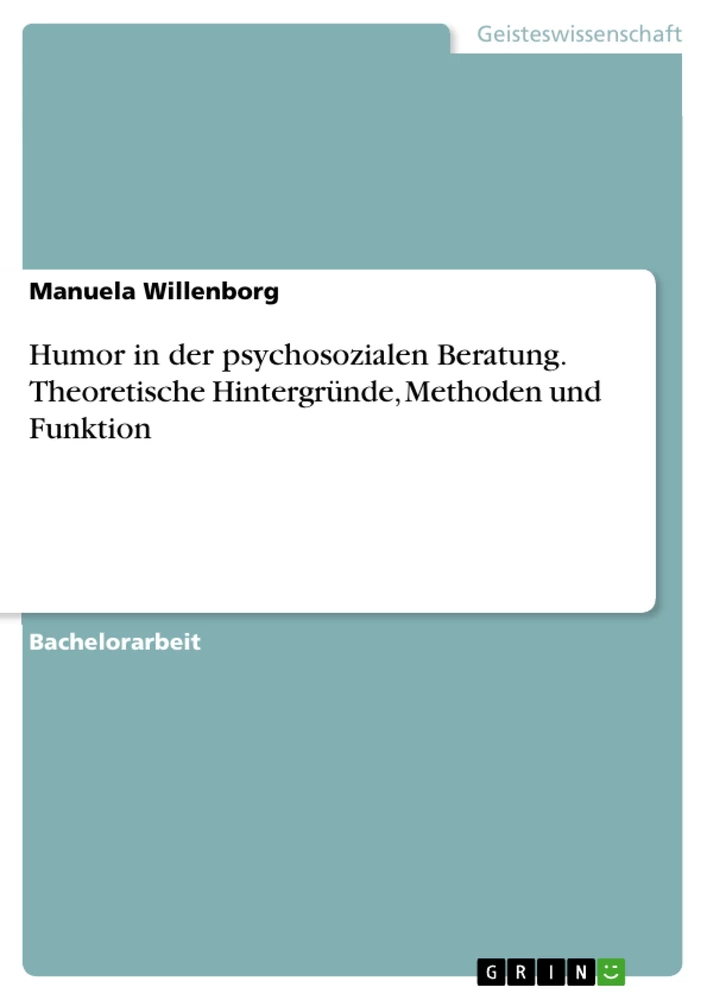
Humor in der psychosozialen Beratung. Theoretische Hintergründe, Methoden und Funktion
Bachelorarbeit, 2016
59 Seiten, Note: 1,3
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Humor
- Humor - eine begriffliche Annäherung
- Facetten des Humors
- Komik
- Witz
- Ironie
- Sarkasmus
- Zynismus
- Schwarzer Humor/Galgenhumor
- Zwischenfazit
- Humortheoretische Aspekte
- Psychologische Theorien
- Soziale Theorien
- Inkongruenztheorien
- Überlegenheits- und Agressionstheorien
- Spieltheorien
- Zwischenfazit
- Funktionen von Humor
- Erleichterung der Kommunikation
- Soziale Funktion
- Psychologische Funktion
- Didaktische Funktion
- Zwischenfazit
- Humor und die Einbettung in Konzepte
- Psychosoziale Beratung
- Definition
- Kennzeichen psychosozialer Beratung
- Felder psychosozialer Beratung
- Psychosoziale Beratung und Psychotherapie – ein Vergleich
- Zwischenfazit
- Humor in der Psychotherapie
- Sigmund Freud - Psychoanalyse
- Alfred Adler Individualpsychologie
- Viktor Frankl - Logotherapie
- Waleed Anthony Salameh - Integrative Kurzzeittherapie (ISTP)
- Zwischenfazit
- Vorstellung und Vertiefung zweier Methoden
- Paradoxe Intention
- Provokative Therapie und Provokativer Stil (ProSt)
- Therapeutischer Humor in der psychosozialen Beratung
- Haltung des Beraters
- Humortechniken
- Empirische Untersuchungen zu Therapeutischem Humor
- Grenzen von Humor in der psychosozialen Beratung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Bedeutung von Humor in der psychosozialen Beratung. Ziel ist es, das Phänomen Humor zu definieren, seine Facetten und Funktionen zu analysieren und seine Einbettung in ressourcenorientierte Konzepte der Sozialen Arbeit aufzuzeigen.
- Definition und Analyse von Humor
- Funktionen von Humor in der Kommunikation, im sozialen und psychologischen Kontext
- Einbettung von Humor in ressourcenorientierte Konzepte der Sozialen Arbeit
- Humor in der psychosozialen Beratung und Psychotherapie
- Anwendung von Humortechniken in der psychosozialen Beratung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema Humor und seine Bedeutung in der psychosozialen Beratung ein. Das zweite Kapitel widmet sich der Definition und Analyse von Humor, seinen Facetten und seinen theoretischen Grundlagen. Im dritten Kapitel werden die Funktionen von Humor in der Kommunikation, im sozialen und psychologischen Kontext sowie im didaktischen Bereich beleuchtet. Kapitel 4 behandelt die Einbettung von Humor in ressourcenorientierte Konzepte der Sozialen Arbeit. Kapitel 5 bietet eine Einführung in die psychosoziale Beratung, ihre Definition, Kennzeichen und Felder. Kapitel 6 vergleicht die psychosoziale Beratung mit der Psychotherapie. Kapitel 7 untersucht die Bedeutung von Humor in der Psychotherapie und stellt verschiedene Ansätze vor, die Humor in der Therapie integrieren. Kapitel 8 stellt zwei Methoden vor, die Humor in der Therapie einsetzen: die Paradoxe Intention und die Provokative Therapie. Kapitel 9 analysiert den therapeutischen Humor in der psychosozialen Beratung und beleuchtet die Haltung des Beraters, Humortechniken, empirische Untersuchungen zu therapeutischem Humor sowie die Grenzen von Humorinterventionen. Das Fazit fasst die wichtigsten Erkenntnisse der Arbeit zusammen.
Schlüsselwörter
Humor, psychosoziale Beratung, Psychotherapie, soziale Arbeit, Ressourcenorientierung, Kommunikation, Funktionen von Humor, Humortechniken, empirische Untersuchungen, Grenzen von Humor.
Details
- Titel
- Humor in der psychosozialen Beratung. Theoretische Hintergründe, Methoden und Funktion
- Hochschule
- Fachhochschule Münster (Soziale Arbeit)
- Note
- 1,3
- Autor
- Manuela Willenborg (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2016
- Seiten
- 59
- Katalognummer
- V336562
- ISBN (eBook)
- 9783668263017
- ISBN (Buch)
- 9783668263024
- Dateigröße
- 1340 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Humor Psychosoziale Beratung Beratung Humortheoretische Aspekte Funktionen von Humor Humor in der Psychotherapie Therapeutischer Humor Psychosoziale Beratung und Therapie- ein Vergleich
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 20,99
- Preis (Book)
- US$ 29,99
- Arbeit zitieren
- Manuela Willenborg (Autor:in), 2016, Humor in der psychosozialen Beratung. Theoretische Hintergründe, Methoden und Funktion, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/336562
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-