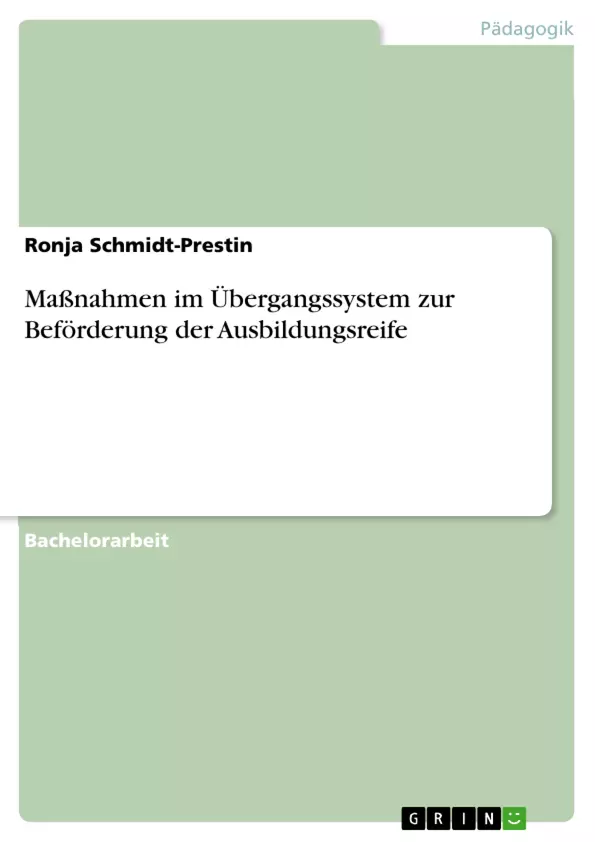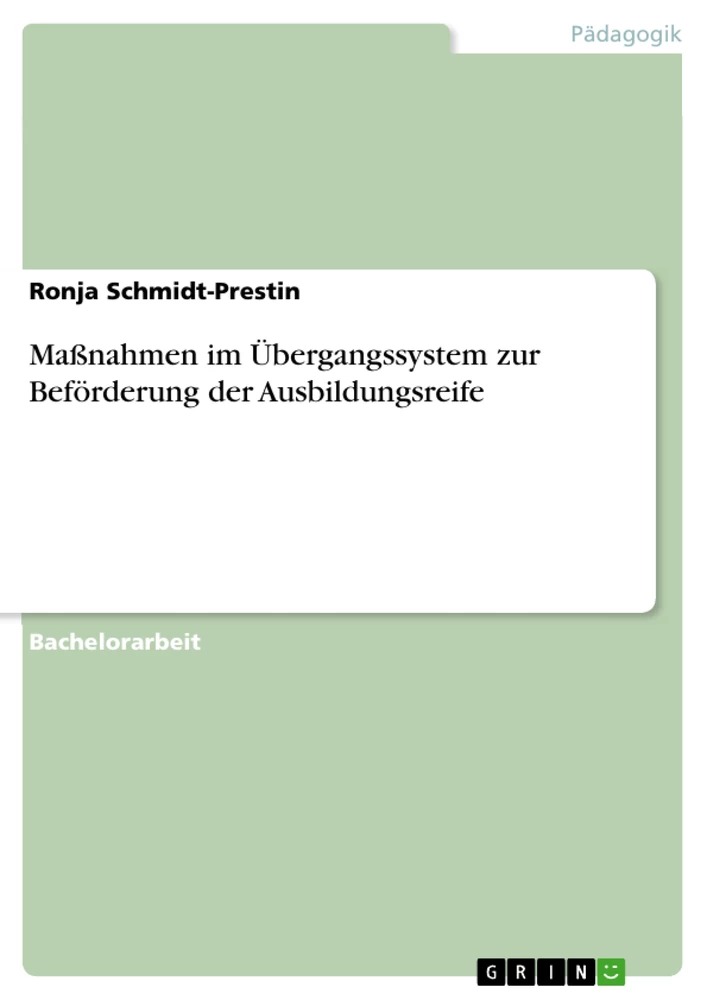
Maßnahmen im Übergangssystem zur Beförderung der Ausbildungsreife
Bachelorarbeit, 2013
53 Seiten, Note: 1,7
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Problemstellung
- Vorgehensweise
- Die Lage von Jugendlichen beim Übergang Schule - Beruf
- Der demografische Wandel
- Daten und Fakten zum Ausbildungsmarkt
- Das Konzept der Ausbildungsreife
- Abgrenzung zu anderen Begrifflichkeiten
- Ausbildungsreife nach dem Konzept der Bundesagentur für Arbeit
- Andere Konzepte zur Ausbildungsreife
- Das Übergangssystem in Deutschland
- Was verbirgt sich hinter dem Übergangssystem?
- Maßnahmen im Übergangssystem
- Berufsvorbereitung durch die Länder
- Berufsvorbereitung durch die Bundesagentur für Arbeit
- Sonstige Berufsvorbereitung
- Vergleich zweier divergierender Maßnahmen
- Begründung der Entscheidung
- Die einjährige Berufsfachschule
- Die Einstiegsqualifizierung
- Beförderung der Ausbildungsreife in den Maßnahmen
- Ausbildungsreife in der einjährigen Berufsfachschule
- Ausbildungsreife in der Einstiegsqualifizierung
- Ergebnis des Vergleichs
- Herausforderungen für das Übergangssystem
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Bachelorarbeit befasst sich mit Maßnahmen im Übergangssystem, die die Ausbildungsreife von Jugendlichen fördern sollen. Sie analysiert die aktuelle Situation von Jugendlichen beim Übergang von der Schule in den Beruf und beleuchtet die Bedeutung der Ausbildungsreife als Voraussetzung für eine erfolgreiche Berufslaufbahn.
- Der demografische Wandel und seine Auswirkungen auf den Ausbildungsmarkt
- Verschiedene Konzepte der Ausbildungsreife und deren Bedeutung für die Berufswahl
- Maßnahmen im Übergangssystem, die die Ausbildungsreife fördern sollen
- Vergleich zweier Maßnahmen: Einjährige Berufsfachschule und Einstiegsqualifizierung
- Herausforderungen für das Übergangssystem und zukünftige Entwicklungen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, in der die Problemstellung und die Vorgehensweise der Arbeit erläutert werden. Im zweiten Kapitel wird die Lage von Jugendlichen beim Übergang Schule - Beruf beleuchtet, wobei der demografische Wandel und die aktuelle Situation auf dem Ausbildungsmarkt im Fokus stehen. Kapitel 3 widmet sich dem Konzept der Ausbildungsreife, wobei verschiedene Definitionen und Konzepte vorgestellt und kritisch betrachtet werden. Im darauffolgenden Kapitel wird das Übergangssystem in Deutschland näher beleuchtet, wobei verschiedene Maßnahmen im Übergangssystem vorgestellt und verglichen werden. Im fünften Kapitel werden die Maßnahmen Einjährige Berufsfachschule und Einstiegsqualifizierung hinsichtlich ihrer Eignung zur Förderung der Ausbildungsreife analysiert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Ausbildungsreife, Übergangssystem, Berufsvorbereitung, Berufsfachschule, Einstiegsqualifizierung, demografischer Wandel, Ausbildungsmarkt, Bildungspolitik und Bildungsforschung.
Details
- Titel
- Maßnahmen im Übergangssystem zur Beförderung der Ausbildungsreife
- Hochschule
- Carl von Ossietzky Universität Oldenburg (Berufs- und Wirtschaftspädagogik)
- Note
- 1,7
- Autor
- Ronja Schmidt-Prestin (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2013
- Seiten
- 53
- Katalognummer
- V337656
- ISBN (eBook)
- 9783668269217
- ISBN (Buch)
- 9783668269224
- Dateigröße
- 911 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- maßnahmen übergangssystem beförderung ausbildungsreife
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 20,99
- Preis (Book)
- US$ 29,99
- Arbeit zitieren
- Ronja Schmidt-Prestin (Autor:in), 2013, Maßnahmen im Übergangssystem zur Beförderung der Ausbildungsreife, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/337656
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-