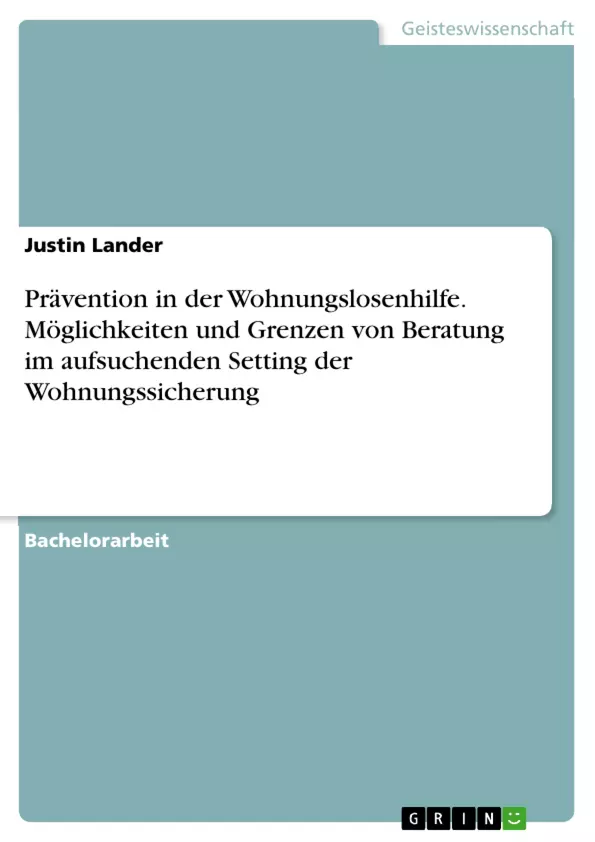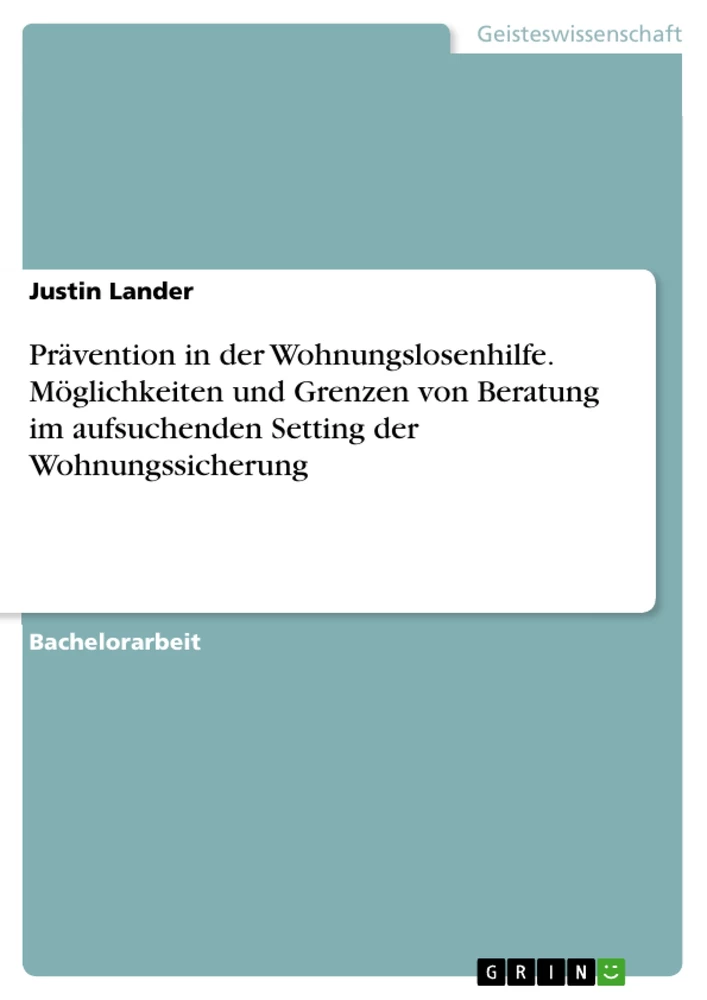
Prävention in der Wohnungslosenhilfe. Möglichkeiten und Grenzen von Beratung im aufsuchenden Setting der Wohnungssicherung
Bachelorarbeit, 2016
36 Seiten
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Begriffsdefinitionen
- 2.1 Wohnungslosigkeit
- 2.2 Prävention
- 2.3 Beratung
- 3. Fachlich- Methodische Ausarbeitung
- 3.1 Einordnung der Präventionstheorie in die Praxis der Wohnungslosenhilfe
- 3.2 Aufsuchende Hilfen in der Wohnungssicherung
- 3.3 Möglichkeiten und Grenzen einer Beratung im aufsuchenden Setting
- 4. Prävention in der Praxis – Die „, Mobile Mieterhilfe\"\n-\n4.1 Die,,MMH❝ zwischen den Stühlen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert die Möglichkeiten und Grenzen von Beratung im aufsuchenden Setting der Wohnungssicherung. Dabei wird untersucht, ob und inwiefern Beratungsangebote in Form von aufsuchenden Hilfen ein geeignetes Mittel zur Verhinderung von Wohnungslosigkeit darstellen.
- Definition von Wohnungslosigkeit und Prävention im Kontext der Wohnungslosenhilfe
- Einordnung der Präventionstheorie in die Praxis der Wohnungslosenhilfe
- Analyse der Möglichkeiten und Grenzen von Beratung im aufsuchenden Setting
- Bewertung der „Mobilen Mieterhilfe“ als Beispiel für aufsuchende Hilfen in der Wohnungssicherung
- Zusammenhang zwischen aufsuchender Beratung und dem Erhalt von Wohnraum
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung: Die Einleitung stellt die Thematik der Arbeit vor und erläutert die Relevanz von Beratung im aufsuchenden Setting der Wohnungssicherung. Sie beleuchtet die Forschungslücke bezüglich aufsuchender Hilfen in der Wohnungslosenhilfe und führt das persönliche Interesse des Autors an der Thematik aus.
- Kapitel 2: Begriffsdefinitionen: Dieses Kapitel definiert die zentralen Begriffe der Arbeit, wie Wohnungslosigkeit, Prävention und Beratung, und stellt sie in einen allgemeinen Kontext.
- Kapitel 3: Fachlich- Methodische Ausarbeitung: Dieses Kapitel analysiert die Einordnung der Präventionstheorie in die Praxis der Wohnungslosenhilfe. Es betrachtet die Besonderheiten von aufsuchenden Hilfen in der Wohnungssicherung und eruiert die Möglichkeiten und Grenzen von Beratung im aufsuchenden Setting.
- Kapitel 4: Prävention in der Praxis – Die „, Mobile Mieterhilfe\"\n-\n4.1 Die,,MMH❝ zwischen den Stühlen: Dieses Kapitel analysiert die Konzeption der „Mobilen Mieterhilfe“ als Beispiel für ein präventives aufsuchendes Angebot in der Wohnungssicherung. Es untersucht die praktische Umsetzung und die Herausforderungen, denen die „MMH“ begegnet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen Wohnungslosigkeit, Prävention, Beratung, aufsuchende Hilfen, Wohnungssicherung und die „Mobile Mieterhilfe“. Sie untersucht die Möglichkeiten und Grenzen von Beratung im aufsuchenden Setting der Wohnungslosenhilfe und analysiert die praktische Umsetzung von Präventionsmaßnahmen im Bereich der Wohnungssicherung.
Details
- Titel
- Prävention in der Wohnungslosenhilfe. Möglichkeiten und Grenzen von Beratung im aufsuchenden Setting der Wohnungssicherung
- Autor
- Justin Lander (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2016
- Seiten
- 36
- Katalognummer
- V339632
- ISBN (eBook)
- 9783668339491
- ISBN (Buch)
- 9783668339507
- Dateigröße
- 1571 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Wohnungssicherung Wohnungslosigkeit Wohnungslosenhilfe Sozialarbeit
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 16,99
- Preis (Book)
- US$ 19,99
- Arbeit zitieren
- Justin Lander (Autor:in), 2016, Prävention in der Wohnungslosenhilfe. Möglichkeiten und Grenzen von Beratung im aufsuchenden Setting der Wohnungssicherung, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/339632
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-