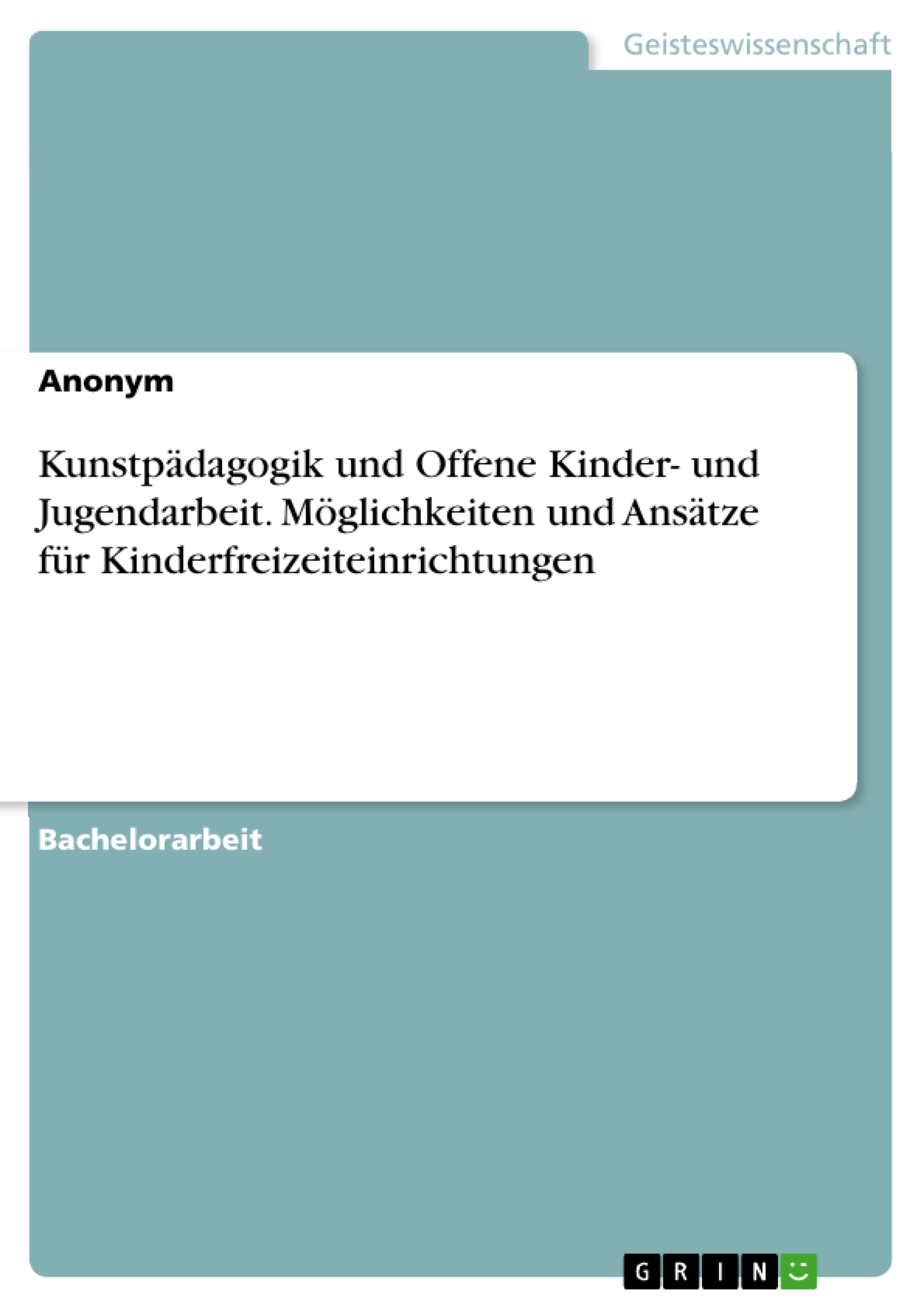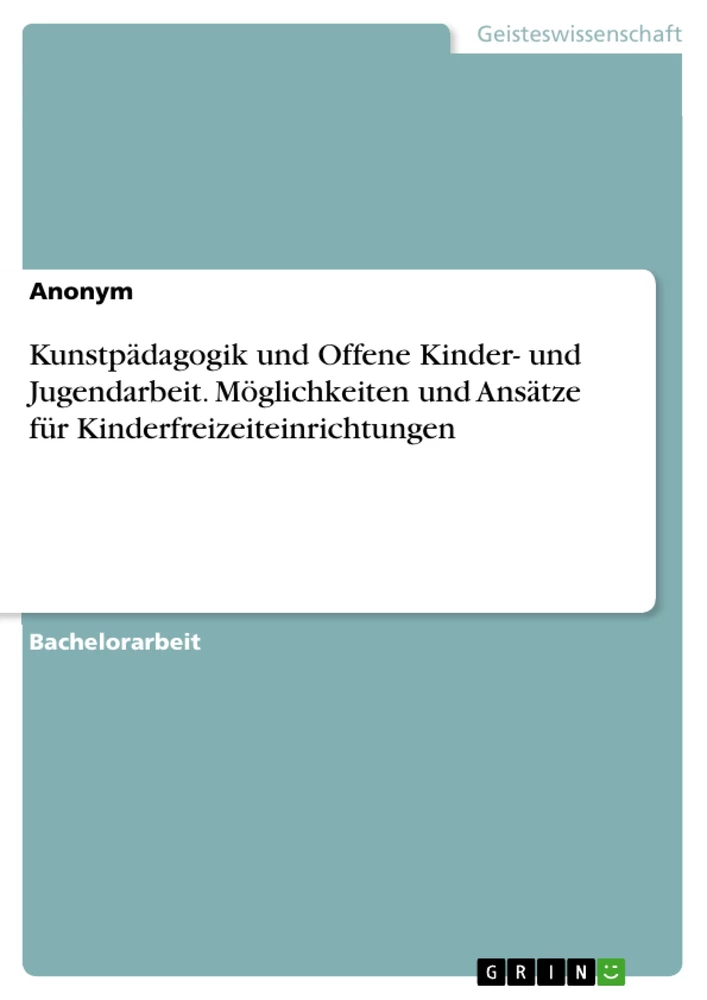
Kunstpädagogik und Offene Kinder- und Jugendarbeit. Möglichkeiten und Ansätze für Kinderfreizeiteinrichtungen
Bachelorarbeit, 2016
54 Seiten, Note: 1,3
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Offene Kinder- und Jugendarbeit
- Rechtliche Grundlagen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit
- Prinzipien und Einrichtungstypen
- Die Freizeiteinrichtung als Ort informeller und non-formaler Bildung
- Informelle und non-formale Bildung
- Möglichkeiten non-formaler Förderung
- Anbieten
- Aufgreifen
- Wahrnehmen und Beantworten
- Bildungsgelegenheit: Jugendarbeit als Ort ästhetischer Selbstinszenierung
- Bildungsgelegenheit: Jugendarbeit als Aneignungsort für Kompetenzen
- Gestaltung des Ortes als Aneignungs- und Bildungsraum
- Kulturelle Bildung
- Inhaltliche und strukturelle Vielfalt Kultureller Bildung
- Grundlagen kultureller Bildung und Bezug zur Offenen Kinder- und Jugendarbeit
- Zwischenfazit
- Kunstpädagogik
- Ästhetische Erfahrung
- Kunstpädagogische Positionen
- Bildorientierung
- Kunstorientierung
- Subjektorientierung
- Sprachorientierung
- KEKS & Co.
- Möglichkeiten und Ansätze für Kinderfreizeiteinrichtungen
- Anbieten
- Aufgreifen
- Rahmenbedingungen schaffen
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Frage, ob und wie klassische Kinderfreizeiteinrichtungen, die sich nicht auf kulturelle Angebote spezialisiert haben, die kulturelle Bildung von Kindern fördern können. Die Arbeit untersucht, welche Möglichkeiten und Ansätze es gibt, um die kulturelle Bildung im Rahmen des Alltags in Kinderfreizeiteinrichtungen zu fördern und wie die Kunstpädagogik dazu beitragen kann.
- Rechtliche Grundlagen und Prinzipien der Offenen Kinder- und Jugendarbeit
- Die Rolle der Freizeiteinrichtung als Ort informeller und non-formaler Bildung
- Bedeutung kultureller Bildung in der Offenen Kinder- und Jugendarbeit
- Aktuelle Positionen und Ansätze der Kunstpädagogik
- Möglichkeiten und Ansätze für die Förderung kultureller Bildung in Kinderfreizeiteinrichtungen
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in die Thematik der kulturellen Bildung in Kinderfreizeiteinrichtungen ein und stellt die Forschungsfrage sowie die Zielsetzung der Arbeit dar. Im zweiten Kapitel werden die rechtlichen Grundlagen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit erläutert, ihre Prinzipien und Einrichtungstypen vorgestellt und die Freizeiteinrichtung als Ort informeller und non-formaler Bildung betrachtet. Kapitel drei widmet sich der Kulturellen Bildung, ihren Inhalten und Strukturen sowie ihren Bezügen zur Offenen Kinder- und Jugendarbeit. Im vierten Kapitel werden verschiedene Positionen und Ansätze der Kunstpädagogik vorgestellt, die sich in die Bild-, Kunst-, Subjekt- und Sprachorientierung einteilen lassen. Das fünfte Kapitel fasst die Möglichkeiten non-formaler Förderung zusammen und präsentiert Ideen aus der Kunstpädagogik sowie weitere Ansätze für die Förderung kultureller Bildung in Kinderfreizeiteinrichtungen.
Schlüsselwörter
Offene Kinder- und Jugendarbeit, Freizeiteinrichtung, informelle Bildung, non-formale Bildung, kulturelle Bildung, Kunstpädagogik, ästhetische Erfahrung, Bildende Kunst, Medien, Förderungsmöglichkeiten, Ansätze.
Details
- Titel
- Kunstpädagogik und Offene Kinder- und Jugendarbeit. Möglichkeiten und Ansätze für Kinderfreizeiteinrichtungen
- Hochschule
- Fliedner Fachhochschule Düsseldorf
- Veranstaltung
- Ästhetische Bildung
- Note
- 1,3
- Autor
- Anonym (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2016
- Seiten
- 54
- Katalognummer
- V340690
- ISBN (eBook)
- 9783668301191
- ISBN (Buch)
- 9783668301207
- Dateigröße
- 2613 KB
- Sprache
- Deutsch
- Anmerkungen
- Bitte anonym veröffentlichen!
- Schlagworte
- Kunstpädagogik ästhetische Bildung kulturelle Bildung Bildorientierung Kunstorientierung Subjektorientierung Sprachorientierung Museumspädagogik offene Kinder- und Jugendarbeit Jugendarbeit Freizeiteinrichtung Jugendzentrum Freizeitpädagogik außerschulische Jugendbildung Kinderfreizeiteinrichtung informelle Bildung nonformale Bildung Jugendkunstschule Jugendkulturzentrum Soziokultrelles Zentrum KEKS Sturzenhecker Aneignungsprozesse Kunsterziehung Kunstunterricht Kunst kulturelle Kinder- und Jugendarbeit kulturelle Jugendarbeit Bildungsprojekt kreativ Kreativität Freizeitangebot ästhetische Selbstinszenierung Bildungsgelegenheit Aneignungsort Ästhetische Raumaneignung Gestaltungspädagogik Kunstvermittlung Gunter Otto vs. Gert Selle Gunter Otto Georg Peez Gert Selle Kunibert Bering Rolf Niehoff Kunstdidaktik Johannes Kirschenmann Kreativangebot Kreativangebote Medienpädagogik Ästhetische Erfahrung kunstpädagogische Positionen Ästhetische Erziehung Carl-Peter Buschkühle künstlerische Bildung künstlerisches Projekt Helga Kämpf-Jansen ästhetische Forschung Bildgespräch Kunstpädagoge Museumspädagoge Playing Arts
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 20,99
- Preis (Book)
- US$ 29,99
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2016, Kunstpädagogik und Offene Kinder- und Jugendarbeit. Möglichkeiten und Ansätze für Kinderfreizeiteinrichtungen, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/340690
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-