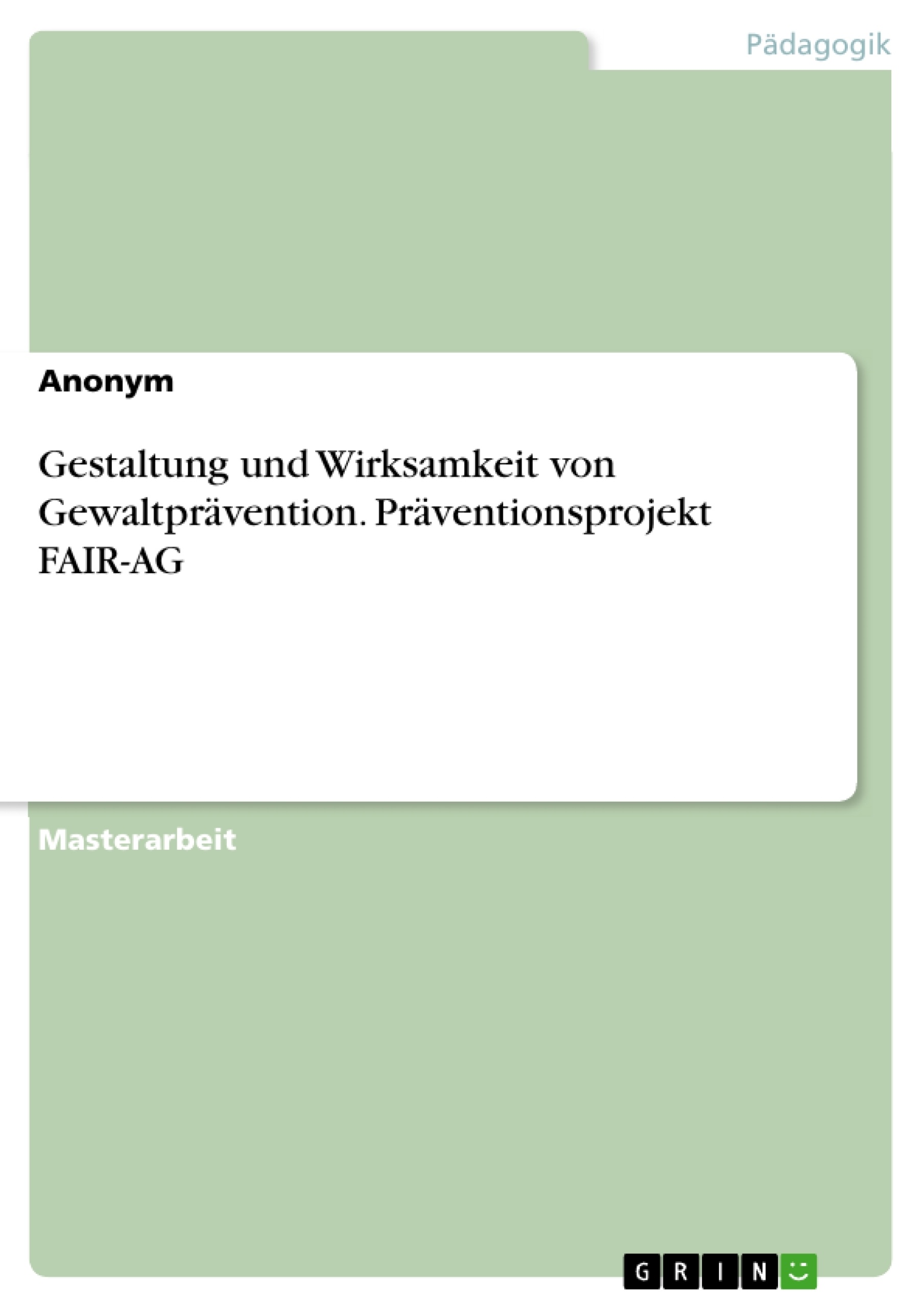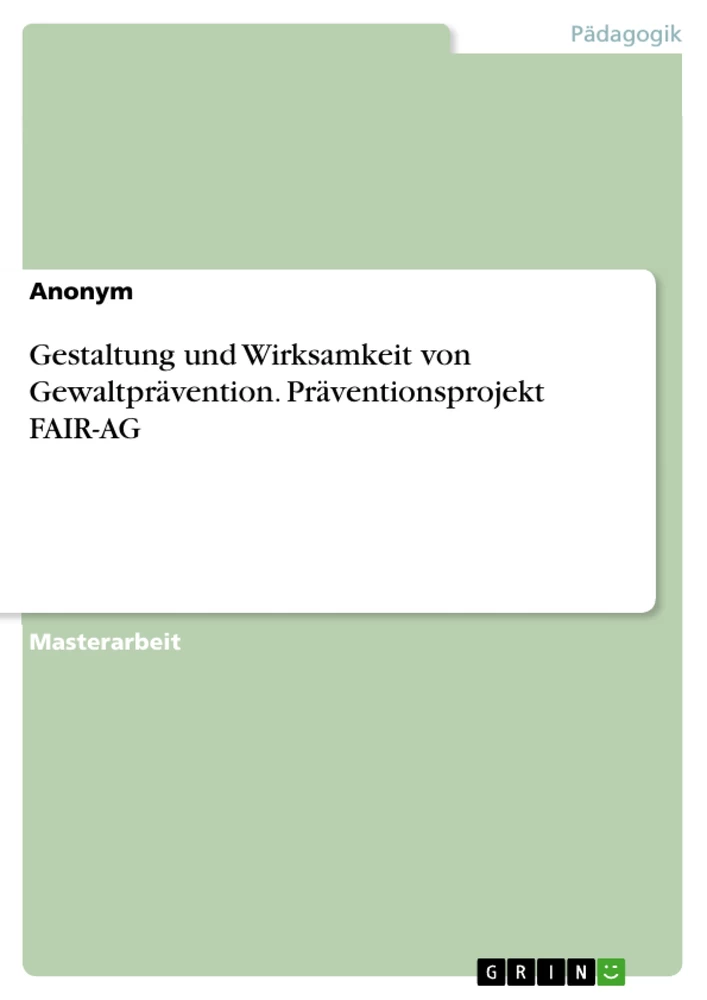
Gestaltung und Wirksamkeit von Gewaltprävention. Präventionsprojekt FAIR-AG
Masterarbeit, 2015
275 Seiten, Note: 1,0
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung – Zur öffentlichen Diskussion um Schule und Gewalt
- 1.1 Zugrundeliegende Motivation
- 1.2 Wissenschaftliche Fragestellung
- 1.3 Aufbau der wissenschaftlichen Arbeit
- I. Theoretische Grundlagen
- 2. Gewalt im sozialen Kontext – Was ist das eigentlich?
- 2.1 Entwicklungen der schulischen Gewaltforschung
- 2.2 Bedeutung des Gewaltbegriffs für die Grundschule
- 2.2.1 Gewaltformen an Grundschulen
- 2.2.2 Subjektive Gewalteinschätzung von Kindern und Jugendlichen
- 2.2.3 Empirische Ergebnisse schulischer Gewaltforschung
- 2.3 Mobbing ist mehr als nur ein Wort: Einordnung in den Gewaltbegriff
- 2.4 Mobbing in der Schule – ein Alltagsphänomen?
- 2.4.1 Wie äußert sich Mobbing? Beschreibung der Erscheinungsformen
- 2.4.1.1 Physisches Mobbing
- 2.4.1.2 Psychisches Mobbing
- 2.4.2 Mobbing – ein Gruppenphänomen?
- 2.4.2.1 Merkmale des typischen Gewaltopfers
- 2.4.2.2 Merkmale des typischen Gewalttäters
- 2.4.2.3 Typische Mobbingstruktur in Lerngruppen
- 2.4.3 Mögliche Ursachen von Mobbing
- 2.4.3.1 Risiken im sozialen Umfeld und entwicklungspsychologische Bedingungen
- 2.4.3.2 Persönlichkeitsmerkmale und Bewältigungsstile
- 2.4.3.3 Schulische Risiken
- 2.4.4 Folgen von Mobbing
- 3. Prävention und Intervention
- 3.1 Begriffsbestimmungen und Zielsetzungen
- 3.2 Präventionsort Schule – Schule als Sozialisationsinstanz
- 3.2.1 Maßnahmen auf Schulebene (Makroebene)
- 3.2.2 Maßnahmen auf Klassenebene (Mesoebene)
- 3.2.3 Maßnahmen auf persönlicher Ebene (Mikroebene)
- 3.3 Herausforderungen von schulischer Gewaltprävention
- 3.4 Notwendigkeitsanspruch schulischer Gewaltprävention
- 3.4.1 Gewaltverminderung
- 3.4.2 Sozialisationsfunktion der Schule
- 3.4.3 Verminderung der Kosten von Gewalt
- 3.4.4 Rechtliche Rahmenbedingungen
- 3.5 Qualitätskriterien schulischer Gewaltprävention
- 3.5.1 Theoretische und praktische Gestaltung
- 3.5.2 Dokumentation des Programmkonzepts
- 3.5.3 Konzeptspezifizierung und -differenzierung
- 3.5.4 Mehrebenenmodell
- 3.5.5 Frühzeitige Umsetzung
- 3.5.6 Kompetenzen des Personals
- 3.5.7 Regeln und Normen
- 3.5.8 Nachhaltigkeit und Kontinuität
- 3.5.9 Interdisziplinäre Zusammenarbeit
- 3.5.10 Qualitätssicherung und Evaluation
- 3.6 Präventionsprojekte an Grundschulen in Niedersachsen
- 3.6.1 Überblick über aktuelle Präventionsmaßnahmen
- 3.6.2 Vorstellung des Präventionsprogramms FAIR-AG
- 3.6.2.1 Zielgruppe
- 3.6.2.2 Konzept: Inhalte und Methoden
- 3.6.2.3 Zielsetzungen
- 3.6.2.4 Aufbau einer FAIR-AG Stunde
- 3.6.2.5 Abgrenzung zu anderen Programmen: individuelle Besonderheiten
- 3.6.2.6 Voraussetzungen und Gegebenheiten der ... in ...
- II. Empirische Untersuchung: Fallbeispiel FAIR-AG in der ...
- 4. Methodisches Vorgehen
- 4.1 Forschungsbestreben
- 4.2 Forschungsfragen und Hypothesen
- 4.2.1 Fragestellung in Bezug auf die Realisierung von Zielen der FAIR-AG
- 4.2.2 Fragestellung nach der Akzeptanz und Motivation seitens der Zielgruppe
- 4.2.3 Fragestellung nach der Reichweite der FAIR-AG
- 4.3 Erhebungsmethodik und -instrumente
- 4.3.1 Eingesetzte Instrumente zur Prozessevaluation
- 4.3.1.1 P1 Standardisierte Einschätzungsbögen Trainerteam
- 4.3.1.2 P2 Protokollbögen Trainerteam
- 4.3.1.3 P3 (externe) standardisierte Beobachtungsbögen
- 4.3.2 Eingesetzte Instrumente zur Ergebnisevaluation
- 4.3.2.1 E1 Standardisierte Schülerfragebögen
- 4.3.2.2 E2 Teilstandardisierte mündliche Leitfadeninterviews
- 4.3.2.3 E3 Standardisierte Lehrpersonenfragebögen
- 4.3.2.4 E4 Teilstandardisierte schriftliche Experteninterviews
- 4.3.3 Durchführung der Ergebnisevaluation
- 4.3.4 Kritische Reflexion der quantitativen und qualitativen Erhebungsinstrumente
- 4.4 Auswertungsmethodik
- 4.4.1 Auswertung der Prozessevaluation
- 4.4.2 Auswertung der Ergebnisevaluation
- 5. Interpretation und Diskussion der Ergebnisse
- 5.1 Wirksamkeit der Präventionsarbeit der FAIR-AG
- 5.2 Kritische Beleuchtung der Gesamterhebung
- 5.3 Empfehlungen zur Optimierung der FAIR-AG
- 6. Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Masterarbeit untersucht die Gestaltung und Wirksamkeit des Gewaltpräventionsprojekts FAIR-AG an einer Grundschule. Das Hauptziel ist die wissenschaftliche Analyse der Effektivität des Programms im Hinblick auf die Reduzierung von Gewalt und die Förderung sozialer Kompetenzen bei den Schülern.
- Gewaltprävention in der Grundschule
- Wirkungsanalyse des FAIR-AG Programms
- Förderung sozialer Kompetenzen bei Kindern
- Qualitätskriterien schulischer Gewaltprävention
- Interdisziplinäre Zusammenarbeit in der Gewaltprävention
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung – Zur öffentlichen Diskussion um Schule und Gewalt: Die Einleitung beleuchtet die gesellschaftliche Relevanz von Gewalt und Mobbing an Schulen und die zunehmende öffentliche Wahrnehmung dieser Problematik. Sie führt in die Forschungsfrage ein: Inwieweit wirkt sich die Gestaltung der FAIR-AG auf die Wirksamkeit des Präventionsprogramms aus? und begründet die Wahl der Primarstufe als Forschungsschwerpunkt aufgrund des Mangels an Evaluationen in diesem Bereich.
2. Gewalt im sozialen Kontext – Was ist das eigentlich?: Dieses Kapitel definiert den Gewaltbegriff, differenziert zwischen engem und erweitertem Gewaltbegriff, sowie zwischen personaler, struktureller und kultureller Gewalt. Es analysiert interpersonelle und kollektive Gewalt und beleuchtet die besondere Bedeutung von institutioneller Gewalt im schulischen Kontext, inklusive suizidalen Verhaltens. Es schließt mit einer Betrachtung des individuellen Gewaltverständnisses und dessen Auswirkungen auf die Wahrnehmung und Beurteilung von Gewalt an Schulen.
2.1 Entwicklungen der schulischen Gewaltforschung: Dieser Abschnitt skizziert die Entwicklung der schulischen Gewaltforschung über die letzten drei Jahrzehnte. Er beschreibt den Wandel der Forschungsschwerpunkte von allgemeinen Verhaltensauffälligkeiten hin zur Analyse spezifischer Gewaltformen wie Mobbing, Amokläufen und Cybermobbing, und diskutiert die Herausforderungen bei der Erfassung und Bewertung des Ausmaßes schulischer Gewalt.
2.2 Bedeutung des Gewaltbegriffs für die Grundschule: Das Kapitel untersucht die spezifischen Gewaltformen an Grundschulen, die subjektive Gewalteinschätzung von Grundschulkindern und die empirischen Ergebnisse der schulischen Gewaltforschung, insbesondere im Hinblick auf geschlechtsspezifische Unterschiede und soziodemografische Faktoren.
2.3 Mobbing ist mehr als nur ein Wort: Einordnung in den Gewaltbegriff: Hier wird der Begriff "Mobbing" definiert und von anderen Konfliktformen abgegrenzt. Es werden verschiedene Definitionsansätze diskutiert, die typischen Rollen und Strukturen von Mobbingprozessen in Lerngruppen analysiert, und mögliche Ursachen von Mobbing beleuchtet.
2.4 Mobbing in der Schule – ein Alltagsphänomen?: Dieses Kapitel untersucht das Ausmaß von Mobbing an Schulen, beschreibt die verschiedenen Erscheinungsformen von physischem und psychischem Mobbing und analysiert die Folgen von Mobbing für die Betroffenen.
3. Prävention und Intervention: Dieses Kapitel behandelt die Konzepte von Prävention und Intervention im Umgang mit Gewalt und Mobbing an Schulen. Es definiert die Begriffe und erläutert deren Zielsetzungen auf verschiedenen Ebenen (primär, sekundär, tertiär). Der Schwerpunkt liegt auf der Prävention, wobei die Schule als Sozialisationsinstanz eine zentrale Rolle einnimmt.
3.1 Begriffsbestimmungen und Zielsetzungen: Dieses Unterkapitel definiert die Begriffe Prävention und Intervention und beschreibt deren Ziele im Kontext schulischer Gewaltprävention.
3.2 Präventionsort Schule – Schule als Sozialisationsinstanz: Der Abschnitt erörtert die Rolle der Schule als Präventionsort und beschreibt Maßnahmen auf der Makroebene (Schulebene), Mesoebene (Klassenebene) und Mikroebene (persönliche Ebene).
3.3 Herausforderungen von schulischer Gewaltprävention: Dieses Kapitel beschreibt die Herausforderungen bei der Umsetzung von Gewaltprävention an Schulen, wie z.B. Zeitmangel, fehlende Ressourcen, mangelnde Sensibilisierung und der Schwierigkeit, langfristige Erfolge zu erzielen.
3.4 Notwendigkeitsanspruch schulischer Gewaltprävention: Dieser Abschnitt begründet den Notwendigkeitsanspruch von Gewaltprävention an Schulen aus verschiedenen Perspektiven: Gewaltverminderung, Sozialisationsfunktion, Kostenminimierung und rechtliche Rahmenbedingungen.
3.5 Qualitätskriterien schulischer Gewaltprävention: Das Kapitel beschreibt Qualitätskriterien für effektive Gewaltpräventionsprogramme, unter anderem theoretische und praktische Gestaltung, Dokumentation, Konzeptspezifizierung, Mehrebenenmodell, frühzeitige Umsetzung, Kompetenzen des Personals, Regeln und Normen, Nachhaltigkeit, interdisziplinäre Zusammenarbeit und Qualitätssicherung.
3.6 Präventionsprojekte an Grundschulen in Niedersachsen: Dieser Abschnitt gibt einen Überblick über aktuelle Präventionsprojekte an Grundschulen in Niedersachsen und stellt das FAIR-AG Programm detailliert vor.
4. Methodisches Vorgehen: Dieses Kapitel beschreibt die Methodik der empirischen Untersuchung. Es erläutert das Forschungsbestreben, die Forschungsfragen, die Hypothesen, die Erhebungsmethoden (quantitative und qualitative) und die Auswertungsmethodik.
5. Interpretation und Diskussion der Ergebnisse: Dieses Kapitel interpretiert die Ergebnisse der Prozessevaluation und Ergebnisevaluation, verifiziert bzw. falsifiziert die Hypothesen und diskutiert die Wirksamkeit des FAIR-AG Programms.
Schlüsselwörter
Gewaltprävention, Schulgewalt, Mobbing, FAIR-AG, Grundschule, Sozialkompetenz, Wirkungsanalyse, Qualitätskriterien, Prozessevaluation, Ergebnisevaluation, Methodenvielfalt, Interdisziplinäre Zusammenarbeit, Niedersachsen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Masterarbeit: Gewaltpräventionsprojekt FAIR-AG an Grundschulen in Niedersachsen
Was ist der Gegenstand dieser Masterarbeit?
Die Masterarbeit untersucht die Gestaltung und Wirksamkeit des Gewaltpräventionsprojekts FAIR-AG an einer niedersächsischen Grundschule. Im Fokus steht die wissenschaftliche Analyse der Programmeffektivität hinsichtlich Gewaltreduzierung und Förderung sozialer Kompetenzen bei Schülern.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Das Hauptziel ist die Analyse der Effektivität des FAIR-AG Programms. Die Arbeit beleuchtet Gewaltprävention in der Grundschule, die Wirkungsanalyse des FAIR-AG Programms, die Förderung sozialer Kompetenzen bei Kindern, Qualitätskriterien schulischer Gewaltprävention und die interdisziplinäre Zusammenarbeit in der Gewaltprävention.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Definition von Gewalt im schulischen Kontext, verschiedene Gewaltformen an Grundschulen (inkl. Mobbing), die Entwicklung der schulischen Gewaltforschung, Präventions- und Interventionsstrategien auf verschiedenen Ebenen (Makro-, Meso- und Mikroebene), Qualitätskriterien für Gewaltpräventionsprogramme und eine detaillierte Vorstellung des FAIR-AG Programms.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in einen theoretischen und einen empirischen Teil. Der theoretische Teil umfasst die Definition von Gewalt, die Darstellung der Entwicklung der schulischen Gewaltforschung, die Beschreibung verschiedener Gewaltformen und die Erläuterung von Präventions- und Interventionsansätzen. Der empirische Teil beinhaltet die Methodik der Untersuchung (Prozessevaluation und Ergebnisevaluation), die Darstellung der Ergebnisse und deren Interpretation sowie Schlussfolgerungen und Empfehlungen.
Welche Methoden werden in der empirischen Untersuchung eingesetzt?
Die empirische Untersuchung verwendet sowohl quantitative als auch qualitative Methoden. Dazu gehören standardisierte und teilstandardisierte Fragebögen für Schüler, Lehrer und Experten sowie Protokollbögen und Beobachtungsbögen für das Trainerteam. Die Daten werden mithilfe verschiedener Auswertungsmethoden analysiert.
Welche Ergebnisse werden präsentiert?
Die Arbeit präsentiert die Ergebnisse der Prozessevaluation und Ergebnisevaluation des FAIR-AG Programms. Es wird analysiert, inwieweit das Programm seine Ziele erreicht und welche Faktoren seine Wirksamkeit beeinflussen. Die Ergebnisse werden kritisch beleuchtet und Optimierungsempfehlungen abgeleitet.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Arbeit zieht Schlussfolgerungen zur Wirksamkeit des FAIR-AG Programms und liefert Empfehlungen zur Optimierung des Programms und der schulischen Gewaltprävention im Allgemeinen. Sie trägt dazu bei, das Verständnis für die Herausforderungen der Gewaltprävention an Grundschulen zu verbessern und praxisrelevante Erkenntnisse zu liefern.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Gewaltprävention, Schulgewalt, Mobbing, FAIR-AG, Grundschule, Sozialkompetenz, Wirkungsanalyse, Qualitätskriterien, Prozessevaluation, Ergebnisevaluation, Methodenvielfalt, Interdisziplinäre Zusammenarbeit, Niedersachsen.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Wissenschaftler, Lehrer, Schulverwaltung, Pädagogen, Mitarbeiter von Präventionseinrichtungen und alle, die sich mit dem Thema Gewaltprävention an Grundschulen befassen.
Details
- Titel
- Gestaltung und Wirksamkeit von Gewaltprävention. Präventionsprojekt FAIR-AG
- Hochschule
- Universität Osnabrück
- Note
- 1,0
- Autor
- Anonym (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2015
- Seiten
- 275
- Katalognummer
- V341408
- ISBN (eBook)
- 9783668325081
- ISBN (Buch)
- 9783668325098
- Dateigröße
- 2940 KB
- Sprache
- Deutsch
- Anmerkungen
- inkl. 107 Seiten Anhang
- Schlagworte
- Gewaltprävention Prävention Intervention Gewaltformen Mobbing FAIR-AG Präventionsprogramm Wirksamkeit Prävention Gestaltung Prävention Prozessevaluation Ergebnisevaluation
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 36,99
- Preis (Book)
- US$ 46,99
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2015, Gestaltung und Wirksamkeit von Gewaltprävention. Präventionsprojekt FAIR-AG, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/341408
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-