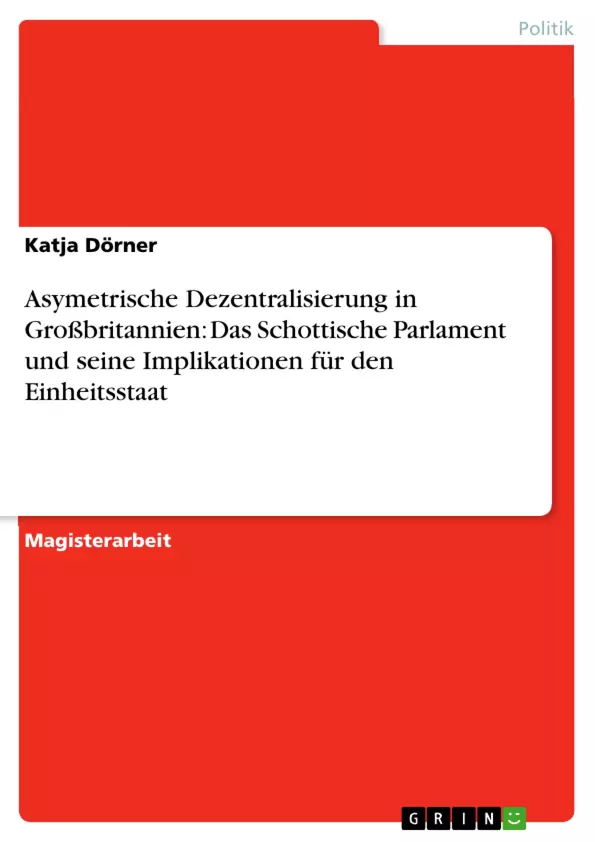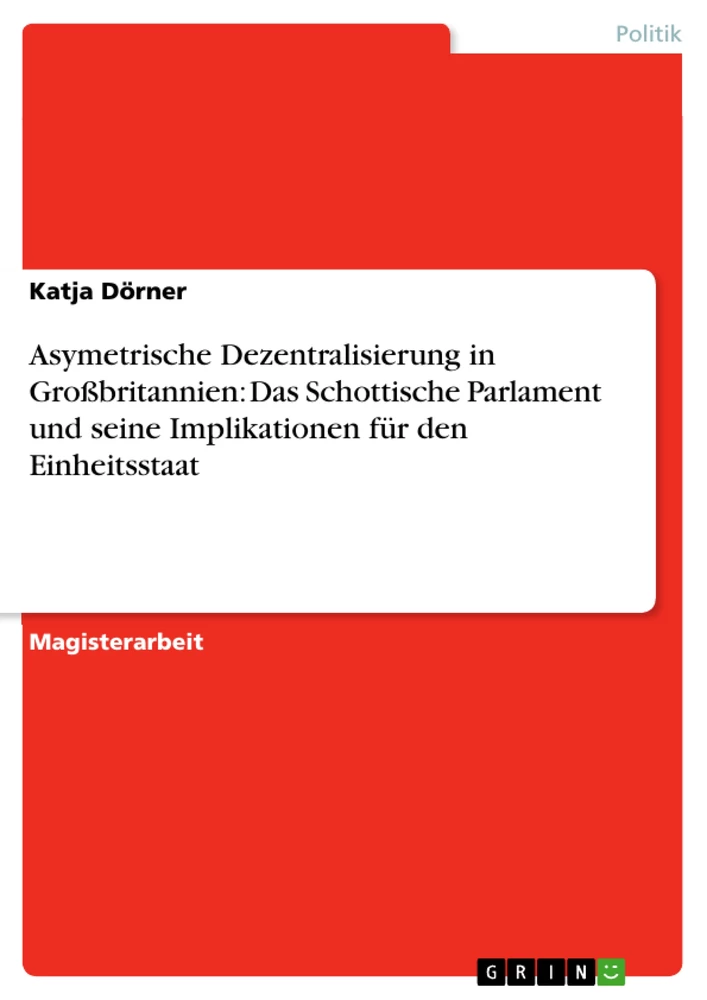
Asymetrische Dezentralisierung in Großbritannien: Das Schottische Parlament und seine Implikationen für den Einheitsstaat
Magisterarbeit, 2000
147 Seiten, Note: 1,0
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Territoriale Politik: Schottlands Stellung in Großbritannien
- 2.1. Schottland in der Union
- 2.1.1. Die Vereinigung der Parlamente
- 2.1.2. „Policies of Accommodation“ – Einbindungsstrategien
- 2.2. Interpretationen der Stellung Schottlands in der Union
- 2.2.1. „Unitary State“ und Souveränität Westminsters
- 2.2.2. „Union State“ und Teilautonomie
- 2.1. Schottland in der Union
- 3. Schottische Devolution – historischer Hintergrund
- 3.1. Die Schottland-Gesetzgebung von 1978
- 3.2. Die „Scottish Constitutional Convention“: Souveränität des Volkes
- 3.3. (New) Labour und Devolution
- 3.4. Die Konservativen in der Defensive: der „Taking Stock“-Ansatz
- 4. Die Grundlagen des Schottischen Parlaments
- 4.1. Das Referendum
- 4.2. Souveränität und Verankerung in der Verfassung
- 4.3. Legislative Kompetenzen
- 4.4. Kompetenzstreitigkeiten und Konfliktregulierung
- 4.5. Das Wahlsystem
- 4.5.1. Das Verhältniswahlsystem
- 4.5.2. Koalitionsregierung und Konsenspolitik
- 4.6. Das Finanzsystem
- 4.6.1. Die Steuerhoheit des Schottischen Parlaments
- 4.6.2. Die Blockzuwendung durch Westminster
- 5. Interparlamentarische Verflechtung: Westminster – Holyrood
- 5.1. Das „Memorandum of Understanding“
- 5.2. Das „Joint Ministerial Committee“
- 6. Asymmetrie als Konfliktpotential
- 6.1. Die „West Lothian Question“
- 6.2. Die englische Dimension
- 6.3. Die Rolle des „Secretary of State for Scotland“
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Magisterarbeit untersucht die Auswirkungen der Schaffung des Schottischen Parlaments auf den britischen Einheitsstaat. Die Arbeit analysiert den historischen Kontext der schottischen Devolutionsdebatte, die Grundlagen des Schottischen Parlaments, die interparlamentarischen Beziehungen zwischen Westminster und Holyrood, und das Konfliktpotential des asymmetrischen Devolutionsschemas.
- Die historische Entwicklung der schottischen Stellung in der britischen Union
- Die Entstehung und Implementierung des Devolutionsschemas
- Die verfassungsrechtlichen Grundlagen des Schottischen Parlaments
- Die Interaktion zwischen Westminster und Holyrood
- Die Herausforderungen des asymmetrischen Systems
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Arbeit untersucht die Implikationen der asymmetrischen Dezentralisierung in Großbritannien, speziell die des Schottischen Parlaments, für den Einheitsstaat. Sie beleuchtet das Spannungsfeld zwischen der Souveränität Westminsters und der Übertragung von Befugnissen an Schottland, unter Bezugnahme auf historische Debatten und aktuelle Entwicklungen. Der Fokus liegt auf der Analyse politischer und verfassungsrechtlicher Aspekte, um die Stellung des Schottischen Parlaments zu evaluieren.
2. Territoriale Politik: Schottlands Stellung in Großbritannien: Dieses Kapitel analysiert die Stellung Schottlands innerhalb der britischen Union vor der Schaffung des Schottischen Parlaments. Es beleuchtet den „Treaty of Union“, die gesellschaftlichen Veränderungen seitdem, und die Strategien der politischen und wirtschaftlichen Einbindung Schottlands. Zwei konkurrierende Interpretationen der schottischen Stellung werden vorgestellt: der Einheitsstaat mit absoluter Souveränität Westminsters und der „Union State“ mit Teilautonomie Schottlands.
3. Schottische Devolution – historischer Hintergrund: Dieses Kapitel beschreibt die historische Entwicklung der schottischen Devolutionsdebatte. Es analysiert die gescheiterte Devolutionsgesetzgebung der 1970er Jahre, die Rolle der Scottish National Party (SNP), die Positionen der Labour- und Konservativen Parteien, und die Bedeutung der Scottish Constitutional Convention (SCC) für die erfolgreiche Implementierung der Devolution in den 1990er Jahren.
4. Die Grundlagen des Schottischen Parlaments: Dieses Kapitel untersucht die verfassungsrechtlichen und politischen Grundlagen des Schottischen Parlaments. Es analysiert die Ergebnisse des Referendums von 1997, die im Scotland Act 1998 verankerten Kompetenzen des Parlaments, die Mechanismen der Konfliktregulierung und das gewählte Verhältniswahlsystem. Die Arbeit beleuchtet auch die Finanzbeziehungen zwischen Westminster und Holyrood, einschließlich der Bedeutung der Barnett-Formel.
5. Interparlamentarische Verflechtung: Westminster – Holyrood: Dieses Kapitel analysiert die Kooperation zwischen dem Schottischen Parlament und Westminster. Es beschreibt das „Memorandum of Understanding“ und das „Joint Ministerial Committee“ als Mechanismen zur Koordination von Politik und zur Lösung von Kompetenzkonflikten. Die Arbeit untersucht die demokratische Legitimität und die Effektivität dieser Mechanismen.
6. Asymmetrie als Konfliktpotential: Dieses Kapitel befasst sich mit dem Konfliktpotential des asymmetrischen Devolutionsschemas. Es analysiert die „West Lothian Question“, die Herausforderungen für England und die Rolle des „Secretary of State for Scotland“. Die Arbeit diskutiert verschiedene Ansätze zur Bewältigung der Asymmetrie, einschließlich der Regionalisierungspolitik für England.
Schlüsselwörter
Schottisches Parlament, Devolution, Einheitsstaat, Westminster, Holyrood, Parlamentssouveränität, „West Lothian Question“, Asymmetrie, Union State, Scottish Constitutional Convention, Referendum, Verhältniswahlsystem, Finanzbeziehungen, Barnett-Formel, Regionalisierung England, Kompetenzstreitigkeiten.
Häufig gestellte Fragen zur Magisterarbeit: Schottisches Parlament und britischer Einheitsstaat
Was ist der Gegenstand dieser Magisterarbeit?
Die Magisterarbeit untersucht die Auswirkungen der Einrichtung des Schottischen Parlaments auf den britischen Einheitsstaat. Sie analysiert den historischen Kontext der schottischen Devolutionsdebatte, die Grundlagen des Schottischen Parlaments, die interparlamentarischen Beziehungen zwischen Westminster und Holyrood sowie das Konfliktpotential des asymmetrischen Devolutionsschemas.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die historische Entwicklung der schottischen Stellung in der britischen Union, die Entstehung und Implementierung des Devolutionsschemas, die verfassungsrechtlichen Grundlagen des Schottischen Parlaments, die Interaktion zwischen Westminster und Holyrood und die Herausforderungen des asymmetrischen Systems.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel: Einleitung, Territoriale Politik: Schottlands Stellung in Großbritannien, Schottische Devolution – historischer Hintergrund, Die Grundlagen des Schottischen Parlaments, Interparlamentarische Verflechtung: Westminster – Holyrood und Asymmetrie als Konfliktpotential. Jedes Kapitel behandelt einen spezifischen Aspekt der Thematik.
Was wird im Kapitel "Territoriale Politik: Schottlands Stellung in Großbritannien" behandelt?
Dieses Kapitel analysiert Schottlands Stellung innerhalb der britischen Union vor der Einrichtung des Schottischen Parlaments. Es beleuchtet den „Treaty of Union“, gesellschaftliche Veränderungen und Strategien der politischen und wirtschaftlichen Einbindung Schottlands. Zwei konkurrierende Interpretationen der schottischen Stellung werden vorgestellt: der Einheitsstaat mit absoluter Souveränität Westminsters und der „Union State“ mit Teilautonomie Schottlands.
Was wird im Kapitel "Schottische Devolution – historischer Hintergrund" behandelt?
Dieses Kapitel beschreibt die historische Entwicklung der schottischen Devolutionsdebatte. Es analysiert die gescheiterte Devolutionsgesetzgebung der 1970er Jahre, die Rolle der SNP, die Positionen der Labour- und Konservativen Parteien und die Bedeutung der Scottish Constitutional Convention (SCC) für die erfolgreiche Implementierung der Devolution in den 1990er Jahren.
Was wird im Kapitel "Die Grundlagen des Schottischen Parlaments" behandelt?
Dieses Kapitel untersucht die verfassungsrechtlichen und politischen Grundlagen des Schottischen Parlaments. Es analysiert die Ergebnisse des Referendums von 1997, die im Scotland Act 1998 verankerten Kompetenzen des Parlaments, die Mechanismen der Konfliktregulierung und das gewählte Verhältniswahlsystem. Die Arbeit beleuchtet auch die Finanzbeziehungen zwischen Westminster und Holyrood, einschließlich der Bedeutung der Barnett-Formel.
Was wird im Kapitel "Interparlamentarische Verflechtung: Westminster – Holyrood" behandelt?
Dieses Kapitel analysiert die Kooperation zwischen dem Schottischen Parlament und Westminster. Es beschreibt das „Memorandum of Understanding“ und das „Joint Ministerial Committee“ als Mechanismen zur Koordination von Politik und zur Lösung von Kompetenzkonflikten. Die Arbeit untersucht die demokratische Legitimität und die Effektivität dieser Mechanismen.
Was wird im Kapitel "Asymmetrie als Konfliktpotential" behandelt?
Dieses Kapitel befasst sich mit dem Konfliktpotential des asymmetrischen Devolutionsschemas. Es analysiert die „West Lothian Question“, die Herausforderungen für England und die Rolle des „Secretary of State for Scotland“. Die Arbeit diskutiert verschiedene Ansätze zur Bewältigung der Asymmetrie, einschließlich der Regionalisierungspolitik für England.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Schottisches Parlament, Devolution, Einheitsstaat, Westminster, Holyrood, Parlamentssouveränität, „West Lothian Question“, Asymmetrie, Union State, Scottish Constitutional Convention, Referendum, Verhältniswahlsystem, Finanzbeziehungen, Barnett-Formel, Regionalisierung England, Kompetenzstreitigkeiten.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
(Hinweis: Die konkreten Schlussfolgerungen sind nicht im gegebenen Textzusammenfassung enthalten und müssten aus der vollständigen Magisterarbeit entnommen werden.) Die Arbeit evaluiert die Stellung des Schottischen Parlaments im Kontext des britischen Einheitsstaates, beleuchtet die Herausforderungen des asymmetrischen Systems und analysiert die Interaktion zwischen Westminster und Holyrood.
Details
- Titel
- Asymetrische Dezentralisierung in Großbritannien: Das Schottische Parlament und seine Implikationen für den Einheitsstaat
- Hochschule
- Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn (Institut für politische Wissenschaften)
- Note
- 1,0
- Autor
- Katja Dörner (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2000
- Seiten
- 147
- Katalognummer
- V3416
- ISBN (eBook)
- 9783638120906
- Dateigröße
- 991 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Großbritannien / Dezentralisierung / New Labour / Schottland
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 38,99
- Arbeit zitieren
- Katja Dörner (Autor:in), 2000, Asymetrische Dezentralisierung in Großbritannien: Das Schottische Parlament und seine Implikationen für den Einheitsstaat, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/3416
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-