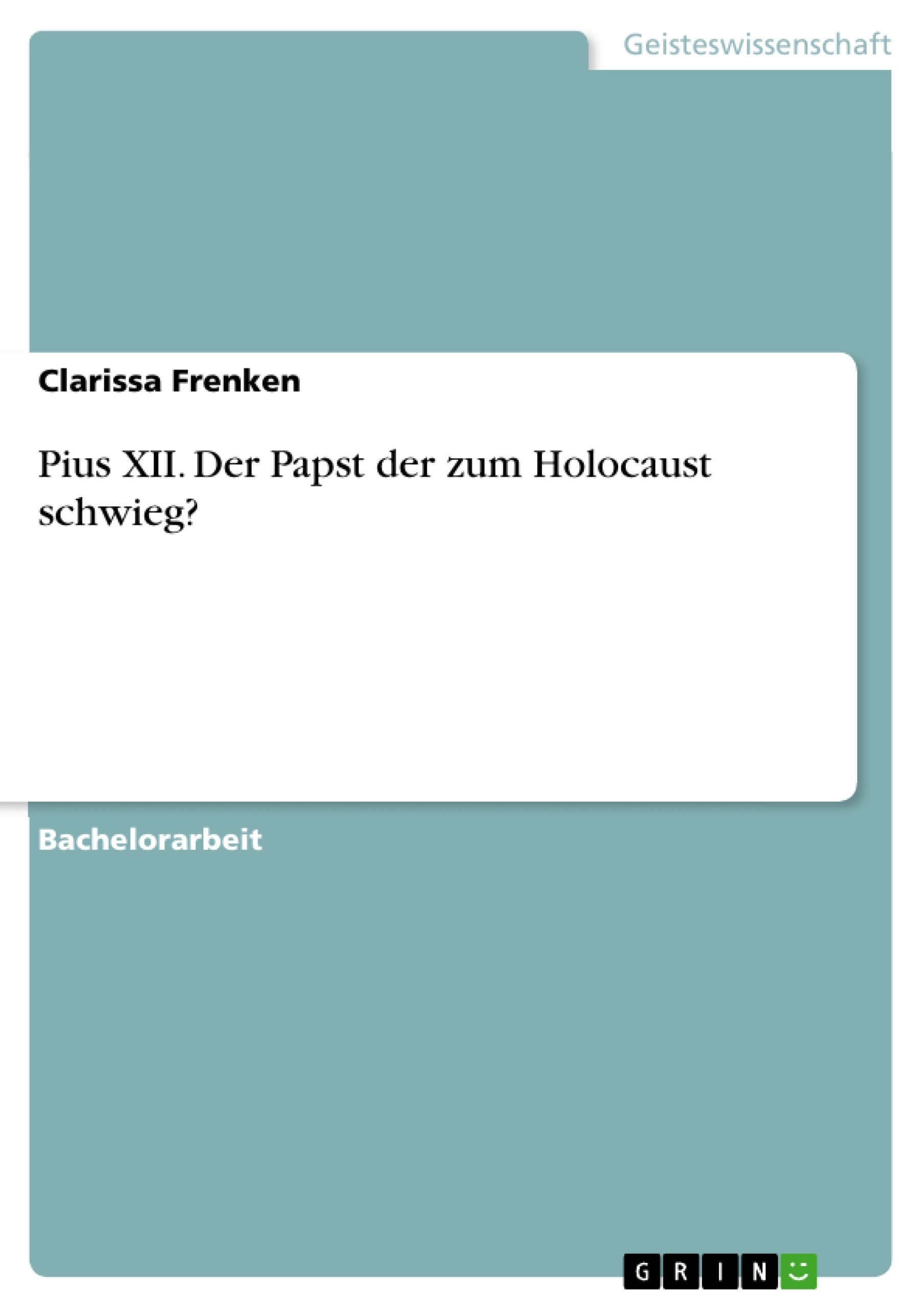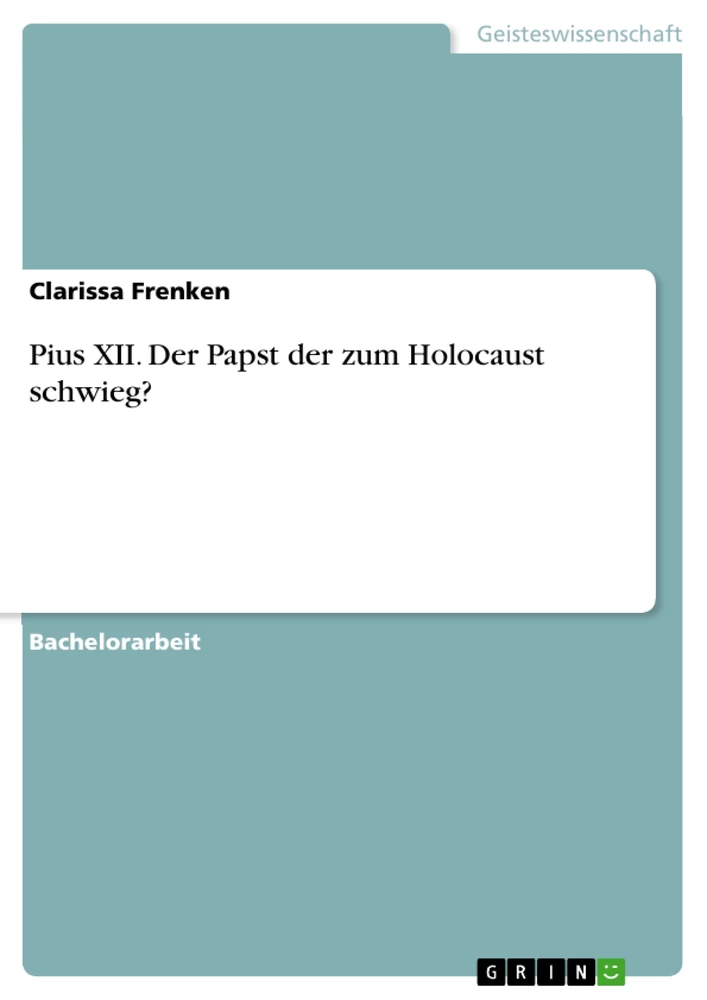
Pius XII. Der Papst der zum Holocaust schwieg?
Bachelorarbeit, 2015
37 Seiten, Note: 1,3
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Werdegang Pacellis
- Herkunft, Familie, Ausbildung
- Pacelli als Nuntius in Deutschland und Vertreter der Friedensinitiative des Papstes
- Pacelli als Kardinalstaatssekretär
- Der Brief Edith Steins an Pius XI.
- Die Beteiligung Pacellis am Reichskonkordat 1933
- Die Beteiligung Pacellis an der Enzyklika „Mit brennender Sorge“
- Papst Pius XII. und die „Judenfrage“
- Pius XII. und die letzte Initiative seines Vorgängers
- Eine Gewissensfrage: Reden oder Schweigen?
- Der Protest der holländischen Bischöfe
- Ist stille Hilfe besser als öffentlicher Protest?
- Die Deportation römischer Juden 1943
- Hat der Papst tatsächlich geschwiegen? Die Weihnachtsbotschaft von 1942
- Der Protest von Bischof von Galen: Der Papst musste schweigen - deutsche Bischöfe durften reden?
- Dank und Kritik der Juden an Pius XII. nach dem Krieg
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Frage, ob Papst Pius XII. während des Holocaust geschwiegen hat und wenn ja, welche Gründe er dafür hatte. Dazu wird der Werdegang Eugenio Pacellis, dem späteren Papst Pius XII., beleuchtet, um seine Prägungen und Erfahrungen vor seiner Amtszeit als Papst zu verstehen. Die Arbeit untersucht die Rolle Pacellis als Nuntius in Deutschland und seine Amtszeit als Kardinalstaatssekretär, um zu analysieren, ob deutsche und diplomatische Einflüsse sein späteres Handeln als Papst beeinflusst haben. Die Arbeit beleuchtet auch die Reaktion Pius XII. auf die „Judenfrage“ während des Zweiten Weltkrieges und die Gründe für sein Handeln, wobei die wichtigsten Argumente seiner Kritiker und Verteidiger gegeneinander abgewogen werden. Die Arbeit untersucht auch die Frage, ob der Papst tatsächlich zum Holocaust geschwiegen hat und kommt in ihrem Fazit zu einer Beurteilung von Pius' Verhalten während des Zweiten Weltkrieges.
- Der Werdegang von Eugenio Pacelli und seine Prägungen
- Die Rolle von Pacelli als Nuntius in Deutschland und Kardinalstaatssekretär
- Die Reaktion von Papst Pius XII. auf die „Judenfrage“ während des Zweiten Weltkrieges
- Die Gründe für das Handeln von Pius XII.
- Die Beurteilung von Pius' Verhalten während des Zweiten Weltkrieges
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die zentrale Fragestellung der Arbeit vor und erläutert den Forschungsgegenstand. Sie beschreibt die Kontroverse um die Rolle von Papst Pius XII. während des Holocaust und die unterschiedlichen Sichtweisen auf seine Person. Kapitel 2 beleuchtet den Werdegang von Eugenio Pacelli, dem späteren Papst Pius XII., und analysiert seine Herkunft, Familie und Ausbildung sowie seine Zeit als Nuntius in Deutschland und Kardinalstaatssekretär. Kapitel 3 befasst sich mit der Reaktion von Papst Pius XII. auf die „Judenfrage“ während des Zweiten Weltkrieges und analysiert die Gründe für sein Handeln. Es werden die wichtigsten Argumente seiner Kritiker und Verteidiger gegeneinander abgewogen. Kapitel 4 untersucht den Protest von Bischof von Galen und stellt ihn in Bezug zu den Handlungen des Papstes. Kapitel 5 beleuchtet die Reaktion der Juden auf Pius XII. nach dem Krieg. Das Fazit der Arbeit fasst die Ergebnisse zusammen und stellt eine Beurteilung von Pius' Verhalten während des Zweiten Weltkrieges vor.
Schlüsselwörter
Papst Pius XII., Holocaust, Eugenio Pacelli, Nuntius, Kardinalstaatssekretär, Reichskonkordat, „Mit brennender Sorge“, Judenfrage, Weihnachtsbotschaft, Bischof von Galen, stille Hilfe, öffentlicher Protest, Kritik, Verteidigung, Beurteilung
Häufig gestellte Fragen
Hat Papst Pius XII. zum Holocaust geschwiegen?
Die Arbeit kommt zu dem Schluss, dass der Papst nicht völlig geschwiegen hat (z. B. Weihnachtsbotschaft 1942), seine Proteste jedoch oft als nicht deutlich oder öffentlich genug kritisiert werden.
Hätte eine öffentliche Verurteilung den Holocaust stoppen können?
Dies ist eine zentrale Streitfrage. Verteidiger argumentieren, ein lauter Protest hätte die Verfolgung verschlimmert und die Kirche selbst zum Ziel Hitlers gemacht; Kritiker sehen darin eine verpasste moralische Chance.
Welche Rolle spielte Eugenio Pacelli vor seinem Pontifikat?
Als Nuntius in Deutschland und Kardinalstaatssekretär war er maßgeblich am Reichskonkordat 1933 beteiligt. Diese Erfahrungen prägten sein diplomatisches und vorsichtiges Agieren als späterer Papst.
Was war die Strategie der „stillen Hilfe“?
Pius XII. setzte verstärkt auf diplomatische Kanäle und die verdeckte Unterstützung von Verfolgten durch kirchliche Einrichtungen, anstatt den offenen, riskanten Konflikt mit dem NS-Regime zu suchen.
Wie reagierten jüdische Organisationen nach dem Krieg auf Pius XII.?
Unmittelbar nach dem Krieg gab es viel Dank für die Hilfe der Kirche; erst später entwickelte sich die scharfe Kritik an seiner diplomatischen Zurückhaltung und seinem „Schweigen“.
Details
- Titel
- Pius XII. Der Papst der zum Holocaust schwieg?
- Hochschule
- Universität Siegen
- Note
- 1,3
- Autor
- Clarissa Frenken (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2015
- Seiten
- 37
- Katalognummer
- V342030
- ISBN (eBook)
- 9783668317314
- ISBN (Buch)
- 9783668317321
- Dateigröße
- 903 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- pius papst holocaust
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 16,99
- Preis (Book)
- US$ 20,99
- Arbeit zitieren
- Clarissa Frenken (Autor:in), 2015, Pius XII. Der Papst der zum Holocaust schwieg?, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/342030
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-