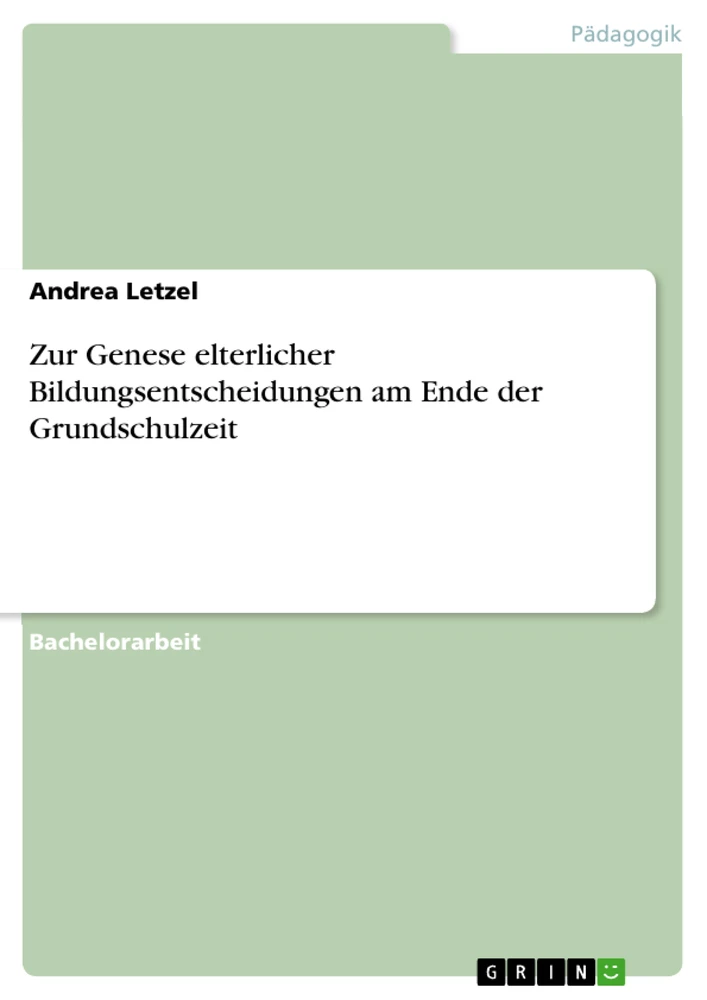
Zur Genese elterlicher Bildungsentscheidungen am Ende der Grundschulzeit
Bachelorarbeit, 2013
36 Seiten, Note: 1,7
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Bildungssystem in Deutschland
- Übergangsregelungen und Beteiligte der Bildungsentscheidung
- Die Entscheidung der Eltern
- Zulassungsbeschränkungen
- Lehrerbeurteilungen, Übergangsempfehlungen und Noten
- Entscheidungsmodelle
- Boudons Rational-Choice-Theorie
- Modell von Erikson & Jonsson
- Einflussfaktoren auf die elterliche Bildungsentscheidung
- Einkommen und finanzielle Voraussetzungen
- Elterliche Bildung und Karriere
- Übergangsempfehlungen
- Übergangswünsche der Kinder
- Schulische Leistungen der Kinder
- Außerschulische Rahmenbedingungen
- Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Bachelorarbeit analysiert die Entstehung der elterlichen Bildungsentscheidung am Übergang von der Grundschule zur Sekundarstufe I. Die Arbeit untersucht, welche Faktoren die Bildungsentscheidung der Eltern beeinflussen und inwieweit die Wünsche und Leistungen der Schüler in diesem Prozess berücksichtigt werden.
- Die Genese der elterlichen Bildungsentscheidung am Ende der Grundschulzeit
- Einflussfaktoren auf die elterliche Bildungsentscheidung, insbesondere Einkommen und Bildung der Eltern
- Die Rolle der Übergangsempfehlungen und die Bedeutung der Schulleistungen der Kinder
- Die Position der Schüler und Schülerinnen im Entscheidungsprozess
- Schichtspezifische Unterschiede in der Gewichtung von Entscheidungsfaktoren
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in das deutsche Bildungssystem und erläutert die Besonderheiten des Übergangs von der Grundschule zur Sekundarstufe I. Anschließend werden die rechtlichen Rahmenbedingungen des Bildungsübergangs und die Rollen der beteiligten Akteure, insbesondere der Eltern, beschrieben. Im nächsten Kapitel werden verschiedene Entscheidungstheorien vorgestellt, die die rationale Wahlentscheidung der Eltern im Kontext der Schulformwahl erklären. Der Hauptteil der Arbeit beschäftigt sich mit den Einflussfaktoren auf die elterliche Bildungsentscheidung, wobei insbesondere die Rolle des elterlichen Einkommens und der elterlichen Bildung sowie der Einfluss von Übergangsempfehlungen und Schülerleistungen untersucht werden.
Schlüsselwörter
Elterliche Bildungsentscheidung, Bildungsübergang, Grundschule, Sekundarstufe I, Entscheidungstheorie, Rational-Choice-Modell, Einflussfaktoren, Einkommen, Bildung, Übergangsempfehlung, Schulleistungen, Schülerposition, soziale Ungleichheit
Häufig gestellte Fragen
Wer entscheidet über den Übergang zur weiterführenden Schule?
Die Arbeit untersucht die zentrale Rolle der Eltern, wobei Faktoren wie Lehrerbeurteilungen, Noten und Übergangsempfehlungen den Rahmen bilden.
Was besagt die Rational-Choice-Theorie von Boudon?
Sie erklärt Bildungsentscheidungen als rationale Wahl, bei der Kosten, Nutzen und Erfolgswahrscheinlichkeiten je nach sozialer Schicht unterschiedlich abgewogen werden.
Welchen Einfluss hat das Einkommen der Eltern?
Finanzielle Voraussetzungen beeinflussen die Entscheidung oft stärker als die tatsächliche Schulleistung, da einkommensstarke Eltern eher höhere Bildungswege anstreben.
Was ist das Modell von Erikson & Jonsson?
Es ist eine Weiterentwicklung der Entscheidungstheorie, die annimmt, dass Eltern die Alternative wählen, die den größten erwarteten sozialen Statuserhalt verspricht.
Spielen die Wünsche der Kinder eine Rolle?
Ja, die Übergangswünsche der Kinder werden als einer der Einflussfaktoren auf die elterliche Entscheidung in der Arbeit geprüft.
Details
- Titel
- Zur Genese elterlicher Bildungsentscheidungen am Ende der Grundschulzeit
- Hochschule
- Johannes Gutenberg-Universität Mainz
- Note
- 1,7
- Autor
- Andrea Letzel (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2013
- Seiten
- 36
- Katalognummer
- V344441
- ISBN (eBook)
- 9783668343528
- ISBN (Buch)
- 9783668343535
- Dateigröße
- 944 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- genese bildungsentscheidungen ende grundschulzeit
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 16,99
- Preis (Book)
- US$ 18,99
- Arbeit zitieren
- Andrea Letzel (Autor:in), 2013, Zur Genese elterlicher Bildungsentscheidungen am Ende der Grundschulzeit, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/344441
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-









