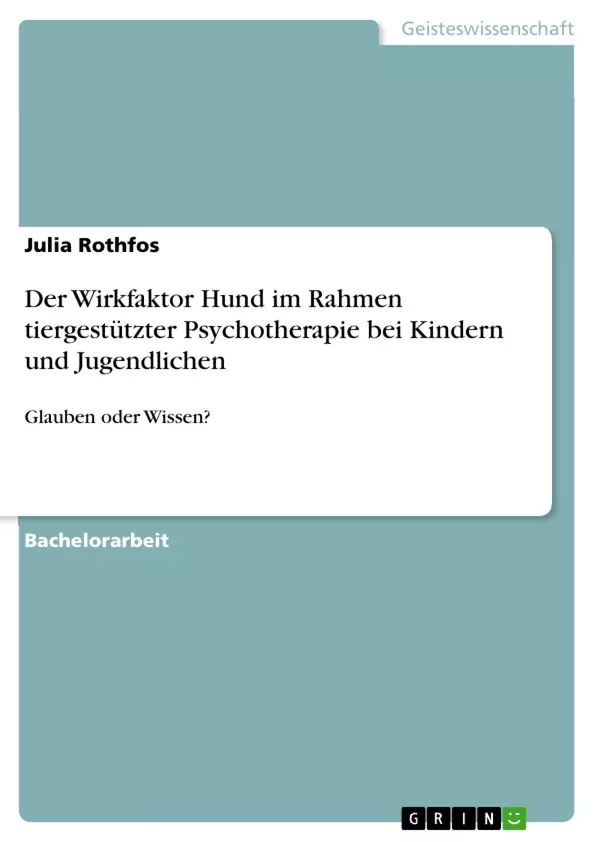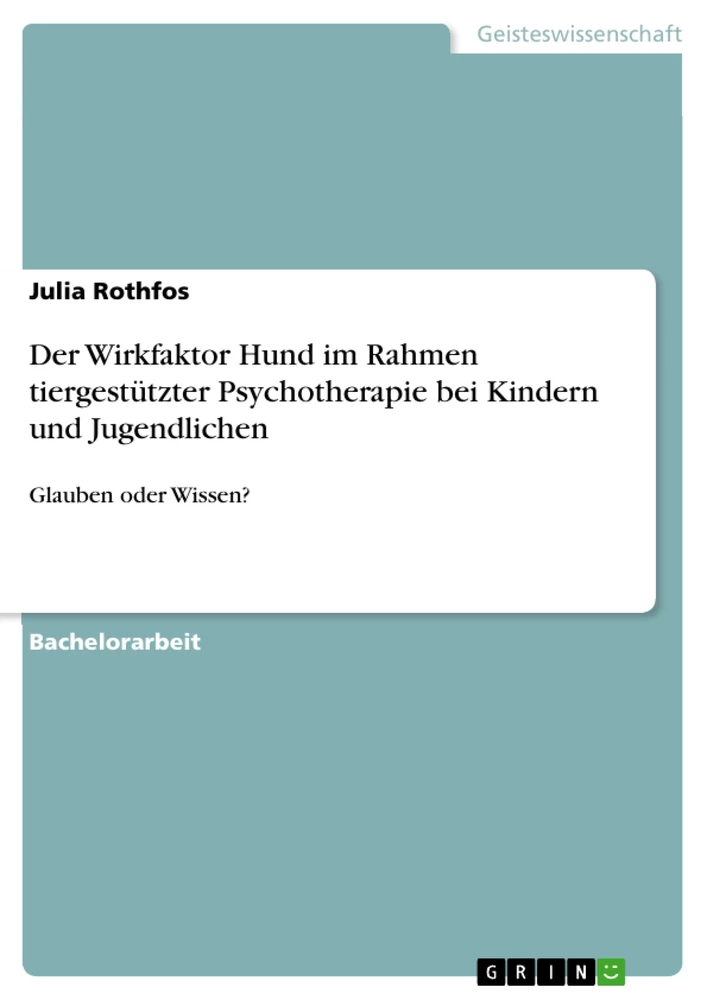
Der Wirkfaktor Hund im Rahmen tiergestützter Psychotherapie bei Kindern und Jugendlichen
Bachelorarbeit, 2016
59 Seiten, Note: 1,1
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Abstract
- Einführung und Vorstellung der Arbeit
- Der Wirkfaktor Hund in der Psychotherapie
- Mensch-Hund-Beziehung
- Bindungstheorie
- Biophilie
- Du-Evidenz
- Spiegelneurone
- Social Brain Hypothese
- Tiergestützte Psychotherapie
- Definition tiergestützte Psychotherapie
- Entwicklung der tiergestützten Psychotherapie
- Forschungsstand
- Therapiebegleithunde und ihr Einsatz bei Kindern und Jugendlichen
- Kinder und Tiere
- Mögliche Wirkfaktoren von Therapiebegleithunden
- Mensch-Hund-Beziehung
- Glauben oder Wissen
- Forschungsfragen
- Studiensuche
- Inhaltliche Kriterien
- Methodik
- Suchergebnisse
- Anforderungen an eine wissenschaftlich fundierte Studie
- Überprüfung ausgewählter Studien
- Ergebnisse
- Ergebnisse im Hinblick auf die untersuchten Störungsbilder
- Ergebnisse im Hinblick auf die untersuchten abhängigen Variablen
- Ergebnisse bezüglich der Anzahl Studien pro Erscheinungsjahr
- Ergebnisse im Bezug zu den Forschungsfragen
- Diskussion, Limitierungen und Empfehlungen
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Bachelorarbeit untersucht die Wirksamkeit von hundegestützter Psychotherapie bei Kindern und Jugendlichen. Ziel ist es, anhand einer Literaturrecherche und -auswertung der letzten zehn Jahre herauszufinden, ob ausreichend Wirksamkeitsstudien existieren, die den Kriterien der evidenzbasierten Medizin entsprechen. Die Arbeit beleuchtet den Forschungsstand und die methodischen Herausforderungen in diesem Bereich.
- Wirksamkeit tiergestützter Psychotherapie
- Evidenzbasierte Medizin im Kontext der tiergestützten Intervention
- Mensch-Tier-Beziehung, insbesondere Mensch-Hund-Bindung
- Analyse der methodischen Qualität bestehender Studien
- Herausforderungen und zukünftige Forschungsfragen
Zusammenfassung der Kapitel
Abstract: Der Abstract fasst die Forschungsfrage nach der Wirksamkeit hundegestützter Psychotherapie bei Kindern und Jugendlichen zusammen und beschreibt die Methodik der Arbeit: Eine Literaturrecherche und -auswertung der letzten zehn Jahre anhand von Checklisten zur Bestimmung des Qualitätsstandards und der Evidenzempfehlung. Die Ergebnisse zeigen ein heterogenes Forschungsfeld, wobei für bestimmte Symptomkomplexe tiergestützte Psychotherapie als evidenzbasiert bezeichnet werden kann, der höchste Evidenzgrad aber noch nicht erreicht ist. Einheitliche theoretische Grundlagen fehlen.
Einführung und Vorstellung der Arbeit: Dieses Kapitel führt in die Thematik ein, indem es die lange Geschichte der Mensch-Hund-Beziehung und die zunehmende Nutzung von Hunden in verschiedenen Bereichen – von der Polizeiarbeit bis hin zu sozialen Einrichtungen – beschreibt. Es betont die besondere Bedeutung des Hundes als Haustier und die steigende Popularität des Einsatzes von Hunden in der Psychotherapie, basierend auf vielversprechenden, aber noch nicht wissenschaftlich vollständig abgesicherten Erfahrungen.
Der Wirkfaktor Hund in der Psychotherapie: Dieses Kapitel beleuchtet die komplexen Faktoren, die den Einsatz von Hunden in der Psychotherapie begründen. Es untersucht verschiedene theoretische Ansätze wie die Bindungstheorie, Biophilie, die Rolle von Spiegelneuronen und die Social Brain Hypothese, um die positive Wirkung der Mensch-Hund-Interaktion zu erklären. Weiterhin wird die Entwicklung und der Forschungsstand der tiergestützten Psychotherapie detailliert dargestellt und der Einsatz von Therapiebegleithunden bei Kindern und Jugendlichen erläutert. Die positiven Auswirkungen der unbedingten Zuneigung und Akzeptanz durch Hunde auf die emotionale Ebene werden hervorgehoben.
Glauben oder Wissen: Dieser Abschnitt beschreibt die Forschungsmethodik der Arbeit. Es werden die Forschungsfragen präzisiert und das Vorgehen bei der Studiensuche, einschließlich der angewandten Kriterien und Methoden, detailliert erläutert. Die Anforderungen an eine wissenschaftlich fundierte Studie werden dargelegt und die Überprüfung ausgewählter Studien im Hinblick auf ihre methodische Qualität und die daraus resultierenden Ergebnisse beschrieben. Ein Schwerpunkt liegt auf der kritischen Auseinandersetzung mit der vorhandenen Literatur und der Identifizierung von methodischen Stärken und Schwächen.
Ergebnisse: Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse der Analyse der ausgewählten Studien. Die Ergebnisse werden nach verschiedenen Gesichtspunkten gegliedert, wie z.B. den untersuchten Störungsbildern, den abhängigen Variablen und der Anzahl der Studien pro Jahr. Die Darstellung der Ergebnisse umfasst eine systematische Auswertung der Daten und eine Visualisierung durch Tabellen und Abbildungen. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Interpretation der Ergebnisse im Bezug auf die Forschungsfragen der Arbeit.
Schlüsselwörter
Tiergestützte Psychotherapie, Hundegestützte Therapie, Kinder, Jugendliche, Evidenzbasierte Medizin, Wirksamkeitsstudien, Mensch-Hund-Beziehung, Bindungstheorie, Biophilie, Spiegelneurone, Social Brain Hypothese, Forschungsstand, Methodik, Qualitätsstandards, Symptomkomplexe.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Bachelorarbeit: Wirksamkeit hundegestützter Psychotherapie bei Kindern und Jugendlichen
Was ist das Thema der Bachelorarbeit?
Die Bachelorarbeit untersucht die Wirksamkeit von hundegestützter Psychotherapie bei Kindern und Jugendlichen. Sie analysiert, ob ausreichend Wirksamkeitsstudien existieren, die den Kriterien der evidenzbasierten Medizin entsprechen.
Welche Methodik wurde angewendet?
Die Arbeit basiert auf einer Literaturrecherche und -auswertung der letzten zehn Jahre. Es wurden Checklisten zur Bestimmung des Qualitätsstandards und der Evidenzempfehlung verwendet. Die Arbeit analysiert kritisch die methodischen Stärken und Schwächen der untersuchten Studien.
Welche Aspekte der Mensch-Hund-Beziehung werden betrachtet?
Die Arbeit beleuchtet verschiedene theoretische Ansätze, um die positive Wirkung der Mensch-Hund-Interaktion zu erklären, darunter die Bindungstheorie, Biophilie, die Rolle von Spiegelneuronen und die Social Brain Hypothese. Die besondere Bedeutung der unbedingten Zuneigung und Akzeptanz durch Hunde wird hervorgehoben.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit beinhaltet folgende Kapitel: Abstract, Einführung und Vorstellung der Arbeit, Der Wirkfaktor Hund in der Psychotherapie, Glauben oder Wissen (Methodenteil), Ergebnisse, Diskussion, Limitierungen und Empfehlungen, Fazit.
Welche Ergebnisse wurden erzielt?
Die Ergebnisse zeigen ein heterogenes Forschungsfeld. Für bestimmte Symptomkomplexe kann tiergestützte Psychotherapie als evidenzbasiert bezeichnet werden, der höchste Evidenzgrad ist jedoch noch nicht erreicht. Einheitliche theoretische Grundlagen fehlen. Die Ergebnisse werden detailliert nach Störungsbildern, abhängigen Variablen und Anzahl der Studien pro Jahr dargestellt.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Tiergestützte Psychotherapie, Hundegestützte Therapie, Kinder, Jugendliche, Evidenzbasierte Medizin, Wirksamkeitsstudien, Mensch-Hund-Beziehung, Bindungstheorie, Biophilie, Spiegelneurone, Social Brain Hypothese, Forschungsstand, Methodik, Qualitätsstandards, Symptomkomplexe.
Welche Forschungsfragen werden behandelt?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Gibt es ausreichend Wirksamkeitsstudien zur hundegestützten Psychotherapie bei Kindern und Jugendlichen, die den Kriterien der evidenzbasierten Medizin entsprechen? Die Arbeit untersucht außerdem die methodischen Herausforderungen und zukünftige Forschungsfragen in diesem Bereich.
Welche Limitationen werden diskutiert?
Die Arbeit diskutiert die Limitationen der vorhandenen Literatur und die methodischen Herausforderungen bei der Erforschung der Wirksamkeit hundegestützter Psychotherapie. Dies beinhaltet die Heterogenität der Studien und den Mangel an einheitlichen theoretischen Grundlagen.
Was ist das Fazit der Arbeit?
Das Fazit fasst die Ergebnisse zusammen und bewertet den aktuellen Forschungsstand. Es werden Empfehlungen für zukünftige Forschungsprojekte gegeben, um die Evidenzlage zu verbessern und die Wirksamkeit hundegestützter Psychotherapie weiter zu erforschen.
Wo finde ich den vollständigen Text?
Der vollständige Text der Bachelorarbeit ist nicht hier verfügbar. Diese FAQ dienen lediglich als Zusammenfassung.
Details
- Titel
- Der Wirkfaktor Hund im Rahmen tiergestützter Psychotherapie bei Kindern und Jugendlichen
- Untertitel
- Glauben oder Wissen?
- Note
- 1,1
- Autor
- Julia Rothfos (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2016
- Seiten
- 59
- Katalognummer
- V345322
- ISBN (eBook)
- 9783668351318
- ISBN (Buch)
- 9783668351325
- Dateigröße
- 2436 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- tiergestützt psychotherapie kinder jugendliche hunde animal assisted therapy hundegestützt wirksamkeitsstudien evidenzbasierte medizin
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 19,99
- Preis (Book)
- US$ 28,99
- Arbeit zitieren
- Julia Rothfos (Autor:in), 2016, Der Wirkfaktor Hund im Rahmen tiergestützter Psychotherapie bei Kindern und Jugendlichen, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/345322
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-