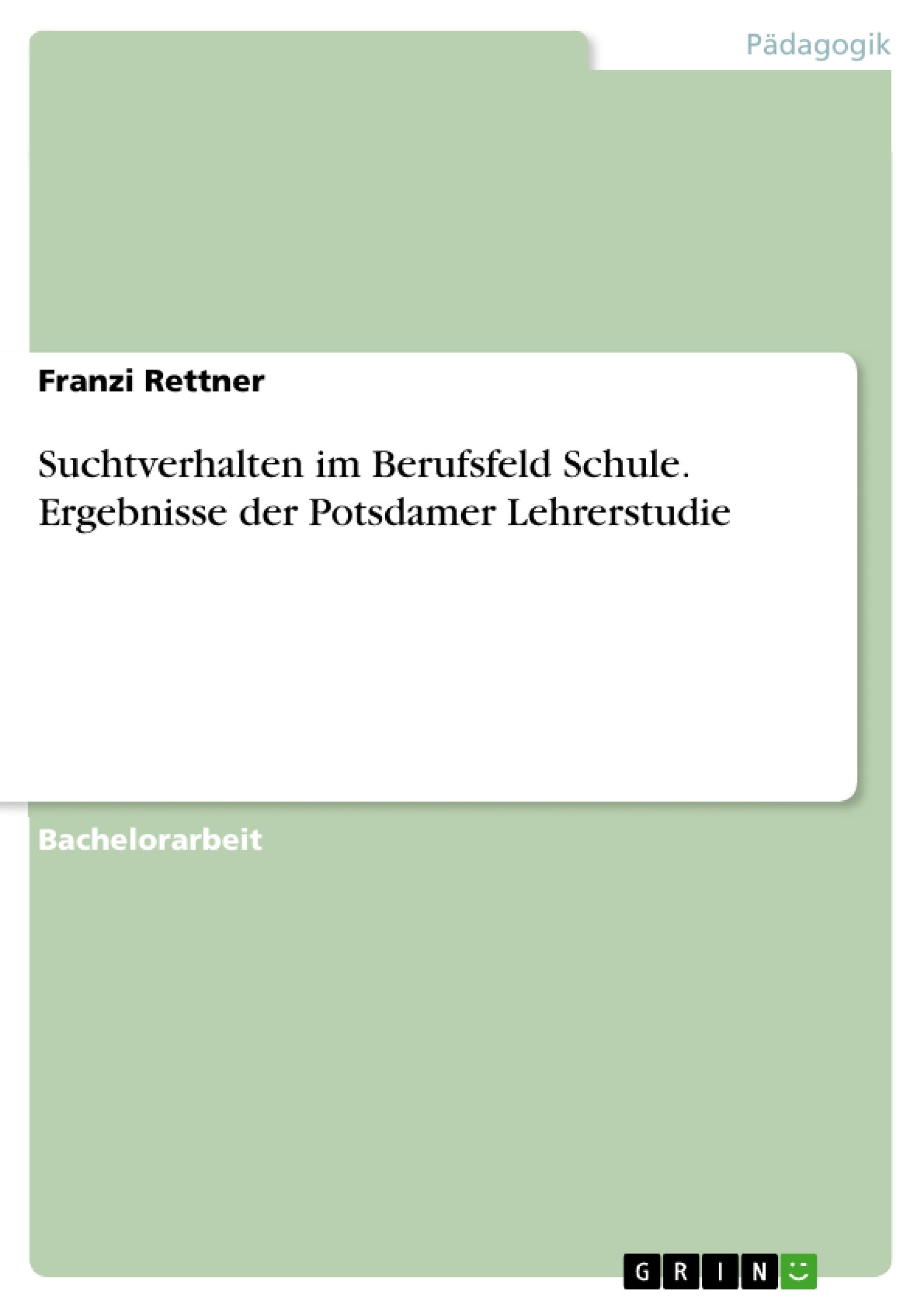Suchtverhalten im Berufsfeld Schule. Ergebnisse der Potsdamer Lehrerstudie
Bachelorarbeit, 2016
54 Seiten, Note: 1,0
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Belastungen und Beanspruchungen im Lehrerberuf
- Begriffsbestimmungen zur Lehrerbelastung
- Definition psychische Belastung und Beanspruchung
- Definition Lehrerbelastung
- Belastende Faktoren im Lehrerberuf - ein Überblick
- Arbeitsfeld und schulorganisatorische Gegebenheiten
- Arbeitshygienische Gegebenheiten
- Soziale Arbeitsbedingungen
- Gesellschaftlich - kulturelle Gegebenheiten
- Begriffsbestimmungen zur Lehrerbelastung
- Die Grundlagen der Potsdamer Lehrerstudie
- Hauptbelastungsfaktoren nach den Ergebnissen der PLS
- Der AVEM als Diagnostikinstrument
- Muster G
- Muster S
- Risikomuster A
- Risikomuster B
- AVEM-Ergebnisse im Längsschnitt
- Auswirkungen auf die Lehrergesundheit unter Einbezug der PLS
- Lehrergesundheit und die gesundheitsförderlichen Eigenschaften des Berufs
- Lehrerkrankheiten in Anlehnung an die Ergebnisse der PLS
- Die Beanspruchungsmuster der PLS im Berufsvergleich
- Fehltage im Lehrerberuf in Bezug auf die Bewältigungsmuster der PLS
- Dienstunfähigkeit und Frühpensionierung im Lehrerberuf
- Psychische und psychosomatische Erkrankungen im Lehrerberuf
- Alkoholmissbrauch zur Belastungsbewältigung
- Alkoholabhängigkeit
- Alkoholismus - Definition einer Sucht
- Ursachen von Alkoholabhängigkeit
- Entwicklung von Alkoholismus nach dem Trichtermodell
- Gesundheitliche Folgen
- Vergleichende Betrachtung des Alkoholkonsums im Lehrerberuf mit anderen Berufsgruppen
- Alkoholabhängigkeit
- Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht die Ergebnisse der Potsdamer Lehrerstudie (PLS) im Hinblick auf das Suchtverhalten im Lehrerberuf. Die Arbeit beleuchtet die Belastungsfaktoren, die im Lehrerberuf zu Suchtverhalten führen können, und analysiert die Auswirkungen auf die Lehrergesundheit.
- Belastungen und Beanspruchungen im Lehrerberuf
- Die Potsdamer Lehrerstudie als Forschungsinstrument
- Auswirkungen von Lehrerbelastung auf die Gesundheit
- Alkoholmissbrauch als Bewältigungsmechanismus
- Vergleichende Betrachtung des Alkoholkonsums im Lehrerberuf
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Lehrerbelastung und Suchtverhalten ein. Das zweite Kapitel beleuchtet die verschiedenen Belastungsfaktoren, denen Lehrer im Arbeitsalltag ausgesetzt sind. Das dritte Kapitel stellt die Potsdamer Lehrerstudie vor und erläutert deren Ergebnisse bezüglich der Hauptbelastungsfaktoren. Kapitel vier untersucht die Auswirkungen der Lehrerbelastung auf die Lehrergesundheit, unter Einbezug der Ergebnisse der PLS. Kapitel fünf befasst sich mit dem Thema Alkoholmissbrauch als Bewältigungsstrategie für Lehrerbelastungen und untersucht den Alkoholkonsum im Vergleich zu anderen Berufsgruppen. Das Fazit fasst die wichtigsten Erkenntnisse der Arbeit zusammen und gibt einen Ausblick auf weiterführende Forschungsfragen.
Schlüsselwörter
Lehrerbelastung, Beanspruchung, Suchtverhalten, Alkoholmissbrauch, Potsdamer Lehrerstudie, AVEM, Lehrergesundheit, psychische Belastung, Arbeitsbedingungen, Berufsfeld Schule.
Details
- Titel
- Suchtverhalten im Berufsfeld Schule. Ergebnisse der Potsdamer Lehrerstudie
- Hochschule
- Universität Koblenz-Landau
- Note
- 1,0
- Autor
- Franzi Rettner (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2016
- Seiten
- 54
- Katalognummer
- V350516
- ISBN (eBook)
- 9783668371514
- ISBN (Buch)
- 9783668371521
- Dateigröße
- 1105 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Alkohol Burnout Lehrer Lehrkräfte Alkoholmissbrauch Sucht Psychische Belastung Potsdamer Lehrerstudie Lehrerberuf Suchtmittel Alkoholismus
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 20,99
- Preis (Book)
- US$ 29,99
- Arbeit zitieren
- Franzi Rettner (Autor:in), 2016, Suchtverhalten im Berufsfeld Schule. Ergebnisse der Potsdamer Lehrerstudie, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/350516
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-