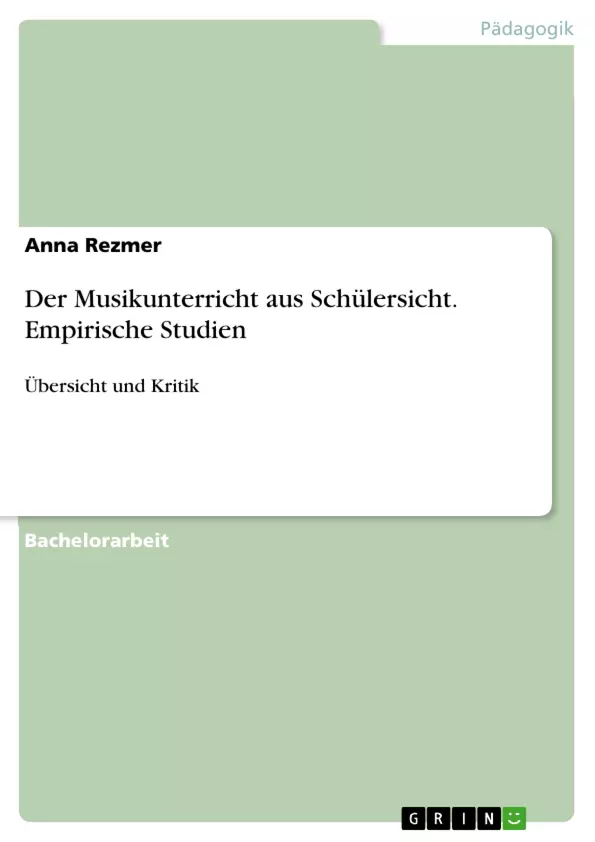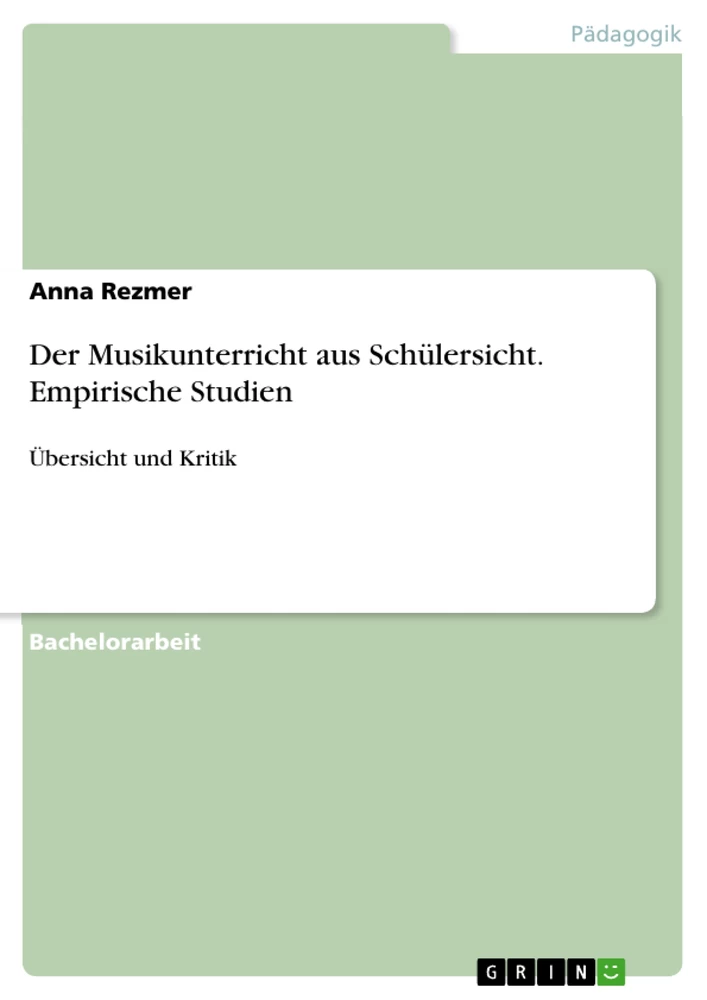
Der Musikunterricht aus Schülersicht. Empirische Studien
Bachelorarbeit, 2013
51 Seiten, Note: 2
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Empirische Forschung - Ziele und Methoden
- Empirische Studien
- Musikunterricht zwischen Sach- und Fachinteresse – Ergebnisse aus der Pilotstudie „Musikunterricht aus Schülersicht\" - Frauke Heß
- Musikunterricht aus Schülersicht – Eine empirische Studie an Grundschulen - Magnus Gaul
- Schülerwünsche zu Unterrichtsmethoden im Musikunterricht - Marie Luise Schulten
- Musik(erziehung) und ihre Wirkung – Hans Günther Bastian
- War ja klar, dass die nicht unterrichten kann! Eine empirische Folgestudie zum Einfluss von Vorurteilen und Motivation auf die Bewertung von Musikunterricht bei Schülern – Christian Harnischmacher und Viola C. Hofbauer
- Diskurs und Kritik
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Bachelorarbeit analysiert empirische Studien, die den Musikunterricht aus Schülersicht betrachten. Sie untersucht die Perspektive der Lernenden und die Faktoren, die einen gelingenden Unterricht beeinflussen können. Durch die Rekonstruktion der Schülerperspektive sollen spezifische Denkweisen, Lerngewohnheiten, Erwartungen und Interessenentwicklungen sichtbar gemacht werden. Die Arbeit verfolgt das Ziel, wissenschaftliches Forschen zu betreiben und subjektive Meinungen in objektives Wissen zu überführen.
- Schülerperspektive im Musikunterricht
- Einfluss von Lernenden auf den Musikunterricht
- Methoden und Ergebnisse empirischer Studien
- Kritik an Forschungsmethoden und -ergebnissen
- Faktoren, die den Erfolg von Musikunterricht beeinflussen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt die Forschungsfrage und den Aufbau der Bachelorarbeit vor. Sie erklärt, warum es wichtig ist, den Musikunterricht aus Schülersicht zu betrachten und wie die Arbeit den wissenschaftlichen Diskurs bereichern kann.
Empirische Forschung - Ziele und Methoden
Dieses Kapitel definiert die empirische Forschung und beschreibt ihre Ziele, Methoden und potentielle Fehlerquellen. Es werden qualitative und quantitative Forschungsmethoden erläutert, die in der Arbeit relevant sind.
Empirische Studien
Dieser Abschnitt präsentiert und analysiert verschiedene empirische Studien zum Musikunterricht aus Schülersicht. Jede Studie wird hinsichtlich ihrer Fragestellungen, Methoden und Ergebnisse vorgestellt.
Diskurs und Kritik
Das Kapitel befasst sich mit einer kritischen Betrachtung der präsentierten Studien. Es diskutiert die Auswahl und Größe der Stichproben und analysiert, ob die Ergebnisse verallgemeinerbar sind.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit empirischen Studien zum Musikunterricht, wobei die Perspektive der Lernenden im Mittelpunkt steht. Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Schülerperspektive, Musikunterricht, empirische Forschung, qualitative und quantitative Methoden, Kritik, Diskurs, Stichproben, Ergebnisse, Faktoren für gelingenden Unterricht.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist die Schülerperspektive im Musikunterricht wichtig?
Die Rekonstruktion der Schülerperspektive hilft dabei, Lerngewohnheiten, Erwartungen und Interessen zu verstehen, um Faktoren für einen gelingenden Unterricht zu identifizieren.
Welche Studien werden in der Arbeit analysiert?
Es werden fünf Studien untersucht, unter anderem von Frauke Heß, Magnus Gaul, Marie Luise Schulten, Hans Günther Bastian sowie Harnischmacher und Hofbauer.
Wie beeinflussen Vorurteile die Bewertung von Musiklehrern?
Die Studie von Harnischmacher und Hofbauer zeigt, dass Schülervorurteile und die eigene Motivation einen signifikanten Einfluss darauf haben, wie kompetent eine Lehrkraft wahrgenommen wird.
Was sind typische Schülerwünsche für den Musikunterricht?
Schüler wünschen sich oft spezifische Unterrichtsmethoden, die stärker an ihren individuellen Interessen und modernen Musikgenres orientiert sind, wie die Studie von Schulten belegt.
Welche Methoden nutzt die empirische Musikpädagogik?
Eingesetzt werden qualitative und quantitative Methoden wie Fragebögen, Interviewleitfäden und statistische Auswertungen von Schülerurteilen.
Details
- Titel
- Der Musikunterricht aus Schülersicht. Empirische Studien
- Untertitel
- Übersicht und Kritik
- Note
- 2
- Autor
- Anna Rezmer (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2013
- Seiten
- 51
- Katalognummer
- V350688
- ISBN (eBook)
- 9783668411395
- ISBN (Buch)
- 9783668411401
- Dateigröße
- 845 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- musikunterricht schülersicht empirische studien übersicht kritik
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 20,99
- Preis (Book)
- US$ 29,99
- Arbeit zitieren
- Anna Rezmer (Autor:in), 2013, Der Musikunterricht aus Schülersicht. Empirische Studien, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/350688
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-