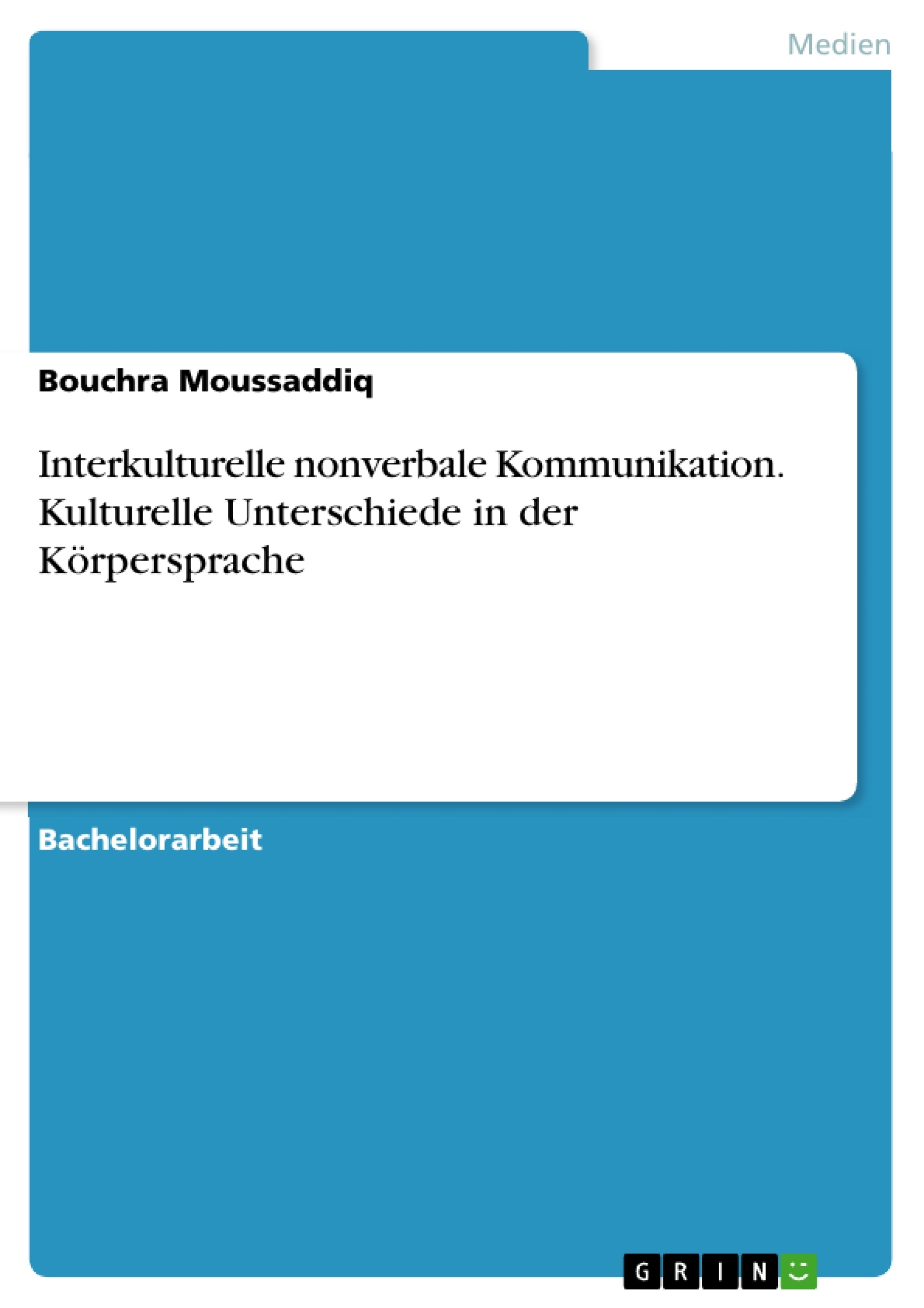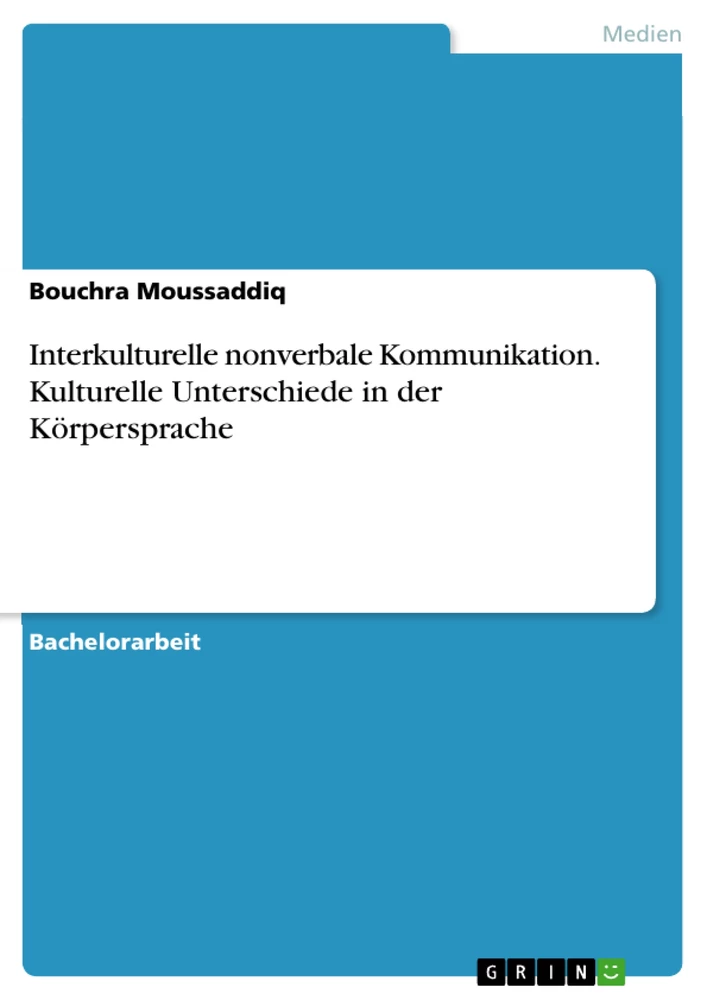
Interkulturelle nonverbale Kommunikation. Kulturelle Unterschiede in der Körpersprache
Bachelorarbeit, 2016
33 Seiten, Note: 1,7
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Danksagung
- Einleitung
- 1. Begriffserklärungen
- 1.1. Kommunikationsbegriff
- 1.2. Nonverbale Kommunikation
- 1.2.1. Sind nonverbale Inhalte angeboren oder erworben?
- 1.2.2. Bewusste und unbewusste Signale der Körpersprache
- 1.3. Kulturbegriff
- 2. Wichtigste kulturelle Differenzen in der nonverbalen Kommunikation
- 2.1. Blickkontakt
- 2.2. Mimik
- 2.3. Proxemik
- 2.4. Gestik
- 3. Beispiele für Darstellungen nonverbaler Ausdrücke
- 3.1. Beispiel 1: Merkel-Raute
- 3.2. Beispiel 2: R4bia-Zeichen
- 4. Funktion und Bedeutung der Körpersprache
- Schlussfolgerung
- Literaturverzeichnis
- Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht die nonverbale Kommunikation und ihre kulturellen Unterschiede als zentrale Form der zwischenmenschlichen Verständigung. Die Arbeit beleuchtet die Bedeutung nonverbaler Signale im Kontext kultureller Diversität und analysiert, wie diese Signale zu Missverständnissen führen können, wenn die jeweiligen kulturellen Codes nicht verstanden werden.
- Definitionen von Kommunikation, nonverbaler Kommunikation und Kultur
- Analyse der kulturellen Unterschiede in der nonverbalen Kommunikation, insbesondere in Bezug auf Blickkontakt, Mimik, Proxemik und Gestik
- Interpretation von Beispielen für kulturell spezifische nonverbale Ausdrücke
- Die Funktion und Bedeutung der Körpersprache als Kommunikationsmittel
- Die Bedeutung der interkulturellen Kommunikation im Kontext der Globalisierung und der Zunahme von Migrationsbewegungen
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel befasst sich mit der Definition von Kommunikation, nonverbaler Kommunikation und Kultur. Es analysiert die Entstehung nonverbaler Signale und beleuchtet die Frage, ob diese angeboren oder erlernt sind. Das zweite Kapitel untersucht die wichtigsten kulturellen Unterschiede in der nonverbalen Kommunikation, insbesondere in Bezug auf Blickkontakt, Mimik, Proxemik und Gestik. Es werden verschiedene kulturelle Perspektiven auf diese nonverbalen Ausdrucksformen beleuchtet. Das dritte Kapitel interpretiert zwei Beispiele für kulturell spezifische nonverbale Ausdrücke, die Merkel-Raute und das R4bia-Zeichen. Es analysiert die Bedeutung dieser Zeichen in ihren jeweiligen kulturellen Kontexten. Das vierte Kapitel widmet sich der Funktion und Bedeutung der Körpersprache als Kommunikationsmittel und beleuchtet ihre Wichtigkeit für die zwischenmenschliche Verständigung.
Schlüsselwörter
Nonverbale Kommunikation, Körpersprache, kulturelle Unterschiede, interkulturelle Kommunikation, Blickkontakt, Mimik, Proxemik, Gestik, Missverständnisse, Globalisierung, Migration, kulturelle Codes, Kommunikationsmittel, Zeichen, Symbole
Details
- Titel
- Interkulturelle nonverbale Kommunikation. Kulturelle Unterschiede in der Körpersprache
- Hochschule
- Université Mohammed V Rabat
- Note
- 1,7
- Autor
- Bouchra Moussaddiq (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2016
- Seiten
- 33
- Katalognummer
- V351268
- ISBN (eBook)
- 9783668378605
- ISBN (Buch)
- 9783668378612
- Dateigröße
- 1106 KB
- Sprache
- Deutsch
- Anmerkungen
- Der Autor ist kein Muttersprachler. Bitte entschuldigen Sie etwaige Rechtschreib- und Grammatikfehler, die die Qualität des Inhalts kaum beeinflussen.
- Schlagworte
- interkulturelle kommunikation kulturelle unterschiede körpersprache nonverbale Geste Mimik Proxemik ohne wote nonverbale kommunikation
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 16,99
- Preis (Book)
- US$ 19,99
- Arbeit zitieren
- Bouchra Moussaddiq (Autor:in), 2016, Interkulturelle nonverbale Kommunikation. Kulturelle Unterschiede in der Körpersprache, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/351268
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-