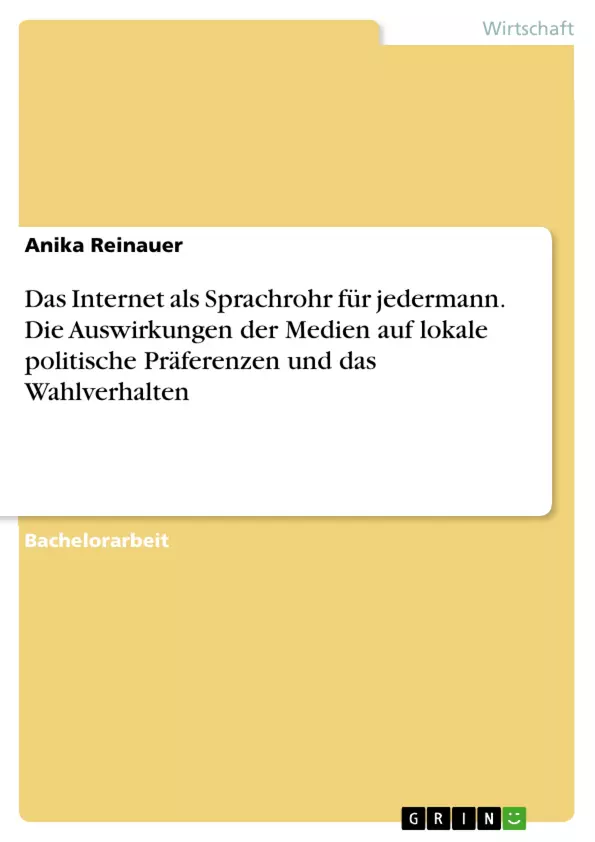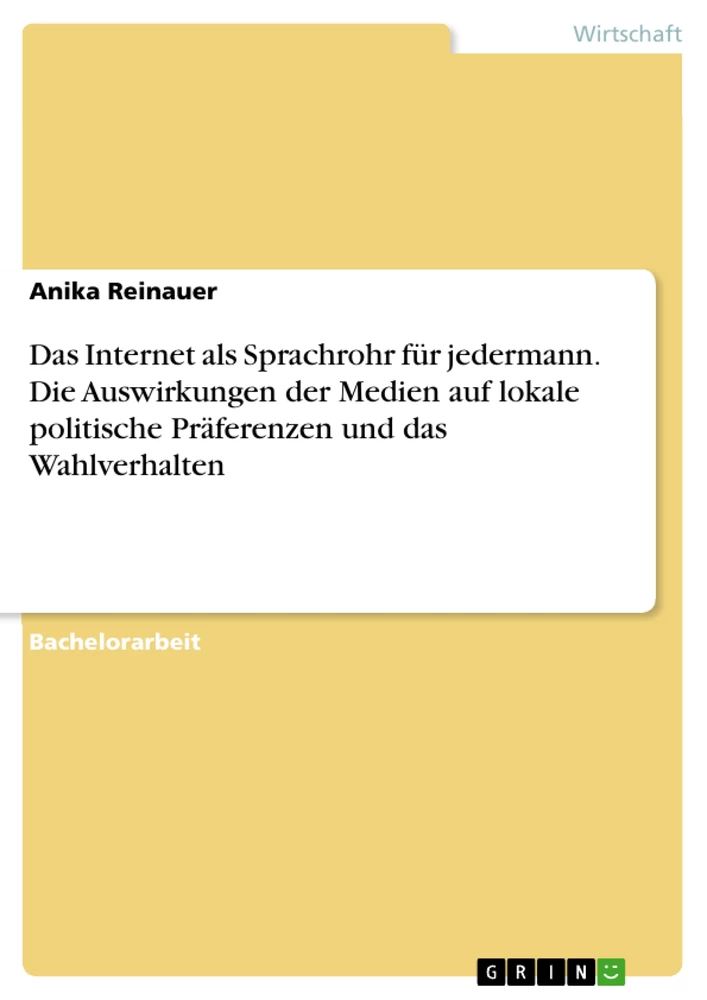
Das Internet als Sprachrohr für jedermann. Die Auswirkungen der Medien auf lokale politische Präferenzen und das Wahlverhalten
Bachelorarbeit, 2016
26 Seiten
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffsbestimmung und inhaltliche Abgrenzung
- Moderne Medien
- Lokale politische Präferenzen und Wahlverhalten
- Neuerungen durch das Internet
- Unterschiede zum Fernsehen
- Soziale Medien
- Verdrängung traditioneller Medien und Crowding-Out-Effekt
- Auswirkungen des Internets
- Wählerinformation
- Wahlbeteiligung
- Medienwettbewerb und Wahlkampf
- Politische Präferenzen und Wahlverhalten
- Ergebnisse
- Kritische Würdigung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Auswirkungen von modernen Medien, insbesondere des Internets, auf lokale politische Präferenzen und das Wahlverhalten. Sie will herausfinden, inwiefern das Internet die Informationsbeschaffung, Wahlbeteiligung, den Wahlkampf und die politische Meinungsbildung beeinflusst.
- Die Rolle des Internets im Vergleich zu traditionellen Medien wie dem Fernsehen
- Der Einfluss sozialer Medien auf die politische Kommunikation und Meinungsbildung
- Die Auswirkungen des Internets auf die Wahlbeteiligung und die Wahlpräferenzen
- Der Einfluss des Internets auf den Wahlkampf und den Wettbewerb zwischen Parteien
- Die Herausforderungen und Chancen, die das Internet für die politische Bildung und Partizipation bietet
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Diese Einleitung stellt die Relevanz des Themas vor und liefert einen kurzen Überblick über die Entwicklung der Medien und ihre Bedeutung für die Politik.
- Begriffsbestimmung und inhaltliche Abgrenzung: Dieses Kapitel definiert die zentralen Begriffe der Arbeit, wie "moderne Medien" und "lokale politische Präferenzen", und grenzt sie gegeneinander ab.
- Neuerungen durch das Internet: Hier werden die spezifischen Besonderheiten des Internets im Vergleich zu traditionellen Medien wie dem Fernsehen, insbesondere die Rolle der sozialen Medien, beleuchtet.
- Auswirkungen des Internets: Dieses Kapitel analysiert die Auswirkungen des Internets auf die politische Kommunikation und das Wahlverhalten. Es beleuchtet Themen wie die Informationsbeschaffung, Wahlbeteiligung, den Wahlkampf und die politische Meinungsbildung.
- Ergebnisse: Dieses Kapitel fasst die Ergebnisse der Analyse zusammen und zeigt die wichtigsten Erkenntnisse der Arbeit auf.
- Kritische Würdigung: In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Arbeit kritisch reflektiert und mögliche Schwächen oder Einschränkungen der Forschung beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Medien und Politik, insbesondere mit der Rolle des Internets in der politischen Kommunikation, der Meinungsbildung und dem Wahlverhalten. Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Internet, Soziale Medien, Wahlbeteiligung, Wahlkampf, Politische Präferenzen, Informationsbeschaffung, Crowding-Out-Effekt.
Häufig gestellte Fragen
Wie beeinflusst das Internet das Wahlverhalten?
Das Internet ermöglicht eine schnellere und weitreichendere Bereitstellung von Informationen, was die politische Meinungsbildung und Wahlbeteiligung beeinflussen kann.
Was ist der „Crowding-Out-Effekt“ im Medienkontext?
Es beschreibt die Verdrängung traditioneller Medien wie dem Fernsehen oder der Zeitung durch die intensive Nutzung des Internets und sozialer Medien.
Warum gilt Barack Obamas Wahlkampf 2008 als Meilenstein?
Seine Kampagne gilt als prominentes Beispiel für den erfolgreichen Einsatz verschiedenster Online-Plattformen, um potenzielle Wähler gezielt anzusprechen.
Welche Rolle spielen soziale Medien für die Demokratie?
Soziale Netzwerke wie Twitter oder Facebook dienen als „Sprachrohr für jedermann“, wodurch der Informationskonsum egalitärer werden kann.
Wie verändert das Internet den politischen Wettbewerb?
Informationen können kostengünstiger verbreitet werden, was den Wahlkampf dynamischer macht und neue Möglichkeiten für die Interaktion zwischen Politikern und Bürgern schafft.
Details
- Titel
- Das Internet als Sprachrohr für jedermann. Die Auswirkungen der Medien auf lokale politische Präferenzen und das Wahlverhalten
- Hochschule
- Universität Konstanz
- Autor
- Anika Reinauer (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2016
- Seiten
- 26
- Katalognummer
- V351526
- ISBN (eBook)
- 9783668391871
- ISBN (Buch)
- 9783668391888
- Dateigröße
- 615 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- internet sprachrohr auswirkungen medien präferenzen wahlverhalten
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 18,99
- Preis (Book)
- US$ 20,99
- Arbeit zitieren
- Anika Reinauer (Autor:in), 2016, Das Internet als Sprachrohr für jedermann. Die Auswirkungen der Medien auf lokale politische Präferenzen und das Wahlverhalten, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/351526
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-